STEFAN APPELIUS Den Ungeist Des Militarismus Ausmerzen. Fritz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

01-707 Carl Otto Lenz
01-707 Carl Otto Lenz ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 707 CARL OTTO LENZ SANKT AUGUSTIN 2014 I Inhaltsverzeichnis 1 Persönliches 1 1.1 Glückwünsche/Kondolenzen 1 1.2 Termine 1 1.3 Pressemeldungen zur Person 2 2 Veröffentlichungen: Beiträge, Reden, Interviews 3 3 CDU Kreisverband Bergstraße 6 4 BACDJ 9 5 Wahlen 10 5.1 Bundestagswahlen 10 5.2 Landtagswahlen Hessen 10 5.3 Kommunalwahlen Hessen 11 5.4 Allgemein 11 6 Deutscher Bundestag 13 6.1 Sachgebiete 13 6.1.1 Verfassungsreform 25 6.1.2 Ehe- und Familienrecht 27 6.2 Ausschüsse 29 6.3 Politische Korrespondenz 31 7 Europa 64 7.1 Materialsammlung Artikel, Aufsätze und Vorträge A-Z 64 7.2 Europäischer Gerichtshof / Materialsammlung A-Z 64 7.2.1 Sachgebiete 64 7.3 Seminare, Konferenzen und Vorträge 64 8 Universitäten 65 9 Sonstiges 66 Sachbegriff-Register 67 Ortsregister 75 Personenregister 76 Biographische Angaben: 5. Juni 1930 Geboren in Berlin 1948 Abitur in München 1949-1956 Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten München, Freiburg/Br., Fribourg/Schweiz und Bonn 1954 Referendarexamen 1955-56 Cornell University/USA 1958 Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer 1959 Assessorexamen 1961 Promotion zum Dr. jur. in Bonn ("Die Beratungsinstitutionen des amerikanischen Präsidenten in Fragen der allgemeinen Politik") 1957 Eintritt in die CDU 1959-1966 Generalsekretär der CD-Fraktion des Europäischen Parlaments in Straßburg und Luxemburg und 1963-1966 der Parlamentarischen Versammlung der WEU in Paris 1965-1984 -
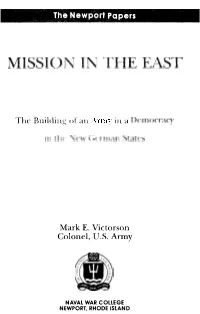
The Newport Papers 'The Buildini! of an ;\Nnv in a I)Ernocrac" Mark E. Victorson Colonel, U.S. Army
, , " � The Newport Papers '. ,'....-" .. - " an a 'The Buildini!j\ , of ;\nnv" in I)ernocrac"1 Mark E. Victorson Colonel, U.S. Army NAVAL WAR COLLEGE NEWPORT, RHODE ISLAND MISSION IN THE EAST NAVAL WAR COLLEGE Newport, Rhode Island CENTER FOR NAVAL WARFARE STUDIES Newport Paper #7 June 1994 "The NewportPapers" series is a vehicle for distribution of substantial work by members of the Naval War College's teaching and research faculty and students as well as members of the broad international security community. Papers are drawn generally from manuscripts not scheduled for publication either as articles in the Naval War College Review or as books from the Naval War College Pressbut that nonetheless merit extensive distribution. Candidates are considered by an editorial board under the auspices of the Dean of Naval Warfare Studies. The views expressed in The Newport Papers are those of the authors and not necessarily those of the Naval War College or the Department of the Navy. Correspondenceconcernin g The Newport Papers should be addressed to the Dean of Naval Warfare Studies. Requests for additional copies or for permanent distribution should be directed to the President, Code 32A, Naval War College, 686 Cushing Road, Newport, Rhode Island 02841-1207. Telephone (401) 841-2236 or DSN 948-2236, and fax (401) 841-3579. Printed in the United States of America Mission in the East The Building of an Army in a Democracy in the New German States Mark E. Victors on Colonel, U.S. Army Contents Acknowledgements . v Introduction . 1 lnnere Fuehrung . 3 The Bundeswehr and the NVA 9 The Turning Point . -

6 HA III Öffentlichkeitsarbeit
Seite:ÿ312 CDU-Bundesparteiÿÿ(07-001) Signatur Laufzeit 6ÿHAÿIIIÿÖffentlichkeitsarbeit 6.1ÿAbteilungÿÖffentlichkeitsarbeit 6.1.1ÿAbteilungsleiterÿÖffentlichkeitsarbeit 20001ÿ -ÿ AbteilungÿIIIÿÖffentlichkeitsarbeitÿundÿWerbungÿ 1968ÿ-ÿ1969ÿ Konrad-Adenauer-Stiftung,ÿWIKASÿ1968ÿ-ÿ1969 AbteilungsleiterÿGerhardÿElschner WissenschaftlichesÿInstitutÿder Konrad-Adenauer-Stiftungÿ(WIKAS) Protokolle,ÿVermerke,ÿBericht,ÿKorrespondenz,ÿPresse, Ausarbeitungen,ÿinsbesondere: BisherigeÿArbeitenÿüberÿdieÿNPD ProtokollÿderÿBesprechungÿamÿ18.04.1969 Vermerkÿbetr.ÿAuseinandersetzungÿmitÿderÿNPD 1./2.ÿEntwurfÿfürÿeinÿWahlprogrammÿ1969ÿderÿCDU Bericht:ÿPolitischeÿEinstellungenÿinÿBayernÿ-ÿErgebnisse einerÿRepresentativbefragungÿimÿHerbstÿ1968 AnalyseÿdesÿDeutschlandtagesÿderÿJungenÿUnionÿ1968 Überlegungenÿzuÿeinerÿrepräsentativ-statistischen UntersuchungÿüberÿdasÿThema:ÿWissenÿund EinstellungsbildÿzurÿqualifiziertenÿMitbestimmungÿund derenÿmöglichenÿAlternativen VorlageÿdesÿallgemeinenÿTextteilsÿderÿSchrift:ÿZur VorbereitungÿderÿBundestagswahlÿ1969 DieÿGestaltungschancenÿderÿParteienÿ-ÿEineÿAuswertung zweierÿempirischerÿUntersuchungenÿvonÿPaul Kevenhörster AusarbeitungÿPaulÿKevenhörster:ÿVerliertÿdieÿNPD Wähler? Bericht:ÿDieÿUnruhenÿinÿFrankreichÿimÿMai/Juniÿ1968 undÿihreÿFolgenÿfürÿdieÿfranzösischeÿWirtschaft RechtsradikalismusÿinÿDeutschland?ÿ-ÿEine UntersuchungÿbeiÿdenÿAnhängernÿderÿNPD AusarbeitungÿIngridÿRiemen:ÿHerabsetzungÿdes Wahlalters Bericht:ÿPolitikÿinÿRundfunkÿundÿFernsehen 6.1.2ÿWerbemittel 6.1.2.1ÿBundesebene 6.1.2.1.1ÿGründungÿbisÿeinschließlichÿBTWÿ1949 -

2 Fraktionsvorsitzende Und Parlamentarische Geschäftsführer Geschäftsführer
ARCHIVALIE CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Seite: 102 Karton/AO Signatur: 08-001 Datum 2 Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer Geschäftsführer 2.1 Fraktionsvorsitzende 2.1.1 Heinrich von Brentano Fraktionsvorsitzender 1949 - 1955 sowie 1961 - 1964. 292/4 - Brentano, Heinrich von 01.11.1949 - 03.12.1949 Hier: Bundeshauptstadt, Sitz: Zuschriften von Wählern und der Deutschen Wählergemeinschaft zur Abstimmung über den Sitz der Bundeshauptstadt 303/3 - Brentano, Heinrich von 03.11.1949 - 10.09.1955 Hier: Südweststaat: Informationsmaterial, Eingaben und Stellungnahmen von CDU-Gremien zur Badener Frage; Gutachten von Paul Zürcher zum Entwurf eines Neugliederungsgesetzes (1951); Informationsmaterial zu dem Rücktritt von Wilhelm Eckert; Ausarbeitung von Leo Wohleb; Schriftwechsel u.a. mit: Adenauer, Konrad Wuermeling, Franz-Josef Müller, Gebhard 292/3 - Brentano, Heinrich von 1950 Hier: Regierungsbauten Schriftwechsel zur Ausstattung, Kostenaufstellung 301/1 - Brentano, Heinrich von 1950 - 1951 Hier: Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlebergbaus: Schriftwechsel, Informationsmaterial 292/7 - Brentano, Heinrich von 1952 Hier: Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn: Besprechungen, Schriftwechsel. 296/1 - Brentano, Heinrich von 1954 Hier: Bildung eines Koordinierungsausschusses: Schriftwechsel Paul Bausch/Rudolf Vogel; Ausarbeitung von Otto Lenz 313/3 - Brentano, Heinrich von 1954 Hier: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Interfraktioneller Schriftwechsel mit Theodor -

60 Jahre Wehrbeauftragter Des Deutschen Bundestages 1959-2019
60 Jahre Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 1959 – 2019 Expertensymposium vom 20. bis 22. Mai 2019 im Schloss & Gut Liebenberg 60 Jahre Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 1959 – 2019 Expertensymposium vom 20. bis 22. Mai 2019 im Schloss & Gut Liebenberg 4 Vorwort 8 Das Amt des Wehrbeauftragten – eine demokratische Errungenschaft Rede von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble 20 Aller Anfang ist schwer – Kandidatensuche und Überwindung von Widerständen Oberstleutnant Dr. Rudolf J. Schlaffer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissen- schaften der Bundeswehr 46 Innere Führung – bloß eine intellektuelle Spielerei? Prof. Dr. Loretana de Libero Führungsakademie der Bundeswehr 62 Innere Führung – wie geht es weiter? Generalmajor Reinhardt Zudrop Zentrum Innere Führung 68 Eingabe beim Wehrbeauftragten, Beschwerde nach der Wehrbeschwerdeordnung oder Gespräch mit dem Militärseelsorger? Inhalt 2 74 Militärisches Ombudswesen – eine internationale Perspektive 78 Die Beziehung zwischen Wehrbeauftragtem, Deutschem Bundestag und Bundeswehr 82 Armee zwischen Grundbetrieb, Bündnis- verteidigung und Einsatz. Geänderte Rahmen- bedingungen für die parlamentarische Kontrolle Generalleutnant Jörg Vollmer Inspekteur des Heeres Roderich Kiesewetter Mitglied des Deutschen Bundestages 86 Zum Tagungsort Schloss & Gut Liebenberg Prof. Dr. Michael Epkenhans, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3 Wann die Geschichte beginnt, ist nicht ganz eindeutig zu datieren. 1956 trat mit den neuen Wehrartikeln die einschlägige Grundgesetzänderung in Kraft, Art. 45b: „Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages für die Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bun- desgesetz.“ Dieses Gesetz kam 1957. Es bestimmt unter anderem, dass der Wehrbeauftragte auch über die Ein- haltung der Grundsätze der Inneren Führung wachen soll. Hier ist der neue Begriff „Innere Führung“ zum ersten Mal gesetzlich verankert. -

UID Jg. 11 1957 Nr. 34, Union in Deutschland
POSTVERLAGSORT BONN NR 34 M. JAHRGANG BONN • 22. AUG. 1957 UxI2£t4tschlaru?L INFORMATIONSDIENST der Christlich Demokratischen und Christlich-Sozialen Union Darum nicht SPD! Die SPD forderte Ausgabenerhöhung von über 21 Milliarden DM: Der Schritt zur Inflation „Die Preise runter — darum SPD!" und „Wer SPD wählt, der sichert vom Bundestag bewilligten Steuersen- )ile Preise, stabile Währung". Mit diesen Parolen wendet sich die SPD kungen, genau um 5 967 500 DM. Für den jetzt an den ahnungslosen Wähler. Es genügt ihr nicht, daß gerade die Luftschutz wurden zwischen 1954 und sozialdemokratisch regierten Länder Nordeuropas — Schweden und Däne- 1957 insgesamt 4,2 Milliarden DM gefor- dert, obwohl erst jetzt die notwendigen mark — von den sozialdemokratischen Rezepten alles andere als stabile fachmännischen Untersuchungen ange- Währungen und Preissenkungen gewannen. stellt werden konnten, die dem Aufbau eines Luftschutzes vorangehen müssen. Die Bank für Internationalen Zahlungs- SPD allein im Bundestag einbrachte. Die Angst vor Unpopularität ausgleich hat festgestellt: 47 v.H. dessen; finanzielle Belastung durch diese An- was die Arbeiter in Schweden zwischen träge wurde auch jeweils nur für das Natürlich hat die SPD keine unpopu- 1954 und 1956 durch Lohnerhöhungen er- Jahr, für das der Antrag gestellt wurde, lären Anträge gestellt. Sie hat — auch hielten, wurde von den unter der sozia- errechnet. Da viele der Anträge Ausga- das „Vorbild" der Wohlfahrtsstaaten un- listischen Wirtschaftspolitik erzielten ben nicht nur in einem Jahr, sondern in ter sozialistischer Regierung wie z. B. Preissteigerungen verschlungen. In Dä- allen folgenden Jahren bedeutet hätten, Schweden und Dänemark, vor Augen — nemark wurden 92 v. H. aller Lohnerhö- wäre die Gesamtsumme wesentlich höher immer wieder neue und höhere Ausga- hungen durch Preissteigerungen ver- als 21 Milliarden DM. -

Side Om Side I Det Kommende Europa 97
94 Hans Schultz Hansen Zusammenfassung Side om side Am 8. Dezember 1940 veranstaltete Dänemarks National-Sozialistische Arbeiter-Partei eine öffentliche Kundgebung im ‚Højskolehjemmet‘ in i det kommende Europa Hadersleben. Vor der Kundgebung marschierten ungefähr 275 Mann København-Bonn erklæringerne von der schleswigschen ’Sportsabteilung’ der DNSAP in Uniform und og Vesttysklands optagelse i NATO, 1948-1955 mit Spaten bewaffnet durch die Stadt. Damit verstieß die SA bewusst gegen das Verbot der politischen Uniformierung. Die Polizei in Haders- Af Jesper Thestrup Henriksen1 leben konnte alleine den Marsch nicht verhindern. Mit Verstärkung aus den benachbarten Polizeikreisen wurde aber das ‚Højskolehjem‘ um- Fremstillingen af Vesttysklands optagelse i NATO har i Danmark ofte været stellt. Es kam zu Schlägereien, als die Polizei zwei Wachtposten der SA knyttet til en løsning af mindretalsspørgsmålet i Sydslesvig som et dansk krav verhaftete. Mehrere Polizisten wurden durch Spatenschläge verletzt, til tyskerne, inden man ville godkende deres NATO-medlemskab. Og fokus har den Polizeibeamten wurde befohlen, ihre Waffen zu ziehen, jedoch ofte været rettet mod den danske regerings og andre danske politikeres ind- kam es nicht zum Schießbefehl. Nach der Kundgebung verließen die sats i den anledning. I denne artikel argumenteres for, at der var fælles dansk- Zivilisten den Saal. Mitglieder der SA weigerten sich verhaftet zu wer- vesttyske sikkerhedspolitiske interesser i et tæt forsvarssamarbejde mellem de to lande, der gjorde det oplagt at løse mindretalsproblemerne nord og syd for den und blieben im Saal. Mittlerweile war die Zahl der Polizeibeamten grænsen samtidig med Vesttysklands optagelse i NATO. Interesser, der navnlig auf 130 angestiegen. Die Mitglieder der SA wurden unter Anwendung blev varetaget af konservative danske og tyske parlamentarikere i forbereden- von Tränengas heraus getrieben. -

8 Bundestagswahlen
Seite:ÿ436 CDU-Bundesparteiÿÿ(07-001) Signatur Laufzeit 8ÿBundestagswahlen A)ÿAllgemeines InÿdieÿKapitelÿWahlenÿzumÿDeutschenÿBundestag, Landtagswahlen,ÿKommunalwahlen,ÿEuropawahlen, DDR-Wahlenÿ1990ÿwurdenÿnurÿdiejenigenÿAktenordner eingearbeitet,ÿdieÿgemäßÿihrerÿAufschriftÿoffensichtlich WahlenÿzumÿThemaÿhatten.ÿDeshalbÿistÿesÿmöglich,ÿdass auchÿinÿanderenÿTeilbeständenÿderÿCDU-Bundespartei nochÿWahlkampfunterlagenÿzuÿfindenÿsind,ÿumsoÿmehr, daÿdieserÿThemenbereichÿnichtÿeindeutigÿabgrenzbarÿist.ÿ AndererseitsÿsindÿaberÿauchÿhierÿUnterlagenÿvorhanden, dieÿinÿanderenÿKapitelnÿfehlenÿkönnen. EinÿGroßteilÿderÿWahlenÿbisÿ1972ÿwarÿbereitsÿerfasstÿund konnteÿdarumÿnichtÿneuÿstrukturiertÿwerden.ÿAusÿdiesem GrundÿfindenÿsichÿhierÿmanchmalÿauchÿMischakten,ÿdie ganzÿunterschiedlicheÿThemenÿbetreffen. DieÿWahlenÿabÿ1973ÿwurdenÿdagegenÿvollständigÿneu strukturiert. DerÿBereichÿ"DDR-Wahlen"ÿumfasstÿinÿersterÿLinieÿdie VolkskammerwahlenÿvomÿMärzÿ1990,ÿaberÿauchÿdie KommunalwahlenÿvomÿMaiÿ1990ÿundÿdieÿLandtagswahlen vomÿOktoberÿ1990.ÿFürÿdenÿgesamtenÿBereich "DDR-Wahlen"ÿgilt:ÿAlleÿAkten,ÿdieÿnichtÿexplizitÿden Kommunal-ÿoderÿLandtagswahlenÿzugewiesenÿsind, gehörenÿzuÿdenÿVolkskammerwahlen. EsÿfindetÿsichÿauchÿeineÿAnzahlÿgebundener Akteneinheiten,ÿbeiÿdenenÿderÿvorgegebeneÿTitel übernommenÿwurde.ÿAußerdemÿistÿdieÿAnzahlÿder vorhandenenÿExemplareÿangegeben. WerbemittelÿundÿPublikationenÿsindÿebensoÿwieÿPlakate undÿFotosÿnichtÿimÿBestandÿ"Wahlen"ÿverblieben (Ausnahme:ÿwennÿsieÿinÿgebundenerÿFormÿvorliegenÿwie dieÿWerbemittelkatalogeÿundÿDokumentationen).ÿ -

Western Europe
Western Europe Great Britain T. HE MAJOR political event of the year was the general election. Held in October1H , it brought the Labor party to power with a majority of four. As Labor could depend on the six Liberal votes on most issues, they had an adequate working majority, but not one that suggested five years of office. The new House of Commons contained 33 Jews (31 Labor, 2 Conservative). The Queen's speech at the opening of Parliament in November included a promise of action against race discrimination. Anti-colored sentiments had been played down during the election, except at Smethwick, in the Midlands, where supporters of the Conservative candidate exploited racial antagonisms. It was the only constituency where there was a major swing of votes to the Conservatives. The financial position of the United Kingdom had deteriorated during the election period, and the new government found itself faced by grave balance- of-payments problems, which it attempted to solve by imposing a 15-per-cent surcharge on imports. This greatly annoyed continental exporters, but failed to prevent a run on sterling. The government was forced to raise the bank rate to 7 per cent, and it secured credits of $3 billion from foreign central banks for use in defending the pound. Repayments of $62 million on United States and Canadian loans had to be deferred. It appeared that the "stop-go" ap- proach to the economy was again to prevail. After Prime Minister Harold Wilson visited President Lyndon B. Johnson in December, he declared that the "charade" of independent nuclear power had come to an end. -

Kansas City, Missouri Program
GERMAN STUDIES ASSOCIATION Thirty-Eighth Annual Conference September 18–21, 2014 Kansas City, Missouri Program of the Thirty-Eighth Annual Conference German Studies Association September 18–21, 2014 Kansas City, Missouri Westin Kansas City at Crown Center German Studies Association Main Office: 1200 Academy Street Kalamazoo, MI 49006-3295 USA Tel.: (269) 267-7585 Fax: (269) 337-7251 www.thegsa.org e-mail: [email protected] Technical Support: [email protected] President Suzanne Marchand (2013–2014) Louisiana State University Vice President Irene Kacandes (2013–2014) Dartmouth College Secretary-Treasurer Gerald A. Fetz University of Montana Executive Director David E. Barclay Kalamazoo College GSA Board: Elizabeth Ametsbichler, University of Montana (2015) Joy H. Calico, Vanderbilt University (2016) Alice H. Cooper, University of Mississippi (2015) Geoff Eley, University of Michigan, Ann Arbor (2014) Randall Halle, University of Pittsburgh (2016) Leslie Morris, University of Minnesota, Twin Cities (2014) Janet A. Ward, University of Oklahoma (2015) Dorothee Wierling, Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Universität Hamburg (2014) S. Jonathan Wiesen, Southern Illinois University, Carbondale (2016) Stephen Brockmann, Carnegie Mellon University, ex officio non-voting (2014) Sabine Hake, University of Texas at Austin, ex officio non-voting © Copyright 2014 by German Studies Association Institutional Members American Friends of the Alexander Leo Baeck Institute, New York von Humboldt Foundation McGill University American Friends of the Max -

Am Anfang War Kampf Kolumne Kolumne Des Wehrbeauftragten
Am Anfang war Kampf Kolumne Kolumne des Wehrbeauftragten uf meinem Schreibtisch liegen zwei Ausgaben der AQuick und ein Spiegel-Heft aus dem Jahr 1964. Von allen Covern schaut ernst der damalige Wehrbeauftragte Hellmuth Heye. Ihn trieb in die Öffentlichkeit seine Sorge, dass die Bundeswehr kein „Staat im Staate“ werden dür- fe, dass es Tendenzen der Restauration eines überkom- menen absoluten Befehlsgehorsams gebe und dass die Innere Führung in der neuen westdeutschen Armee noch längst nicht durchgesetzt sei, sondern als „weiche Wel- le“ verspottet werde. So sehr Regierung und Regierungs- fraktionen damals auch dagegenhielten, der Heye-Alarm hatte eine Langzeitwirkung: Staatsbürger in Uniform und Innere Führung sind Kernthemen der parlamentarischen Kontrolle unserer Streitkräfte geblieben, auch Jahrzehnte später, auch nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Die beiden ersten Wehrbeauftragten sind übrigens, aus un- Abschied von der Wehrpfl ichtarmee. terschiedlichen Gründen, jeweils vorzeitig zurückgetreten. Beide kamen aus preußischen Militärfamilien und dienten 1956 war das Amt eines Wehrbeauftragten des Deutschen im Zweiten Weltkrieg als hohe Wehrmachtsoffi ziere: Gene- Bundestages ins Grundgesetz geschrieben, ein Jahr später ralleutnant von Grolman war zuletzt an der Ostfront Chef ein eigenes Wehrbeauftragtengesetz verabschiedet wor- des Stabes der Heeresgruppe Süd; später Staatssekretär den. Ein gewählter, unabhängiger Parlamentsbeauftragter in Niedersachsen. In seinem Vorzimmer saß 1944 der Ge- soll seither die Grundrechte der Soldaten -

090/20 Das Amt Der/Des Wehrbeauftragten in Internationaler
Wissenschaftliche Dienste Sachstand Das Amt der/des Wehrbeauftragten in internationaler Perspektive Militärische Ombudsleute in anderen Ländern – eine Übersicht © 2020 Deutscher Bundestag WD 2 – 3000 – 090/20 Wissenschaftliche Dienste Sachstand Seite 2 WD 2 - 3000 - 090/20 Das Amt der/des Wehrbeauftragten in internationaler Perspektive Militärische Ombudsleute in anderen Ländern – eine Übersicht Aktenzeichen: WD 2 - 3000 - 090/20 Abschluss der Arbeit: 26. Oktober 2020 Fachbereich: WD 2: Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidigung, Menschenrechte und humanitäre Hilfe Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. Wissenschaftliche Dienste Sachstand Seite 3 WD 2 - 3000 - 090/20 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkung 4 2. Die/der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages 4 2.1. Historischer Hintergrund 4 2.2. Frühgeschichte des Amtes des/der Wehrbeauftragten 7 2.3. Das Amt der/des Wehrbeauftragten wird Gesetz und Realität 8 2.4. Kontroverse Anfangszeiten 11 2.5. Das Amt des/der Wehrbeauftragten, eine schwer vergleichbare Institution 14 3.