Geschichte & Geschichten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

20 Jahre 1994 - 2014
der Gemeinde Struppen und der Ortsteile Ebenheit, Naundorf, Strand, Struppen-Siedlung, Thürmsdorf und Weißig Jahrgang 23 Freitag, den 29. August 2014 Nummer 8 20 Jahre 1994 - 2014 1994 2005 2002 Auf zur Weißiger Dorfkirmes Lesen Sie mehr auf Seite 7. Aus dem Inhalt Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und der Verwaltungsgemeinschaft Königstein Seite 2 Amtliche Bekanntmachungen Seite 3 Kirchliche Nachrichten Seite 6 Neues aus Schulen, Hort und Kindergärten Seite 7 Vereinsnachrichten Seite 7 Wir gratulieren Seite 8 Verschiedenes Seite 8 Struppen - 2 - Nr. 8/2014 Bürgermeister nach Vereinbarung! Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und Telefonnummern Stadtverwaltung Königstein der Verwaltungsgemeinschaft Königstein Sekretariat Tel. 035021 99750 Meldeamt 035021 99710 Hauptamt 035021 99713 Informationen aus der Verwaltung Ordnungsamt 035021 99719 Bauamt 035021 99730 Gemeindeverwaltung Struppen Steuern 035021 99722 Hauptstraße 48, 01796 Struppen Kasse 035021 99724 Tel. 035020 70418, Fax 035020 70154 E-Mail: [email protected] Sprechstunde Friedensrichterin www.struppen.de Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der Verwal- tungsgemeinschaft Königstein, Frau Rekusch, findet am Bauhof Struppen Donnerstag, dem 04.09.2014 Telefon 0157 86253643 nach vorheriger telefonischer Voranmeldung unter 0172 1023120 statt. Kinderhaus Struppen Telefon 035020 776833 E-Mail: [email protected] www.struppen.de Kindereinrichtungen Notrufnummern Ortsteil Versorger Telefonnummer Öffnungszeiten Gemeinde Struppen --------------------------------------------------------------------- Bürgerbüro: Ebenheit Abwasser 01702786755 Montag 9.00 - 12.00 Uhr Struppen Dienstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr Struppen Siedlung MIittwoch geschlossen Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr alle Ortsteile Wasser 0351 50178882 Freitag 9.00 - 12.00 Uhr Sprechzeit Bürgermeister: Dienstag 13:00 bis 18:00 Uhr Naundorf Abwasser 035027 62348/ nach Vereinbarung! 01715025266 Am Dienstag, dem 2. -
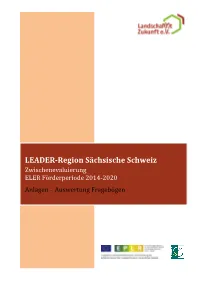
LES Sächsische Schweiz
LEADER-Region Sächsische Schweiz Zwischenevaluierung ELER Förderperiode 2014-2020 Anlagen – Auswertung Fragebögen Anlagen – Zwischenevaluierung LEADER-Region Sächsische Schweiz 2014 - 2020 3 1. AUSWERTUNG FRAGEBOGEN KOMMUNEN Anzahl Befragungsteilnehmer: 12 (von 23) K 1. Übersicht der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen am 30.06.2018 Gemeinde/Stadt Ortsteil Einwohner Fläche in ha Fläche in km² Einwohner/km² Bahretal Borna 181 391,0 3,91 46 Bahretal Friedrichswalde 518 444,0 4,44 117 Bahretal Gersdorf 431 690,3 6,90 62 Bahretal Göppersdorf + Wingendorf 212 918,5 9,18 23 Nentmannsdorf + Niedersei- Bahretal 509 743,5 7,44 68 dewitz Bahretal Ottendorf 362 465,0 4,65 78 Bahretal gesamt 2.213 3.652,3 36,52 61 Gohrisch Kurort Gohrisch 757 k.A. k.A. Gohrisch Cunnersdorf 404 k.A. Gohrisch Kleinhennersdorf 232 k.A. Gohrisch Papstdorf 469 Gohrisch gesamt 1.862 3.486,6 34,87 53 Heidenau gesamt 16.779 1.107,0 k.A. k.A. Königstein Königstein 1.611 k.A. Königstein Pfaffendorf 298 k.A. Königstein Leupoldishain 208 Königstein gesamt 2.117 2.704,5 27,04 78 Kurort Rathen gesamt 345 3,58 96 Pirna Birkwitz 766 230,0 2,30 333 Pirna Bonnewitz 241 230,0 2,30 105 Pirna Copitz 9.709 450,0 4,50 2.158 Pirna Cunnersdorf 144 50,0 0,50 288 Pirna Graupa 3.107 710,0 7,10 438 Pirna Jessen 1.089 190,0 1,90 573 Pirna Krietzschwitz 139 400,0 4,00 35 Pirna Liebethal 281 140,0 1,40 201 Pirna Mockethal 328 280,0 2,80 117 Pirna Niedervogelgesang 59 40,0 0,40 148 Pirna Neundorf 492 160,0 1,60 308 Pirna Obervogelgesang 82 50,0 0,50 164 Pirna Pirna 14.169 830,0 8,30 1707 Pirna Posta -

Gebietskulisse Für Die LEADER-Region Sächsische Schweiz / Förderperiode 2014-2020 / Stand 1.7.2015
Gebietskulisse für die LEADER-Region Sächsische Schweiz / Förderperiode 2014-2020 / Stand 1.7.2015 Einwohnerzahlen der Gemeinde Stand 30.06.2013 lt. Statistischem Landesamt vff = voll förderfähig / * Ortsteil nicht förderfähig, da keine Teilnahme an LEADER Einwohner Ort nur für Einwohner zahl Ort nicht investive Landkreis Gemeinde Gemeindeteil zahl Gemeinde förderfähig Maßnahmen Gemeinde teil förderfähig Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Bad Gottleuba, Kurort 5686 1615 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Bahra 5686 228 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Berggießhübel, Kurort 5686 1635 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Börnersdorf 5686 272 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Breitenau 5686 165 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Forsthaus 5686 95 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Hellendorf 5686 374 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Hennersbach 5686 43 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Langenhennersdorf 5686 605 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Markersbach 5686 343 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Oelsen 5686 187 ja vff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Zwiesel 5686 124 ja -

LES Sächsische Schweiz
LEADER-Entwick- lungsstrategie Region Sächsische Schweiz Förderperiode 2014-2020 6. Änderung geänderte Fassung vom 05.11.2018 LEADER-Entwicklungsstrategie Region Sächsische Schweiz IMPRESSUM: Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde. Die LEADER-Entwicklungsstrategie ist ein Projekt der regionalen Partnerschaft der Region Sächsische Schweiz. Auftraggeber: Landschaf(f)t Zukunft e.V. Siegfried-Rädel-Straße 9, 01796 Pirna 03501-4704870, [email protected] Auftragnehmer: Korff Agentur für Regionalentwicklung Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden 0351-8838 3530, [email protected] Bearbeitung/Redaktion: Regionalmanagement Sächsische Schweiz Ulrike Funke Joachim Oswald Yvonne Bergmann Korff Agentur für Regionalentwicklung Dr. Johannes von Korff Dipl.-Geogr. Mandy Zimmer Redaktionsschluss: 08. Juli 2015 1. Änderung der Fassung: 08. Juli 2015 2. Änderung der Fassung: 13. November 2015 3. Änderung der Fassung: 07. September 2016 4. Änderung der Fassung: 26. Juni 2017 5. Änderung der Fassung: 20. März 2018 6. Änderung der Fassung: 05.November 2018 Bildnachweise Titelseite: © Reinhardtsdorf-Schöna, Martin Milowsky-fotalia © Schmilksche Mühle, mungg-fotalia.com © Stadt Wehlen, Frank Exß © Wollfest, feuerwerkbykaze.blogspot.com © Zirkelstein, der Grafiker.de-fotalia.com geänderte Fassung vom 05.11.2018 INHALT KURZFASSUNG ............................................................................................................................... -

Sattelberg Und Gottleubatal Karte 597 598 Sattelberg Und Gottleubatal
596 Sattelberg und Gottleubatal Karte 597 598 Sattelberg und Gottleubatal 1 Špičák / Sattelberg 13 Tannenbusch 2 Wiesen zwischen Oelsener Höhe 14 Gesundheitspark Bad Gottleuba und Sattelberg 15 Poetengang 3 Oelsener Höhe 16 Panoramahöhe 4 Mordgrund und Bienhof 17 Hochstein und Karlsleite 5 Stockwiese 18 Seismologisches Observatorium 6 Strompelgrund und Bocksberg Berggießhübel 7 Rundteil 19 Schaubergwerk Marie-Louise-Stolln 8 Oelsengrund 20 Bergbauzeugnisse im Fuchsbachtal (Martinszeche) 9 Talsperre Gottleuba 21 Gottleubatal unterhalb Zwiesel 10 Bahretal, Eisengrund und Heidenholz 22 Zeisigstein 11 Hohler Stein 23 Tiské stěny / Tyssaer Wände 12 Raabsteine Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 609 Landschaft Ostflanke Landschaftlich außerordentlich abwechslungsreich ist die Ostflanke des des Erzge- Erzgebirges. Unter den Tiské stěny/Tyssaer Wänden und dem Zeisigstein birges verschluckt die Sächsisch-Böhmische Schweiz die Gneisscholle des Ost- Erzgebirges unter sich. Doch haben sich auch weiter westlich noch Reste Sandstein der Sandsteindecke erhalten, die am Ende der Kreidezeit einst ebenfalls über Gneis das Ost-Erzgebirge überlagert hatte (z. B. Raabstein, Wachstein, Fuß des Sattelberges). Im Nordosten findet das Erzgebirge an den vielfältigen Gesteinen des Elb- talschiefergebirges seinen Abschluss. Besonders der Turmalingranit, ein hartes, fast 500 Millionen Jahre altes Gestein, überragt mit einigen mar- kanten Erhebungen – Schärfling, Herbstberg, Helleberg, Tannenbusch – die Landschaft. Dieser Härtlingszug, der sich im Nordwesten mit der Quarz- porphyrkuppe des Roten Berges bei Borna fortsetzt, markiert als Ausläufer der Mittelsächsischen Störung die Grenze des Naturraumes Ost-Erzgebirge. Jenseits dominieren verschiedene Ton-Schiefer (Phyllite) sowie der Mar- Elbtal- kersbacher Granit. Als während der Entstehung des Elbtalschiefergebirges schiefer- dieses granitische Magma aufdrang, führten die damit einhergehenden gebirge enormen Hitze- und Druckbedingungen zur Umwandlung (Kontaktmeta- morphose) des umliegenden Gesteins. -

Anlage 2 Modellregionen Tabelle Gemeinden Mit
Anlage 2 zur Modellvereinbarung gemäß § 63 und 64 ff. SGB V zur Fernbehandlung (Stand: 16.02.2021) Gruppe Region Gemeindeziffer Gemeinde PLZ 116117-Ansagegebiet 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09111 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09112 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09113 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09114 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09116 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09117 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09119 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09120 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09122 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09123 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09125 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09126 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09127 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09128 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09130 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09131 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09224 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09228 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14511000 Chemnitz 09247 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14521410 Neukirchen/Erzgeb. 09221 Chemnitz 1 Chemnitz, Stadt 14521120 Burkhardtsdorf 09235 Chemnitz 2 Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 14628205 Klingenberg 01774 Freiberg_Freital 2 Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 14628050 Bannewitz 01728 Freital 2 Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 14628060 Dippoldiswalde 01744 Freital 2 Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 14628090 Dorfhain 01738 Freital 2 Sächsische Schweiz -

Villa Sonnenschein“
Bastei·Anzeiger Amtsblatt der Gemeinde Lohmen mit den Ortsteilen Daube, Doberzeit, Mühlsdorf und Uttewalde 23. Jahrgang Freitag, den 27. Juli 2012 Nummer 7 Verkaufspreis: 0,60 € Einweihung „Villa Sonnenschein“ Am 13.06.2012 fand in der Grundschule Lohmen - im Beisein des Bürgermeisters, Herrn Jörg Mildner - die Einweihung der „Villa Sonnenschein“ statt. Nun haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihren Unterricht auch im Freien durchzuführen und können sozusagen die Natur hautnah erleben. Anzeigen Zum Selbsttesten! Mähen und Mulchen ohne anzuhalten lokale Information - Zeit sparen - • keine Entsorgung des Grünschnittes • Unterbindung der Vermoosung h.de Ihr Amtsblatt - WEBER-MOTORGERÄTE hier steckt Ihre .wittic Zum Amselgrund 18 · 01848 Hohnstein / OT RATHEWALDE Heimat drin. www Tel. 03 59 75 / 8 07 30 · Fax 03 59 75 / 8 07 31 Wir beraten Sie gern. - 2 - Bastei·Anzeiger 7/2012 - 3 - Bastei·Anzeiger 7/2012 Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Montag: geschlossen Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr August 2012 Mittwoch: geschlossen 04./05.08.12 DS Lindemann, W.-Kaulisch-Str. 1, Donnerstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr Neustadt, Tel.: 0 35 96/50 27 96 Freitag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 11./12.08.12 DS Kowalow, Am Plumpenberg 1, Langburkersdorf Tel.: 0 35 96/60 46 71 18./19.08.12 Dr. Lehnung, Goethestr. 2, Neustadt Tel.: 0 35 96/50 22 20 25./26.08.12 DS Hölzel, A.-Bebel-Str. 30, Neustadt Tel.: 0 35 96/50 18 94 Notrufnummern · Bauhof Lohmen/Kläranlage/Abwasser 01 73/3 97 73 92 · Trinkwasserzweckverband „Bastei“ 01 71/3 83 72 60 Notdienst der Apotheken · Polizei 110 · Feuerwehr und Rettungsdienst 112 im Bereich Bischofswerda/Neukirch/Demitz-Thumitz/ · Rettungsleitstelle/Ärzte 0 35 01/4 91 80 Neustadt/Sebnitz/Stolpen/Dürrröhrsdorf-Dittersbach · Polizeidirektion Pirna 0 35 01/51 92 24 · Giftnotrufnummer 03 61/73 07 30 Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten sind die unten auf- · Tierärztliche Klinik 03 59 73/28 30 geführten Apotheken rund um die Uhr dienstbereit. -

Bad Schandau, Stadt Bahretal Dohma Dohna, Stadt Dürrröhrsdorf
Beherbergungseinrichtungen, Gästebetten und deren Auslastung sowie Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer nach Gemeinden Monatserhebung im Tourismus Beherbergungsstätten/ Gästebetten in Durchschn. Veränderung Veränderung Durchschn. Campingplätze Beherbergungsstätten Auslastung Ankünfte Reisegebiet gegenüber Übernachtungen gegenüber Aufenthalts- der ange- (einschl. Gemeinden des FS Sachsen ins- darunter ins- darunter dem Vorjahres- (einschl. Camping) dem Vorjahres- dauer in botenen Betten Camping) 5) gesamt1) geöffnet2) gesamt3) angeboten Zeitraum in % Zeitraum in % Tagen in % 4) Dezember 2019 Sächsische Schweiz 238 200 10 688 9 446 30,8 26 391 3,7 87 711 1,3 3,3 Bad Gottleuba- 12 10 1 160 979 59,4 1 147 -2,9 17 894 5,8 15,6 Bad Schandau, Stadt 44 37 2 408 2 229 40,8 6 934 3,0 26 615 0,1 3,8 Bahretal - - - - - - - - - - Dohma 2 2 . Dohna, Stadt 1 1 . Dürrröhrsdorf-Dittersbach 1 1 . Gohrisch 21 16 822 582 22,1 1 477 9,0 4 654 4,1 3,2 Heidenau, Stadt 4 4 199 199 60,2 1 763 24,2 3 492 18,0 2,0 Hohnstein, Stadt 19 15 710 636 17,9 1 276 33,6 3 137 36,4 2,5 Königstein/Sächs. Schw., 21 16 603 539 21,5 1 605 16,1 3 796 15,2 2,4 Liebstadt, Stadt 2 2 . Lohmen 4 4 262 256 38,8 1 387 5,4 3 076 -3,1 2,2 Müglitztal 1 1 . Neustadt i. Sa., Stadt 5 5 181 180 24,8 649 -15,5 1 386 -40,6 2,1 Pirna, Stadt 18 17 918 900 25,7 3 696 -4,4 7 075 -8,6 1,9 Rathen, Kurort 12 12 647 628 28,9 2 230 19,9 5 635 11,2 2,5 Rathmannsdorf 2 1 . -

Vermietungsexposé
07_0514 BB_FB 23.04.2007 10:33 Uhr Seite 2 bierwagen immobilien Vermietungsexposé Einkaufszentrum Scheunenhof, 01796 Pirna Bahnhofstraße/Robert-Koch-Straße/Hospitalstraße Eckdaten Objekt: Einkaufszentrum in Pirna, Große Kreisstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bundesland Freistaat Sachsen Einwohner: 38.735 (31. Dez. 2011) Einzugsgebiet: ca. 137.000 Einwohner Profil: innerstädtisches EKZ in Pirna/City mit derzeit ca. 11.870 m² Gesamtmietfläche auf 2 Ebenen sowie einer Tiefgarage mit 250 Stellplätzen Centerstruktur: Einzelhandel VK-Fläche ca. 8.000 m² Dienstleistung/Büro/Praxen ca. 650 m² Gastronomie/Café ca. 500 m² Magnetmieter: Edeka E center mit ca. 2.565 m² VK-Fläche Perspektive Eingang Center 07_0514 BB_FB 23.04.2007 10:33 Uhr Seite 2 bierwagen immobilien Standort: Pirna ist Große Kreisstadt und Verwaltungssitz des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und zählt etwa ca. 39.000 Einwohner. Als sächsisches Mittelzentrum ist die Stadt das „Tor zur Sächsischen Schweiz“ und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden an. Die Nachbargemeinden sind Bad Gottleuba-Berggießhübel (Stadt), Bahretal, Dohma, Dohna (Stadt), Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Heidenau (Stadt), Lohmen, Stadt Wehlen, Struppen. Das Einzugsgebiet dieser vorstehend genannten Gemeinden, unterteilt in Einzugsgebiet Zone 1 und 2, umfasst ca. 70.000 Einwohner. Pirna ist eine Stadt mit überregionaler Ausstrahlung dies bedingt durch die besondere historische Entwicklung mit einer beispielgebend sanierten Altstadt, die in stetig zunehmendem Maße Anziehungspunkt für Touristen geworden ist. Gewerbe- und Behördenstandorte bieten zugleich eine stabile Grundlage für diese lebendige Stadt, die Kultur und Bildung harmonisch einschließt. Über die neue Anschlussstelle der Bundesautobahn A 17 sowie diverse Bundesstraßen als auch über die Bahnstrecke ist Pirna sehr gut an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. -

Bad Gottleuba – Berggießhübel
Doppelkurort Bad Gottleuba – Berggießhübel Sehenswertes l Kur l Wellness l Wandern l Gastgeber Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Herzlich willkommen! 3 – 7 Aktiv erholen 32 – 44 Touristinformationen im Doppelkurort 3 Freibad Billy 32 Gästekarte Sächsische Schweiz 3 Tennisplatz Berggießhübel 33 Im Wandel der Jahreszeiten 4 – 7 Kegeln & Bowling • Tischtennis • Frauen-Fit 33 Fahrradbus und Radtouren 34 Ortsgeschichten 8 – 12 Karte Sächsische Schweiz und Böhmische Schweiz 36 – 37 Wanderkarten und „Wanderfreund“ 38 Moorheilbad Bad Gottleuba 8 Geführte Wanderungen und Wandererlebnisse 39 Kneippkurort Berggießhübel 9 Wandererlebnisse direkt vor der Haustür 40 Bahra, Zwiesel und Langenhennersdorf 10 Wandererlebnisse in Tschechien 41 Hellendorf, Markersbach und Oelsen 11 Wandererlebnisse Labyrinth Langenhennersdorf 42 Börnersdorf, Breitenau und Hennersbach 12 Terrainkurwege 43 Service und Veranstaltungen 14 – 20 Kur, Wellness und Entspannung 46 – 58 Statistische Daten • Kurbote • Publikationen 14 Bioenergetische Gesundheitsberatung 46 Veranstaltungskalender (Auswahl) 15 Dr. Medi-Fisch – ein besonderes Erlebnis 46 Service von A bis Z 16 – 17 Salzscheune Berggießhübel 47 Wohnmobil- und Zeltplätze 17 Saunieren • Wassertreten Parkplätze 17 im Kneippkurort Berggießhübel 48 Geschäfte und Dienstleistungen 18 – 19 Ihr Weg zur Kur 49 Restaurants und Cafés 20 Moorheilbad Bad Gottleuba 50 Kneippkurort Berggießhübel 51 Sehenswertes im Gottleubatal 22 – 30 MEDIAN Gesundheitspark Bad Gottleuba 52 Besucherbergwerk „Marie Louise Stolln“ 22 – 25 MEDIAN Klinik -

Kommunale Bauleitplanungen Im Kammerbezirk Dresden 2019 (Stadt- Und Landkreise)
Kommunale Bauleitplanungen im Kammerbezirk Dresden 2019 (Stadt- und Landkreise) Ausgabe Mai 2020 Abkürzungen: B-Plan Bebauungsplan DH Doppelhaus E Einzelvorhaben EFH, EH Einfamilien-, Einzelhaus FNP Flächennutzungsplan G gewerbliche Baufläche GE Gewerbegebiet, GEe eingeschränktes GE GI Industriegebiet M gemischte Baufläche MI Mischgebiet, MK Kerngebiet, MD Dorfgebiet, MU Urbanes Gebiet RH Reihenhaus ROV Raumordnungsverfahren SO Sondergebiet TÖB Träger öffentlicher Belange VG Verwaltungsgemeinschaft vB-Plan Vorhaben- und Erschließungsplan, vorhabenbezogener Bebauungsplan W Wohnbaufläche,WA Allgemeines Wohngebiet, WB Besonderes Wohngebiet, WR Reines Wohngebiet WS Kleinsiedlungsgebiet WKA Windkraftanlagen Hinweis: Unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sachsen/beteiligung/archiv stehen im Archivbereich des Beteiligungsportals Sachsen für eine Vielzahl der hier aufgeführten Planungsvorgänge die zugehörigen Unterlagen weiterhin zur Einsicht zur Verfügung. Herausgeber: Ansprechpartner: Industrie- und Handelskammer Dresden Regionalplanung: Kerstin Degenkolbe Langer Weg 4 n Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge IHK Dresden | Langer Weg 4 | 01239 Dresden 01239 Dresden Kommunale Bauleitplanungen: Tel.: 0351 2802-236 | Fax: 0351 2802-7236 n Dresden/Stadt E-Mail: [email protected] Bearbeitung: n Landkreis Meißen Geschäftsbereich Standortpolitik und Kommunikation n Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Referat Landes-, Regional- und Bauleitplanung Regionalplanung: Maximilian Meinert Tel.: 0351 2802-0 n Region Oberlausitz/Niederschlesien IHK Dresden | Langer Weg 4 | 01239 Dresden Fax: 0351 2802-280 Kommunale Bauleitplanungen: Tel.: 0351 2802-132 | Fax: 0351 2802-7132 [email protected] n Landkreis Bautzen E-Mail: [email protected] www.dresden.ihk.de n Landkreis Görlitz Stand: Mai 2020 1/17 Kommunale Bauleitplanungen – Zusammenfassung 2019 Dresden/Stadt Stadt/Gemeinde Art der Wesentliche Planungsziele, Termin für Vorhaben/Planung, baulichen Vorgesehene Nutzungen, TÖB- Planungsstand Nutzung Nutzungseignung Beteiligung gem. -

1. GEBIETSCHARAKTERISTIK Das FFH-Gebiet "Bahrebachtal" (SCI 5049-304)
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie · 01311 Dresden Bürgerbeauftragte Frau Karin Bernhardt Fon 0351-2612-9002 · Fax 0351-2612-1099 E-Mail [email protected] · http://www.smul.sachsen.de/lfulg Kurzfassung MaP 181 „Bahrebachtal“ 1. GEBIETSCHARAKTERISTIK Das FFH-Gebiet "Bahrebachtal" (SCI 5049-304) erstreckt sich über 10 Teilflächen vom Oberlauf des Bahrebaches südwestlich Hartmannsbach bei der Talsperre Gottleuba bis zur Ortslage Dohma südlich von Pirna. Mit einer gemeldeten Gesamtfläche von 360 ha handelt es sich um ein FFH-Gebiet von mittlerer Größe. Administrativ ist das Gebiet dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Regierungsbezirk Dresden zuzurech- nen. Anteil am SCI haben die Gemeinden Bahretal (Gemarkungen: Niederseidewitz, Friedrichswalde, Ottendorf, Borna, Gersdorf, Göppersdorf, Wingendorf), Bad Gottleuba- Berggießhübel (Gemarkungen: Ober- und Niederhartmannsdorf, Börnersdorf), Dohma (Gemarkung Dohma) und Liebstadt (Gemarkung Herbergen). Das SCI umfasst drei enge, strukturreiche Talabschnitte am naturnahen, unverbauten Bachlauf der Bahre im unteren Osterzgebirge. Im Norden zeichnet sich das Gebiet durch dicht bewaldete Hänge mit Felsbildungen aus. Im Süden weist die Landschaft einen halb- offenen Charakter mit einem Wechsel von Wald und Wiesen auf. Einbezogen in das Ge- biet sind naturnahe Waldbestände und Talbereiche von Nebenbächen wie Gersdorfer Bach, Bornaer Bach, Wingendorfer Bach, Ottendorfer Bach und Dohmaer Wasser. Die Bedeutung des Gebietes begründet sich insbesondere auf dem Vorkommen großflächi- ger, sehr wertvoller Biotopkomplexe in unzerschnittenen Talbereichen mit naturnahen Fließgewässern, Laubwaldbeständen, artenreichem Gründland und einer Vielzahl an ge- fährdeten Tier- und Pflanzenarten. Das SCI liegt im Bereich einer sich stetig vom Kamm des Erzgebirges zum Elbtal hin ab- dachenden Hochfläche, die von zahlreichen Tälern zerkerbt ist. Mit einer Höhe von 510 m ü.