Ernst Buchner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exposition 8 Novembre 2016 12 Février 2017 62, Rue Des
EXPOSITION 8 NOVEMBRE 2016 12 FÉVRIER 2017 62, RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS CHASSENATURE.ORG 3 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 4 ÉDITO 10 ENTRETIEN AVEC GEORG BASELITZ 14 PARCOURS DE L’EXPOSITION 16 BIOGRAPHIES CHOISIES 18 CATALOGUE CI-DESSUS COUVERTURE DE L’EXPOSITION Richard Friese En haut Combat de cerfs, 1906, Ferdinand von Rayski 19 PARTENAIRES huile sur toile, 100 x 170 cm Halte de chasse dans la forêt de DE L’EXPOSITION SOMMAIRE Letzlingen, Jagdschloss Wermsdorf, 1859, huile sur toile, Letzlingen, Stitftung Dome 114 x 163 cm, Paris, musée de la 20 AUTOUR und Schlösser Chasse et de la Nature DE L’EXPOSITION in Sachsen-Anhalt Georg Baselitz 22 VISUELS DISPONIBLES En bas POUR LA PRESSE De Wermsdorf à Ekely (Remix), 2006, huile sur toile, 24 LE MUSÉE DE LA CHASSE 300 x 250 cm, collection ET DE LA NATURE particulière 25 INFORMATIONS PRATIQUES 2 MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE SCÈNES DE CHASSE EN ALLEMAGNE. RAYSKI / BASELITZ 3 La nature n’est-elle pas la même de part et d’autre du Rhin ? Du moins, SCÈNES DE CHASSE à en juger d’après les représentations artistiques, l’image que Français EN ALLEMAGNE, et Allemands s’en font diffère nettement. Les forêts sont-elles plus mysté- RAYSKI / BASELITZ rieuses en Allemagne, les cerfs plus imposants et leur territoire plus EXPOSITION sauvage ? En tout cas, les pratiques de chasse et la place du chasseur dans 8 NOVEMBRE 2016 - ces sociétés ne sont pas les mêmes. 12 FÉVRIER 2017 À travers un panorama constitué d’œuvres emblématiques (de Kröner, Leibl, Fohr, Liebermann…) provenant de divers musées allemands et suisse, et cou- vrant la période 1830-1914, l’exposition met en évidence les spécificités ger- maniques dans la manière de représenter la chasse. -

Wiedergutmachung‹ Für Deutsche Museen? Die Beschlagnahmen ›Entarteter‹ Kunst in Den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 1937/38 Und Deren Entschädigung
Originalveröffentlichung in: Jahresbericht / Bayerische Staatsgemäldesammlungen 2016, S. 136-152 ›Wiedergutmachung‹ für deutsche Museen? Die Beschlagnahmen ›entarteter‹ Kunst in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 1937/38 und deren Entschädigung Johanna Poltermann »Keines dieser Bilder würde ich gekauft haben, auch wenn Kompensationen analysiert wird. Basis der vorliegenden sie noch so billig zu haben gewesen wären.«1 Mit diesen Untersuchung sind Akten in den Bayerischen Staatsgemälde- vernichtenden Worten charakterisierte der Frankfurter sammlungen, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, dem Städel-Direktor Alfred Wolters vier Gemälde des 19. Jahr- Bundesarchiv Berlin sowie dem Zentralarchiv der Staatlichen hunderts, die als Sendung des Reichsministeriums für Wis- Museen zu Berlin. Um die geleistete Entschädigung in Re- senschaft, Erziehung und Volksbildung im Frühjahr 1942 lation zu den Verlusten setzen zu können, wird zunächst ein den ›Ersatz‹ für die beschlagnahmten Werke ›entarteter‹ Blick auf die Geschichte der Münchner Sammlung sowie die Kunst darstellten. Die Überweisung älterer Kunstwerke kulturpolitischen Verhältnisse vor und nach 1937 geworfen. an von der Beschlagnahme betroffene Museen war kein Einzelfall.2 Insgesamt 11 Museen erhielten 1942 sowohl diese Form der materiellen Entschädigung3 als auch zu- Die nationalsozialistische Kunst- und sätzlich eine finanzielle Zuweisung.4 Ein kurzer Vergleich Kulturpolitik und ihr Einfluss auf die Bayerischen der Zahlen genügt, um das Missverhältnis von Beschlagnah- Staatsgemäldesammlungen -
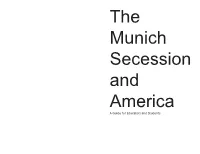
A Guide for Educators and Students TABLE of CONTENTS
The Munich Secession and America A Guide for Educators and Students TABLE OF CONTENTS FOR EDUCATORS GETTING STARTED 3 ABOUT THE FRYE 3 THE MUNICH SECESSION AND AMERICA 4 FOR STUDENTS WELCOME! 5 EXPERIENCING ART AT THE FRYE 5 A LITTLE CONTEXT 6 MAJOR THEMES 8 SELECTED WORKS AND IN-GALLERY DISCUSSION QUESTIONS The Prisoner 9 Picture Book 1 10 Dutch Courtyard 11 Calm before the Storm 12 The Dancer (Tänzerin) Baladine Klossowska 13 The Botanists 14 The Munich Secession and America January 24–April 12, 2009 SKETCH IT! 15 A Guide for Educators and Students BACK AT SCHOOL 15 The Munich Secession and America is organized by the Frye in GLOSSARY 16 collaboration with the Museum Villa Stuck, Munich, and is curated by Frye Foundation Scholar and Director Emerita of the Museum Villa Stuck, Jo-Anne Birnie Danzker. This self-guide was created by Deborah Sepulvida, the Frye’s manager of student and teacher programs, and teaching artist Chelsea Green. FOR EDUCATORS GETTING STARTED This guide includes a variety of materials designed to help educators and students prepare for their visit to the exhibition The Munich Secession and America, which is on view at the Frye Art Museum, January 24–April 12, 2009. Materials include resources and activities for use before, during, and after visits. The goal of this guide is to challenge students to think critically about what they see and to engage in the process of experiencing and discussing art. It is intended to facilitate students’ personal discoveries about art and is aimed at strengthening the skills that allow students to view art independently. -

Jahresbericht 2016 2016 Bayerische Jahresbericht Staatsgemäldesammlungen Bayerische Staatsgemäldesammlungen
BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNGEN JAHRESBERICHT 2016 2016 BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNGEN JAHRESBERICHT BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNGEN JAHRESBERICHT Inhalt 6 Perspektiven und Projekte: Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Jahre 2016 104 06 Fördervereine 105 Pinakotheks-Verein 20 01 Ausstellungen, Projekte, Ereignisse 106 PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne / Stiftung Pinakothek der Moderne 21 Ausstellungen 2016 107 International Patrons of the Pinakothek e. V. und American Patrons of the Pinakothek Trust 26 Die Schenkung der Art Mentor Foundation Lucerne an die Bayerische Staatsgemäldesammlung und die Staatliche Graphische Sammlung München 110 07 Stiftungen 38 Schenkung der Max Beckmann-Nachlässe an das Max Beckmann Archiv 111 Stiftung Ann und Jürgen Wilde 41 Sammlung Schack: Wiedereröffnung des zweiten Obergeschosses 112 Fritz-Winter-Stiftung 42 Wiedereröffnung der Staatsgalerie in der Residenz Würzburg 113 Max Beckmann Archiv und Max Beckmann Gesellschaft 45 König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande eröffnen ›Holländer-Saal‹ 114 Theo Wormland-Stiftung 46 ›Renaissance & Reformation‹ in Los Angeles. Eine internationale Ausstellungskooperation 115 Olaf Gulbransson Gesellschaft e. V. Tegernsee 48 Bestandskatalog der Florentiner Malerei 49 Das ›Museum Experts Exchange Program‹ (MEEP). Ein chinesisch-deutsches Kooperationsprojekt 2014–2016 118 08 Nachruf 50 Untersuchungen und Bestandsaufnahme von Werken aus der Staatsgalerie Neuburg an der Donau 119 Johann Georg Prinz von Hohenzollern 54 Leihverkehr 121 09 -

Aus Der Ehemaligen Sammlung Dr. Georg Schäfer, Schweinfurt Sonderauktion 29.10.2015
Cover SCHAEFER RZ 16.02.16 12:06 Seite 1 .. GEMALDE 18. – 20. JAHRHUNDERT AUS DER EHEMALIGEN SAMMLUNG DR. GEORG SCHÄFER, SCHWEINFURT SONDERAUKTION 29.10.2015 NEUMEISTER ALTE KUNST e ´ www.neumeister.com SONDERAUKTION 29.10.2015 .. GEMALDE DES 18.– 20. JAHR- HUNDERTS AUS DER EHEMALIGEN SAMMLUNG .. DR. GEORG SCHAFER, SCHWEINFURT Hinweise für unsere Kunden: Bitte beachten Sie den Künstlerindex ab Seite 187. Sämtliche Werke dieser Auktion wurden von einer externen Provenienzforscherin unter Beratung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (München) sowie dem Artloss Register (London) geprüft. Auf allen Gemälden finden sich rückseitig Inventarklebeetiketten der Sammlung Dr. Georg Schäfer, die in den Katalogtexten nicht gesondert erwähnt werden. Auktion 29.10.2015 Vorbesichtigung 23.– 28. Oktober 2015 Täglich von 14.00 bis 17.00 Uhr Montag Abendöffnung bis 20.00 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung Auktionsbeginn 18.00 Uhr Katalogbearbeitung Dr. Rainer Schuster Verfolgen Sie unsere Auktionen LIVE www.lot-tissimo.com VORWORT „Georg Schäfer war nicht ein Sammler, der sich fern seiner Umwelt entschied, vielmehr sind der Geschmack, die Vorlieben und die Auswahlprinzipien ... aus dieser seiner fränkischen Wirklichkeit heraus zu verstehen.“ Wulf Schadendorf über Dr. Georg Schäfer Liebe Freunde des Kunstauktionshauses NEUMEISTER, die Kunstsammlung, die Dr. Georg Schäfer (1896–1975) 1925 von seinem Vater Geheimrat Georg Schäfer (1861–1925) erbte, war damals bereits bedeutend: Gemälde u.a. von Joseph Wopfner, Hermann Kaulbach, Franz von Defregger, Johann Sperl und Franz von Lenbach, kurz, das Beste, was die Münchner Schule zwischen 1860 und 1900 zu bieten hatte, waren vom Gründer der „Ersten Automatischen Gußstahlkugelfabrik, vormals Friedrich Fischer“ in Schweinfurt zwischen 1900 und 1925 zusammengetragen worden. -

Seminararbeit Kunstgeschichte: Feierabend Von Max
Vorwort Bei der Ausarbeitung dieser Seminararbeit sah ich mich mit dem Problem konfrontiert, dass explizit zu dem Bild „Feierabend“ von Max Slevogt sehr wenig an begleitender Literatur zur Verfügung steht. Selbstverständlich habe ich die vorhandene Literatur bei der Erstellung dieser Arbeit verwendet, dennoch musste ich, besonders bei der Bildinterpretation, auf meine eigene Interpretationsvariante zurückgreifen. Ich bitte, diesen Sachverhalt bei der Korrektur der Seminararbeit zu berücksichtigen. 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................. S. 4 2. Hauptteil ............................................................................... S. 4 2.1. Biographie des Malers .............................................. S. 4 2.2. Bilddaten ................................................................... S. 6 2.2.1. Titel ....................................................... .......... S. 6 2.2.2. Befund ............................................................. S. 6 2.2.3. Provinienz ........................................………..... S. 6 2.2.4. Entstehung ...................................................... S. 6 2.3. Bildaufbau ................................................................. S. 7 2.3.1. Vordergrund ....................................................S. 7 2.3.1. Hintergrund ..................................................... S. 8 2.3.2. Raumabschluss ............................................... S. 8 2.4. Bildanalyse ............................................................... -

Orientation English
thE PiNAKOTHEk MUSEUMS iN THE kUNSTAREaL MÜNChEN oRiENtatioN Schelling- straße Bus 154 Bus 154 U H H Universität Arcisstraße H 7/28 2 ENGLiSh 6 m U a / 3 NEUE Tr Heßstraße PINAKOTHEK U e ß e MUSEUM REICH a U2 ß r a t e DER KRISTALLE Bus 100 r s t ß n s a e Theresienstraße g i U H H H i l w a sstr i Pinakotheken MUSEUM d m c u A BRANDHORST L Ar TÜRKENTOR e ALTE ß ra PINAKOTHEK PINAKOTHEK t DER MODERNE Gabelsbergerstraße r S re H a e B Bus 100 ß a 0 10 r ÄGYPTISCHES s LENBACH- st MUSEUM Karolinen- Bu en HAUS platz k H r ü GLYPTOTHEK T NS-DOKU- U U Königsplatz ZENTRUM Brienner Straße H KUNSTBAU STAATL. GRAPH. Odeonsplatz SAMMLUNG STAATLICHE ANTIKEN- SAMMLUNGEN 5 aLtE PiNakothEk Daily except MON 10am–6pm | TUE 10am–8pm www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek NEUE PiNakothEk Daily except TUE 10am–6pm | WED 10am–8pm www.pinakothek.de/en/neue-pinakothek PiNakothEk DER MoDERNE Daily except MON 10am–6pm | THURS 10am–8pm www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne MUSEUM BRaNDhoRSt Daily except MON 10am–6pm | THURS 10am–8pm www.museum-brandhorst.de/en Sammlung SChaCk WED–SUN 10am–6pm | Every 1st and 3rd WED in the month 10am–8pm www.pinakothek.de/en/sammlung-schack DEaR viSitoRS, NEUE PiNakothEk We hope you have an exciting visit and request that you please do not Barer Straße 29 touch the artworks. Please put umbrellas, large bags (bigger than A4) D 80799 Munich and backpacks in the lockers or check them into the cloakroom located T +49.(0)89.2 38 05-195 in the basement. -

Daxer & M Arschall 20 16
XXIII Daxer & Marschall 2016 Recent Acquisitions, Catalogue XXIII, 2016 Barer Strasse 44 | 80799 Munich | Germany Tel. +49 89 28 06 40 | Fax +49 89 28 17 57 | Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] | www.daxermarschall.com 2 Paintings, Oil Sketches and Sculptures, 1630-1928 My special thanks go to Simone Brenner and Diek Groenewald for their research and their work on the text. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Martina Baumgärtel, John Bergen, Brigitte Brandstetter, Regine Buxtorf, Thomas le Claire, Sue Cubitt, Francesca Dini, Marina Ducrey, Isabel Feder, Sabine Grabner Sibylle Gross, Mechthild Haas, Frode Haverkamp, Kilian Heck, Ursula Härting, Jean-François Heim, Gerhard Kehlenbeck, Michael Koch, Rudolf Koella. Miriam Krohne, Bjørn Li, Philip Mansmann, Marianne von Manstein, Dan Malan, Verena Marschall, Giuliano Matteucci, Hans Mühle, Werner Murrer, Anette Niethammer, Astrid Nielsen, Claudia Nordhoff. Otto Naumann, Susanne Neubauer, Marcel Perse, Max Pinnau, Mara Pricoco, Katrin Rieder, Herbert Rott, Hermann A. Schlögl, Arnika Schmidt, Annegret Schmidt-Philipps, Ines Schwarzer, Atelier Streck, Caspar Svenningsen, Jörg Trempler, Gert-Dieter Ulferts, Gregor J. M. Weber, Gregor Wedekind, Eric Zafran, Wolf Zech, Christiane Zeiller. Our latest catalogue Paintings, Oil Sketches and Unser diesjähriger Katalog Paintings, Oil Sketches and Sculptures erreicht Sculptures appears in good time for TEFAF, The sie pünktlich zur TEFAF, The European Fine Art Fair in Maastricht. European Fine Art Fair in Maastricht. Viele Werke kommen direkt aus privaten Sammlungen und waren seit Jahren, Many of the works being sold come directly from manchmal Jahrzehnten nicht mehr auf dem Markt. -

Kunst Des 19. Jahrhunderts 27. November 2019 27
Herbst 2019 Kunst des 19. JahrhundertsKunst des 19. Kunst des 19. Jahrhunderts 27. November 2019 Wilhelm Trübner. Detail. Los 177 Karl Wilhelm Diefenbach. Detail. Los 224 Kunst des 19. Jahrhunderts 27. November 2019, 15 Uhr 19th Century Art 27 November 2019, 3 p.m. 4 Experten Specialists Vorbesichtigung der Werke Sale Preview Ausgewählte Werke München Kunst des 19. Jahrhunderts: 28. bis 30. Oktober 2019 Ausgewählte Werke: 12. bis 14. November 2019 Grisebach Türkenstraße 104 80799 München Dortmund 29. bis 31. Oktober 2019 Dr. Anna Ahrens Frida-Marie Grigull Galerie Utermann +49 30 885 915 48 +49 30 885 915 84 Silberstraße 22 [email protected] [email protected] 44137 Dortmund Hamburg 4. und 5. November 2019 Galerie Commeter Bergstraße 11 20095 Hamburg Zürich 7. bis 9. November 2019 Grisebach Bahnhofstrasse 14 8001 Zürich Düsseldorf 15. bis 17. November 2019 Grisebach Bilker Straße 4–6 40213 Düsseldorf Sämtliche Werke Berlin 22. bis 26. November 2019 Grisebach Fasanenstraße 25, 27 und 73 10719 Berlin Freitag 10 bis 20 Uhr Zustandsberichte Samstag bis Montag 10 bis 18 Uhr Condition reports Dienstag 10 bis 15 Uhr [email protected] Grisebach — Herbst 2019 Mareike Hennig Ernst und Bernhard Fries – Zeichnungen aus Familienbesitz Zwischen den Brüdern Ernst und Bernhard Fries liegt nahezu eine Generation. Ernst wird zu Beginn des Jahrhunderts geboren, 1801, mitten in eine Umbruch- phase der Kunst. Bernhard kommt 1820 zur Welt. Da wandert sein 19-jähriger Bruder bereits zeichnend am Rhein und auf der Schwäbischen Alb. Als Bernhard ebenfalls Künstler wird, ändern sich die ästhetischen Vorstellungen bereits 100–120 Lose wieder. -

The Blue Rider
THE BLUE RIDER 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 1 222.04.132.04.13 111:091:09 2 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 2 222.04.132.04.13 111:091:09 HELMUT FRIEDEL ANNEGRET HOBERG THE BLUE RIDER IN THE LENBACHHAUS, MUNICH PRESTEL Munich London New York 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 3 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 4 222.04.132.04.13 111:091:09 CONTENTS Preface 7 Helmut Friedel 10 How the Blue Rider Came to the Lenbachhaus Annegret Hoberg 21 The Blue Rider – History and Ideas Plates 75 with commentaries by Annegret Hoberg WASSILY KANDINSKY (1–39) 76 FRANZ MARC (40 – 58) 156 GABRIELE MÜNTER (59–74) 196 AUGUST MACKE (75 – 88) 230 ROBERT DELAUNAY (89 – 90) 260 HEINRICH CAMPENDONK (91–92) 266 ALEXEI JAWLENSKY (93 –106) 272 MARIANNE VON WEREFKIN (107–109) 302 ALBERT BLOCH (110) 310 VLADIMIR BURLIUK (111) 314 ADRIAAN KORTEWEG (112 –113) 318 ALFRED KUBIN (114 –118) 324 PAUL KLEE (119 –132) 336 Bibliography 368 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 5 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 6 222.04.132.04.13 111:091:09 PREFACE 7 The Blue Rider (Der Blaue Reiter), the artists’ group formed by such important fi gures as Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, August Macke, Alexei Jawlensky, and Paul Klee, had a momentous and far-reaching impact on the art of the twentieth century not only in the art city Munich, but internationally as well. Their very particular kind of intensely colorful, expressive paint- ing, using a dense formal idiom that was moving toward abstraction, was based on a unique spiritual approach that opened up completely new possibilities for expression, ranging in style from a height- ened realism to abstraction. -

Division, Records of the Cultural Affairs Branch, 1946–1949 108 10.1.5.7
RECONSTRUCTING THE RECORD OF NAZI CULTURAL PLUNDER A GUIDE TO THE DISPERSED ARCHIVES OF THE EINSATZSTAB REICHSLEITER ROSENBERG (ERR) AND THE POSTWARD RETRIEVAL OF ERR LOOT Patricia Kennedy Grimsted Revised and Updated Edition Chapter 10: United States of America (March 2015) Published on-line with generous support of the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), in association with the International Institute of Social History (IISH/IISG), Amsterdam, and the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, Amsterdam, at http://www.errproject.org © Copyright 2015, Patricia Kennedy Grimsted The original volume was initially published as: Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder: A Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), IISH Research Paper 47, by the International Institute of Social History (IISH), in association with the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam, and with generous support of the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), Amsterdam, March 2011 © Patricia Kennedy Grimsted The entire original volume and individual sections are available in a PDF file for free download at: http://socialhistory.org/en/publications/reconstructing-record-nazi-cultural- plunder. Also now available is the updated Introduction: “Alfred Rosenberg and the ERR: The Records of Plunder and the Fate of Its Loot” (last revsied May 2015). Other updated country chapters and a new Israeli chapter will be posted as completed at: http://www.errproject.org. The Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), the special operational task force headed by Adolf Hitler’s leading ideologue Alfred Rosenberg, was the major NSDAP agency engaged in looting cultural valuables in Nazi-occupied countries during the Second World War. -

Ferdinand Möller Und Seine Galerie Ein Kunsthändler in Zeiten Historischer Umbrüche
Ferdinand Möller und seine Galerie Ein Kunsthändler in Zeiten historischer Umbrüche Dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie des Fachbereichs Kulturgeschichte und Kulturkunde der Universität Hamburg vorgelegt von Katrin Engelhardt aus Berlin Hamburg, 2013 1. Gutachter: Prof. Dr. Uwe Fleckner 2. Gutachterin: Prof. Dr. Julia Gelshorn Datum der Disputation: 4. April 2012 Tag des Vollzugs der Promotion: 16. April 2012 Inhalt Vorwort und Dank Einleitung 2 Ein Galeriebetrieb und sein Nachlass als Gegenstand 3 der Untersuchung Zum bisherigen Forschungsstand 7 Beginn einer Leidenschaft: vom Buchhändler zum 12 Galeristen in der Weimarer Republik Geschäftsführer der Galerie Ernst Arnold und 17 Selbständigkeit mit der eigenen Galerie in Breslau Möllers Einstieg in die Berliner Kunstszene 27 Ungewöhnliche Ausstellungen in Potsdam und 41 New York Rückzug nach Potsdam 48 Auf dem Weg zum Erfolg, die Galerie am Schöneberger 52 Ufer in Berlin Ausstellungen in neuen Galerieräumen 55 Gastauftritte: Die Blaue Vier 1929 und 61 Vision und Formgesetz 1930 Publikationen: Die Blätter der Galerie Ferdinand 69 Möller, erschienen im hauseigenen Verlag Handel nach der Inflation und zu Beginn der 71 Weltwirtschaftskrise Der beginnende Nationalsozialismus und die Wandlung der 77 Galerie Der politische Umschwung im Künstler- und 81 Ausstellungsprogramm der Galerie Eine Künstlergruppe: Der Norden und die Zeitschrift 91 Kunst der Nation von 1933 bis 1935 Käufer und Verkäufer: Handel mit Sammlern und 98 Museen Drei Ausstellungen vor dem „offiziellen“