OÖ. Heimatblätter; 2007 Heft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Linz Simonystraße Bussteig 1 Gültig Ab: 21.04.2019 2 0 17.22 S 400 Steyr City Point 0 18.33
Départ/Departure Aktuelle Abfahrt Abfahrten Linz Simonystraße Bussteig 1 gültig ab: 21.04.2019 2 0 17.22 S 400 Steyr City Point 0 18.33 . Montag - Freitag 17.23 410 Sierning Busterminal 0 18.09 14.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 0 17.41 410 Niederneukirchen Ortsmitte 0 18.06 14.03 409 Asten Ortsmitte 2 14.15 . 0 18.21 14.23 05.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 17.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) ¶' Enns Dr.-Renner-Straße 17.52 401 Steyr City Point 0 19.07 Mauthausen Bahnhof (Vorplatz) 14.34 0 06.15 05.06 400 Steyr City Point 0 0 2 . 14.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) 15.21 . 18.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 0 16.00 06.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an 14.52 401 Steyr City Point 18.07 611 Haid Busterminal (Hauptplatz) 0 18.43 0 06.03 409 Asten Ortsmitte 2 06.15 . 18.11 410 Sierning Busterminal 0 19.00 15.00 Linie Verlauf/Endhaltestelle an ¶' Enns Dr.-Renner-Straße 06.23 18.22 S 400 Enns Hauptplatz (Stadtturm) 0 18.49 15.42 S 410 Sierning Busterminal 0 16.23 Mauthausen Bahnhof (Vorplatz) 06.34 18.41 411 Hofkirchen i.Tkr. Ortsmitte 0 19.17 15.42 F 410 Sierning Busterminal 0 16.23 06.12 412 Hofkirchen i.Tkr. Ortsmitte 0 06.35 18.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) 0 19.21 õ 06.12 S 401 Steyr City Point 0 07.21 18.52 401 Steyr City Point 0 20.05 15.46 611 Traun Hauptplatz (Neubauer Straße) 0 16.21 06.12 F 401 Steyr City Point 0 07.25 0 0 0 07.30 . -

Neukonzeption Wirtschaftförderung Und Stadtmarketing Heilbronn
CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Linz Land Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 09. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Ansfelden Neuhofen an der Krems Asten Pasching Enns St. Florian Hörsching Traun Leonding 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 1.150 830 Interviews in im Bezirk Linz Land Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 660 im Bezirk Linz Land City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte -
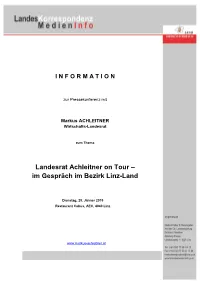
I N F O R M a T I O N
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Markus ACHLEITNER Wirtschafts-Landesrat zum Thema Landesrat Achleitner on Tour – im Gespräch im Bezirk Linz-Land Dienstag, 29. Jänner 2019 Restaurant Cubus, AEC, 4040 Linz www.markus-achleitner.at LR Achleitner 2 Auf Tour durch alle Bezirke Oberösterreichs Vergangene Woche startete Wirtschafts-Landesrat seine Tour durch alle oberösterreichischen Bezirke und verbrachte jeweils einen Tag in den Bezirken Kirchdorf und Ried im Innkreis. „Nach den ersten Wochen in meiner neuer Funktion ist es mir wichtig, in die Regionen zu kommen, mir selbst ein Bild zu machen und aus erster Hand im Gespräch mit den Menschen zu erfahren, was die Anliegen und Wünsche an das Zukunftsressort sind“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Im Mittelpunkt der Bezirkstage steht dabei naturgemäß der Kontakt mit den Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk. Deshalb startete der heutige Tag mit einem Business-Frühstück mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft im Bezirk Linz-Land. Darüber hinaus am Programm stehen Besuche mit Firmenbesichtigungen in den Unternehmen TRUMPF Maschinen Austria in Pasching und bei Rosenbauer International AG in Leonding. Im Rahmen des Besuchs bei Rosenbauer International AG wird auch ein Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertreter der Industrie im Bezirk stattfinden. Bis April wird Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner alle Bezirke besuchen. „Politik findet nicht hinter dem Schreibtisch statt, sondern im Gespräch mit den Menschen und dafür werde ich mir in den nächsten Monaten noch ausgiebiger als sonst Zeit nehmen“, betont Wirtschafts- Landesrat Achleitner. Pressekonferenz am 29. Jänner 2019 LR Achleitner 3 Aktuelle wirtschaftliche Situation und aktuelle Projekte im Bezirk Linz-Land Arbeitsmarkt Die Situation des Arbeitsmarktes in Oberösterreich zeigt sich aktuell grundsätzlich sehr erfreulich. -

Bezirklinz/Linzland
DDiiee LLaannddwwiirrttsscchhaafftt sseettzztt eeiinn ZZeeiicchheenn BBeezziirrkk LLiinnzz // LLiinnzz LLaanndd Kontakt: Landwirtschaftskammer OÖ Referat Lebensmittel und Erwerbskombinationen Ing. Dipl.-Päd. Ritzberger Maria Auf der Gugl 3, 4021 Linz T +43 50 6902-1260, [email protected] Stand Juni 2021 Fotonachweis: Agrar.Projekt.Verein/Stinglmayr (Titelfoto), Agrar.Projekt.Verein/Cityfoto (18, 26, 27, 34), Agrar.Projekt.Verein/Lechner (16, 29, 38), Velechovsky/p-format/priglinger (35), LK OÖ, Fotos wurden von den Betrieben für die Betriebsvorstellungen zur Verfügung gestellt. Seite 2 Die Landwirtschaft setzt ein Zeichen mit „Gutes vom Bauernhof“ Der Kauf heimischer Lebensmittel steht nicht nur für Frische, kurze Transportwege und Saisonalität der Produkte, sondern sichert auch den Arbeitsplatz Bauernhof. Gerade in der heutigen Zeit, wo Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Produkte immer wichtiger werden, sollte der Einkauf in der Nähe beim Bauern eine besondere Rolle spielen. Dies hilft nicht nur dem einzelnen Bauern selbst, sondern erhält eine lebendige, vielfältige und gesunde Region. Beim Erwerb eines bäuerlichen Produktes können Sie auch Details über Produktion, Herstellung sowie Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten eines Produktes direkt vom Produzenten erfahren. Um bäuerliche Familienbetriebe bei ihrer Arbeit in der Direktvermarktung zu unterstützen, wurde österreichweit ein Programm zur Qualitätssicherung erarbeitet, welches sich durch die Marke „Gutes vom Bauernhof“ präsentiert. In Oberösterreich gibt es derzeit 368 Betriebe, die mit dieser Marke ausgezeichnet sind. Durch den einheitlichen Werbeauftritt bei Hof- und Markttafeln, Foldern und dgl. sind diese Betriebe leicht für den Konsumenten erkennbar. Betriebe, die mit diesem Zeichen ausgezeichnet sind, garantieren für ..... fachgerechte und sorgfältige Verarbeitung ihrer Produkte . Sicherstellung der Herkunft . Qualität der Produkte, durch Einhaltung der österreichischen Gütesiegelrichtlinien . -

Eindruck Classic Almkönig
Wi esenh o Sc e hie Neudorf 720 ß feg Haslhof tra g 600 er S ettl Imbiss Zw G Buchholz e w er 742 S be p c a e r g h ß Sc e a h i i w r c k n e t e r e s s g s f t t e r s a i e p l w ß l e e u h g a M ü H 707 m g z l e gg t fe u ie S h a c Koth r S - e Wiesen t s w n i e F g e Lindenweg Stamering e w w r n e e d d e n i ß n L a tzstr e g pla k Obergen Sport Freizeitanlage c u e l t Rammersdorf r t i e M b O Davidschlag Bergweg Ring Buchholz straße Ring 574 straße 0 Eic 14 F henwe öhre nweg u a r e e t aß 627 s tr n i S O F Ei r de g f B e b n e 673 r f ern l d w o r do tt e or n d do rfst f e n r e er l rn Ber aße r St h e w g ra ü B B e ß e e Z e K w M r n apellen nd Eidendorf Hofing o g r f s S tr c aß e h Blü a ten u g g e e S Sch e w mi w c ed r n h we k lo g w Z c e s a ö s ss a o tr e g Ge un B aße ühl e en ng 825m l e R rm lw Bücherei e r Lede d Badebiotop b r d b a R Untergeng e o gr r R z i ( 571m) g ul n 566 S g R Hofing L e o ed l Volksschule d ermüh l w n g e erge g 650 nt Neußerling U (594m) E c k s t S e i c f n or 14 e h d rw l n 0 o Stötten r e e g s B s Stötten Oberg s 590 eng t r a ß S583 e ul zgraben g n we e en erberg it m Geng e lu sl B Fe l ls e le F it en pNeußerlingp pOberneukirchenp pZwettl/Rodlp Güt St. -

Physiotherapeutinnen Ohne Vertrag 2021
HINWEIS: Diese Listen finden Sie auch auf unserer Homepage www.oegk.at (Vertragspartner-Service-Therapeutensuche) PhysiotherapeutInnen ohne Vertrag 2021 Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass Wahltherapeuten nicht verpflichtet sind uns Änderungen mitzuteilen und die Daten daher nicht immer den letzten Stand entsprechen. BRAUNAU Name Straße Ort TelefonNr. 2. TelefonNr. E-Mail Zusatzausbildungen HB weitere Informationen AUER Harald Braunauerstr. 17 4962 Mining 0664/73069927 [email protected] HB AUGUSTIN Barbara Hofstätterstr. 7 5274 Burgkirchen 0699/11876315 [email protected] MLD HB BARTH Christian Weilhartstraße 40 5121 Ostermiething 06278/7117 0179/1204601 [email protected] MLD BARTOSCH-DICK Ursula Auerbach 18 5222 Auerbach 07747/20030 Erwachsenenbobath HB BAUCHINGER Jürgen Salzburgerstr. 120 5280 Braunau 0676/4622327 [email protected] MLD nein BAUER Christian Leithen 12 4933 Wildenau 0680/3256602 [email protected] HB BEINHUNDNER Silvia Pischelsdorf 56 5233 Pischelsdorf 07742/7075 0650/6680212 [email protected] HB BREITENBERGER Christina Davidstraße 17 5145 Neukirchen 0650/9208214 [email protected] Erwachsenenbobath HB BURGSTALLER Christoph Straussweg 7 5211 Friedburg 0660/3160350 [email protected] HB CHRISTL Birgit Dr. Finsterer Weg 6/2 5252 Aspach 0664/9509960 [email protected] Erwachsenenbobath HB siehe auch Ried/I. DAXER Johannes Rieder Hauptstrasse 42 5212 Schneegattern 0677/63156023 [email protected] MLD, Bindegewebsmass. HB DEMM Tanja Mitterweg 1 5230 Mattighofen 0664/2119110 [email protected] Kinderbobath HB siehe auch Linz Stadt und in Neudorf 22 5231 Schalchen DENK Wiebke Mittererb 5 5211 Friedburg 07746/2795 MLD DENK Gertraud Aham 2 4963 St. Peter/Hart 07722/62666 DENK Daniela Kerschham 26 5221 Lochen 0680/2353433 [email protected] MLD HB siehe auch Ried/I. -

Raiffeisen Tarockcup Austria 2019/2020 St
raiffeisen tarockcup austria 2019/2020 http://www.tarockcup.at St. Peter / Wbg. (St. Johann / Wbg.), [email protected] Platz Nr Name Startort R1 R2 R3 Max Total Cup 1 5105 Kurbel Petra Kollerschlag 49 67 73 73 189 223 2 5708 Bohaumilitzky Christa Haslach a.d.M. 15 52 77 77 144 198 3 5461 Bruckner Otto Mag. Linz 57 41 45 57 143 180 4 696 Gartner Friedrich Kirchschlag b.L. 135 -8 15 135 142 168 5 2057 Beneder Sepp Bad Leonfelden -23 -25 184 184 136 156 6 5121 Kaiser Martin Eidenberg 43 56 23 56 122 147 7 4531 Maderthaner Bernd Dr. Weyer 59 16 45 59 120 138 8 2017 Kollik Heinrich Julbach 17 83 18 83 118 131 9 942 Lorenz Ernst Reichenau i.M. 20 48 45 48 113 124 10 2281 Wagner Elfriede Au / Donau 87 -3 22 87 106 117 11 1274 Wartner Herbert Aigen-Schlägl 118 20 -35 118 103 110 12 2121 Manzenreiter Hermann Bad Leonfelden 58 0 36 58 94 105 13 393 Raninger Rudolf Julbach 24 18 51 51 93 100 14 5594 Mittermayr Johann Kleinzell 33 34 26 34 93 95 15 1134 Kling Rudolf Perg 33 39 20 39 92 90 16 100 Gabriel Martin Puchenau 60 19 11 60 90 85 17 75 Enne Richard Gramastetten 31 22 37 37 90 80 18 5502 Spindelböck Irmgard Oepping 50 -30 52 52 72 76 19 430 Schinkinger Hubert Lembach i.M. 10 -22 83 83 71 72 20 5556 Luckeneder Alfred Walding 4 31 32 32 67 68 21 197 Huemer Manfred Bad Leonfelden -25 41 49 49 65 64 22 326 Neumüller Martha St. -

Steel-Town-Man Linz - Olympische Distanz 2012 Ergebnisliste Olympische Distanz - 1,5K / 40K / 10K - Nach Zeit Sortiert 2012-07-07 Seite 1
Steel-Town-Man Linz - Olympische Distanz 2012 Ergebnisliste Olympische Distanz - 1,5k / 40k / 10k - nach Zeit sortiert 2012-07-07 Seite 1 Rang Stnr Name Jg. Nat. Verein/Ort Klasse KRg. Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg. Strafe Gesamt 1 1 Birngruber Christian, Mag. 83 AUT RLC Elmer Reichör M-ELITE1 1 0:20:38/4. 00:34 0:57:48/2. 00:33 0:36:10/2. 1:55:44 2 2 Buxhofer Matthias 73 AUT Tri Dornbirn ÖPolSV M-ELITE2 1 0:24:48/15. 00:38 0:56:11/1. 00:32 0:36:30/3. 1:58:40 3 5 Molnar Gergö 86 HUN LTU Linz M-ELITE1 2 0:20:24/1. 00:37 1:04:17/24. 00:41 0:37:17/6. 2:03:18 4 6 Keller Bernhard 69 AUT RATS AMstetten M-MAS40 1 0:24:12/12. 00:37 1:03:15/11. 00:31 0:36:39/4. 2:05:16 5 8 Froschauer Christian 67 AUT Team Zisser Enns M-MAS45 1 0:22:41/6. 00:38 1:03:18/12. 00:34 0:39:05/12. 2:06:17 6 171 Schöpf Christoph 87 AUT LTU Linz M-ELITE1 3 0:22:50/8. 00:40 1:02:15/6. 00:39 0:40:00/17. 2:06:26 7 166 Auer Christian 77 AUT TriPowerWimbergerHausFreistadt M-ELITE2 2 0:25:06/19. 00:40 1:04:25/26. 00:35 0:35:44/1. 2:06:32 8 4 Prem Andreas 91 AUT LTU Linz M-U23 1 0:20:28/2. -

Austrian Foreign Po
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master- UMI films the text diredy from the otigiil or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in face, Mile others may be from any type of cornputer printer. The quaiii of this risproduction b d.p.nd.nt upon übe quality of the copy submitbd. Broken or indistinct priprint,cdored or poor quafity illustratîoris and photographs, print bkdhwgh, subtmhW marpins, and improper alîîment can adversely affect reproductiori. In the unlikely event that the author di not serid UMI a complete manuscript and thete are missiq pages, Phese will be mted. Also, if unauthorized copyftght material had to be rernoved, a note will indîate the deCetion. Oversue materials (e-g-, maps, drawings, charts) are repnoducea by sectiming the original, beginning at the uppr lefthand corner and coritinuing from ieft to nght in equal secüms with small overlaps. Photographs induded in the Miginal manuscript have beeri reproduoed xerographically in this copy. Higher quality 6' x W bkck and nihite pbbgraghic prints are available for any phatographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI di- to order. Bell & Hawell Infannation and Leaming 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, MI 481CB1346 USA Anschiuss 1938: Aushia's Potential for Military Resistance Jdmice Feata Depazwt of Hia tory McGill University, Hontteal A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Reaearch in partial fulfillment of the requitememta of the degrec of Master of Arts National Library Biblioth&que nationale du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 3!3S Wellington Street 395. -

Bezirkaktuelles AUS LINZ LAND
unserBezirk AKTUELLES AUS LINZ LAND ANSFELDEN BO Josefine Richter informiert! Wanderung am 29.1. in Ohlsdorf 18 Personen wanderten an der kristallklaren Traun über die EGGENDORF I. TRKR. Fußgängerbrücke nach Laakirchen. Über Wald und Flur ging es zurück zum Bauernhof von Thomas Bernhard. Abschlie- Seniorenfasching ßende Einkehr zum Mittagessen war beim Kirchenwirt in Am 5.2.2019 fand wieder unser traditioneller Seniorenfa- Ohlsdorf. sching im Gasthaus Silos statt. Nach dem Genuss von Fa- schingskrapfen und Kaffee wurde zur Livemusik von Fritz und Günther fleißig das Tanzbein geschwungen. Ein Schweizer Sketch, gespielt von Brigitte und Werner Aigner in Schwy- zerdütsch, sorgte für gute Unterhaltung. Auch Witze wurden am laufenden Band erzählt. Es war für alle ein gemütlicher Nachmittag, bei dem der Humor nicht zu kurz kam. Wanderung Schwaigau 27.03.2019, 09:00 Abfahrt um 9:00 zur Christl. Dauer ca. 2 – 3 Stunden. Anmel- dungen 0660 1180299. Handyschulung 20.03.2019, 15:00, Pfarrhof Ansfelden Handyschulung 20. + 21.3., 15:00. Anmeldungen bei Bernhard Thalhammer 0676/4276582. HAID Stammtisch 03.04.2019, 15:00, Pfarrhof Ansfelden Jahreshauptversammlung Stammtisch mit Eierpecken 18.04.2019, Haid Wir laden alle Mitglieder ab 14:00 in die Tagesheimstätte WIR GRATULIEREN HERZLICH: in Haid ein. Erwin Fuhrich (70), Gerhard Loidolt (75), Margaretha Steubel- müller (75), Erna Köck (80), Erwin Messner (80), Josef Greul WIR GRATULIEREN HERZLICH: (92) Angelika Steinhauser (60), Anna Nägl (96) ORTSBERICHTE AUS ALLEN BEZIRKEN AUF WWW.OOE-SENIORENBUND.AT MÄRZ 2019 I 01 Dass dann das wohlverdiente Bratl in der Rein auch zum HARGELSBERG Genuss geworden ist, war eine weitere Draufgabe dieses besonderen Tages. -

Jagdausübungsberechtig
Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung, Jagdbehörde Tel: 0732/731301-0, Fax: 0732/731301-272399, E-Mail: [email protected] Peuerbachstr. 26, 4041 Linz-Urfahr Stand: April 2017 BJM.: Franz Burner, Zinngießing 7, 4209 Engerwitzdorf, Tel./Fax: 07235-50673, Mobil: Tel. 0664-2455740, [email protected] BJM.-Stv.: Dipl.-Ing. Josef Rathgeb, Quellenweg 1, 4181 Oberneukirchen, Tel. 0664-8298366, [email protected] JAGDAUSÜBUNGSBERECHTIGTE des Bezirkes Urfahr-Umgebung Genossenschaftsjagden Jagdleiter der Jagdgesellschaft Telefon E-Mail 1 Alberndorf/R. Grubauer Franz 0664-8404554 [email protected] 4211 Alberndorf, Kapellenweg 4 2 Altenberg/L. Stiftinger Karl 07230-7484 [email protected] 4203 Altenberg, Pargfried 1 3 Bad Leonfelden I Gabauer Anton 07213-8845 [email protected] 4190 Bad Leonfelden, Oberlaimbach 35 0664-73007334 4 Bad Leonfelden II Huemer Johannes 0650-446 52 55 [email protected] 4190 Bad Leonfelden, Unterstiftung 1 5 Eidenberg Pargfrieder Leopold, ÖR. 07239-80 20 [email protected] 4201 Eidenberg, Aschlberg 48 0664-8584677 6 Engerwitzdorf Wall Hubert [email protected] 4209 Engerwitzdorf, Oberthal 2 07235-88147 7 Feldkirchen/D. Plöderl Franz, 17.01.1960 0676-9203660 [email protected] 4101 Feldkirchen, Am Pesenbach 8 8 Gallneukirchen Einzelpächter: [email protected] Affenzeller Friedrich, geb. 17.4.1953 0664-9554055 4210 Gallneukirchen, Waldweg 27 9 Goldwörth Venzl Ernst 07234-83751 [email protected] 4102 Goldwörth, Goldwörtherstr. 4 0699-12015083 10 Gramastetten I Durstberger Karl 07239-8148 [email protected] 4201 Gramastetten, Hamberg 3 0664-8922987 2 11 Gramastetten II Eckerstorfer Reinhard 0664-7642719 [email protected] 4201 Gramastetten, Lassersdorf 6 12 Haibach i.M. -

Informationsblatt
Informationsblatt Regionales Raumordnungsprogramm (RegROP) für die Region Linz-Umland 3 Oö. LGBl. Nr. 98/2018 . Oö Quelle: AbteilungQuelle: Raumordnung,Land Mit diesem Raumordnungsprogramm werden regional bedeutsame Freiräume in der Region Linz-Umland durch ein Verbot der Genehmigung neuer Baulandwidmungen vor einer weitergehenden Bebauung geschützt. IMPRESSUM | Medieninhaber und Herausgeber Amt der Oö. Landesregierung Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung Abteilung Raumordnung, Überörtliche Raumordnung (Fotos und Inhalt) Bahnhofplatz 1, 4021 Linz Telefon: +43 732 7720 148 21 www.land-oberoesterreich.gv.at | [email protected] DVR: 0069264 Seite 1 Stand: April 2021 Regionales Raumordnungsprogramm für die Region Linz-Umland 3 Planungsregion: Die Planungsregion Linz-Umland umfasst ein Gebiet von 50.736 ha und In der Planungsregion besteht aus folgenden 17 Städten und Gemeinden: Landeshauptstadt "Linz-Umland" leben Linz; Asten, Ansfelden, Enns, Leonding, Pasching, St. Florian, Traun und über 350.000 Menschen. Wilhering (alle Bezirk Linz-Land); Altenberg, Engerwitzdorf, (Stand: 2018) Gramastetten, Hellmonsödt, Kirchschlag, Lichtenberg, Puchenau, Steyregg (alle Bezirk Urfahr-Umgebung). Zielsetzungen des Raumordnungsprogramms: Mit diesem regionalen Raumordnungsprogramm wird sichergestellt, dass die regional bedeutsamen Freiräumen folgende vielfältigen Funktionen langfristig erfüllen können: . Existenz- und leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft . Erholung und Tourismus . Siedlungshygiene und klimatische Ausgleichsfunktion