Zur Flußgeschichte Und Morphologie Des Rednitzgebiets
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
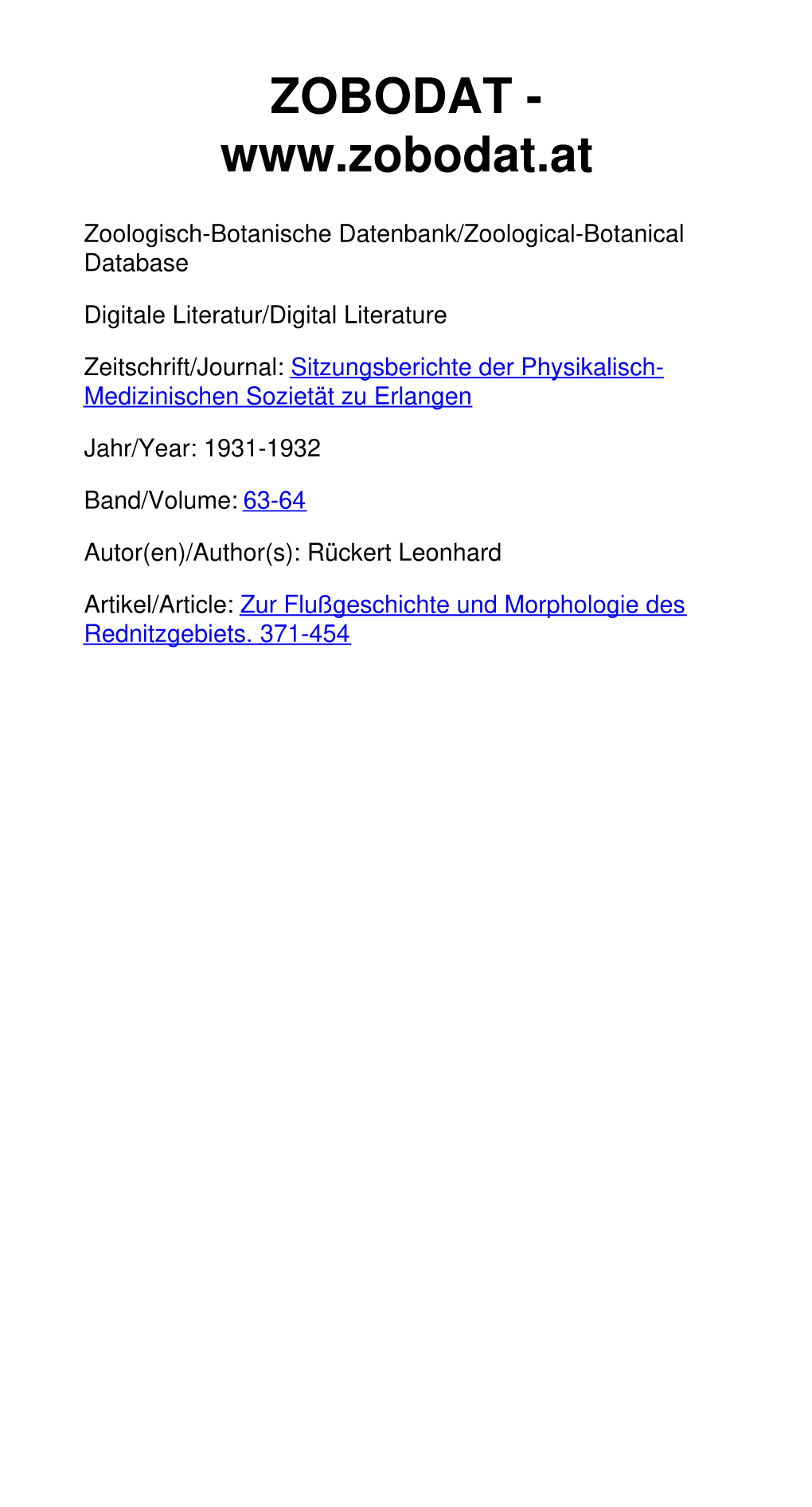
Load more
Recommended publications
-

Gewässerverzeichnis Bayern Aalbach(Fluss) Abens(Fluss) Abtsdorfer See(See) Aindlinger Baggersee(See) Aisch(Fluss) Aiterach(Flu
Gewässerverzeichnis Bayern Aalbach(Fluss) Abens(Fluss) Abtsdorfer See(See) Aindlinger Aisch(Fluss) Aiterach(Fluss) Baggersee(See) Aitrach(Fluss) Albertsbach(Fluss) Alatsee(See) Alpbach(Fluss) Altbach(Fluss) Alpsee(See) Altmühl(Fluss) Alz(Fluss) Altmühlsee(See) Amper(Fluss) Ammersee(See) Ampersee(See) Anlauter(Fluss) Arbach(Fluss) Arbachgraben(Fluss) Auer Mühlbach(Fluss) Autobahnsee (Augsburg) Auensee (Kissing) (See) (See) Auwaldsee (Ingolstadt) Auweiher(See) Bachtelsee(See) (See) Baggersee (Ingolstadt) Badenburger See(See) Badersee(See) (See) Banzerbach(Fluss) Bärensee (Wertach) Bannwaldsee(See) (See) Beckenweiher Barmsee(See) Beinrieder Weiher(See) (Wiesenfelden) (See) Berchtesgadener Ache Biber(Fluss) (Königsseeache) (Fluss) Bibisee(See) Bichelweiher(See) Bichlersee(See) Bichlersee(See) Biengartner Bina(Fluss) Birkensee (Dachau) Weiherplatte(See) (See) Bischofswieser Birkensee (Dingolfing) Birkensee (Nürnberg) Ache(Fluss) (See) (See) Blaibacher See(See) Blaue Lache(See) Bodensee(See) Bogen-Bach(Fluss) Braunau(Fluss) Böhmerweiher(See) Bregenzer Ach(Fluss) Breitach(Fluss) Breitenbach(Fluss) Brombach(Fluss) Bruckbach(Fluss) Brombachsee(See) Brückelsee Brückelsee(See) Brückenhaussee(See) (Schwandorf) (See) Brünnleinsgraben(Fluss) Butzenweiher(See) Buxach(Fluss) Chamb(Fluss) Chiemsee(See) Chiemseezuflüsse(Fluss) Dechsendorfer Christlessee(See) Craimoosweiher(See) Weiher(See) Degersee(See) Deininger Weiher(See) Deixlfurter See(See) Derchinger Dennenloher See(See) Dietlhofer See(See) Baggersee(See) Donau(Fluss) Dorfen(Fluss) Dreiburgensee(See) -

Kunststoff LKR 2017 Englisch B.Indd
Region of competence in PLASTICS A region of specialists www.kunststoffcluster.de The economic region “Landkreis Ansbach” Flourishing economy in a romantic landscape The district “Landkreis Ansbach” is a region of dynamic growth in the West of Central Franconia and home to 58 municipalities, 3 universities of applied sciences and more than 4,500 businesses. The large population with below-average unemployment figures demonstrate that in Bavaria’s largest administrative district, a flourishing economy is not at odds with a beautiful landscape. Furthermore, the close links to the economic region of Nuremberg- Fürth-Erlangen with its vast potential of qualified skilled personnel are a great advantage. 2 Industrial sites meeting all requirements Imperial City Festival The region’s economic structure is characterised by in world-famous medium-sized industrial and trading companies Rothenburg o. d. Tauber as well as service businesses; in addition, a varied range of living quarters, educational institutions and leisure facilities are available. With more than 2.7 million square metres of Excellent transport connections industrial sites, areas ranging between 3,000 and The economic region of Ansbach offers optimum 180,000 square metres can be found which meet a transport connections. In Landkreis Ansbach, the large variety of demands and requirements – A6 motorway running from West to East Germany at attractive rates. intersects the A7 motorway, Europe’s most important axis from North to South, thus creating an infrastructure hub which supports economic activities. Consequently, the major agglomerations in Southern Germany are within easy reach: Nuremberg-Fürth- Erlangen are only 30 minutes away, Stuttgart- Heilbronn are reached in roughly one hour, and it takes 90 minutes to get to Mannheim or two hours to reach Frankfurt. -

1. Grundlagen Und Herausforderungen Ziele Und Grundsätze
1. Grundlagen und Herausforderungen Ziele und Grundsätze 1. GRUNDLAGEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER ENTWICKLUNG IN DER RERGION WESTMITTELFRANKEN (8) 1.1 Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber den anderen Landesteilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erfordernisse ihrer unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden. Dabei sollen die in und zwischen den Teilräumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf die Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut werden. 1.2 Zur Stärkung der Raumstruktur soll insbesondere in den zentralen Orten aller Stufen und in geeigneten Gemeinden entlang der Entwicklungsachsen ein Zuwachs an Arbeitsplätzen und Wirtschaftskraft angestrebt werden. 1.3 Die Standortvoraussetzungen für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der einzelnen Teilräume sollen durch den Ausbau des regionalen Straßennetzes, bevorzugt entlang der Entwicklungsachsen und zwischen den zentralen Orten, sowie durch eine attraktive öffentliche Verkehrsbedienung, vor allem unter Einbeziehung von Bahnhaltepunkten, insbesondere von und zu den regionalen Arbeitsmärkten, verbessert werden. Der konsequente Ausbau der Abwasserbeseitigung wie auch die Stärkung des Verbundes der Wasserversorgung soll angestrebt werden. Ferner soll zur Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur auf eine Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten hingewirkt werden. 1.4 Die Beschäftigungsmöglichkeiten -

Übernachten 2019 Accommodation Tourismus.Nuernberg.De
Städteregion Nürnberg Fürth Erlangen Schwabach übernachten 2019 accommodation tourismus.nuernberg.de Hotels Hotels garni Gasthöfe Pensionen A5 Quer Anz Gulden Stern.indd 1 15.10.18 09:57 Komm in die Gänge! Entdecken Sie das wahre Herz Nürnbergs. Erleben Sie die Historischen Felsengänge und kosten Sie fränkische Gerichte bei einem frischen Bier in der Hausbrauerei Altstadthof » Führungen täglich von 11 bis 18 Uhr » Gruppenführungen nach Vereinbarung » Veranstaltungen in den Historischen Felsengängen und in der Hausbrauerei Altstadthof » Original Nürnberger Brautradition in der Hausbrauerei am Fuß der Nürnberger Infos, Tickets und Reservierungen: Kaiserburg Bergstraße 19 · 90403 Nürnberg » Tel 0911 / 23 60 27 31 · Fax 0911 / 23 55 53 65 Räume für bis zu 90 Personen www.historische-felsengaenge.de » BrauereiLaden mit originellen Produkten www.hausbrauerei-altstadthof.de rund ums Bier Ausstattung / Facilities Hotelverzeichnis / Hotelguide Die Sterne bedeuten / Ranking (Stand Oktober 2018 / as of October 2018) Die angegebenen Preise sind Inklusivpreise, sie Zimmer mit Dusche / Bad und WC enthalten die Übernachtung, das Frühstück, die Room with shower / bath and toilet Bedienung, ggf. die Heizkosten und natürlich die Höchste Ansprüche Mehrwertsteuer. Dennoch ist diese Hotelliste kein Zimmer mit Dusche / Bad amtliches Preisverzeichnis. Änderungen, die sich Hohe Ansprüche Room with shower / bath erst nach der Drucklegung ergeben, können nicht Gehobene Ansprüche ausgeschlossen werden. Deshalb empfiehlt es Zimmer mit fließend kalt und warm Wasser Room with hot and cold water sich auf jeden Fall, vor der endgültigen Reser- Mittlere Ansprüche vierung den aktuellen Preis zu erfragen. Einfache Ansprüche Zimmer für Rollstuhlfahrer Wheelchair accessible rooms The prices quoted are all inclusive, they cover S Superior room, breakfast, service, heating charges if any, Klimaanlage im Zimmer and of course, VAT. -

Amtsblatt Gemeinde Petersaurach Ausgabe 3/2020
Amts- und Mitteilungsblatt Gemeinde Petersaurach Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach mit ihren Ortsteilen: Wicklesgreuth, Altendettelsau, Ziegendorf, Langenloh, Großhaslach, Gleizendorf, Steinbach, Vestenberg, Külbingen, Frohnhof und Adelmannssitz Telefon 09872/9798-0 Internet: www.petersaurach.de Telefax 09872/9798-88 Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Gemeinde Petersaurach 49. Jahrgang 13. März 2020 Nr. 03/2020 Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 15. März finden die Kommunalwahlen statt. Sie treffen die Entscheidung darüber, wer in den nächsten sechs Jahren in unserer Gemeinde die Verantwortung übernehmen soll. Herzlichen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für diese Ämter bewerben. Kommunalpolitik ist auch in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Deswegen ehrt es die Bewerberinnen und Bewerber in besonderem Maße. Das Wahlrecht ist das wichtigste Mittel der Demokratie. Nutzen Sie es durch Ihre Stimmabgabe. Entweder durch Briefwahl oder die direkte Stimmabgabe im Wahllokal. In diesem Zusammenhang geht mein Dank natürlich auch an die vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die für den reibungslosen Ablauf der Wahlen verantwortlich sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit! Ihr Lutz Egerer 1. Bürgermeister Am Montag, den 16.03.2020 ist das Rathaus inkl. Bürgerbüro und Postfiliale wegen Nacharbeiten zur Kommunalwahl geschlossen! Wir bitten um Ihr Verständnis. Sitzungen des Gemeinderates: 27.04.2020 um 19:00 Uhr im Schulungsraum der FFW Petersaurach. Kurzfristige Terminänderungen vorbehalten. Die Bekanntmachungen der Gemeinderatssitzungen werden in Schaukästen der Ortsteile ausgehängt. Sie finden die Bekanntmachungen auch auf der Homepage der Gemeinde www.petersaurach.de. Bitte reichen Sie Ihre Baupläne schriftlich und digital als PDF an [email protected] bis spätestens 10 Tage vor dem Sitzungstermin ein, damit die Verwaltung die Pläne vorab prüfen kann. -

Kloster-Kirchen-Kartoffelradweg.Pdf
Zeichenerklärung Kloster - Kirchen - und Kartoffeln - Radwanderweg Alternativroute Anschlüsse zu weiteren Radwegen St. Michael, Weißenbronn 2 Münster, Heilsbronn 1 Zum Biberttalweg Am 20. Oktober 1337 wurde die Kirche in Weißenbronn Kirche Bahnhof Die Gründung des Klosters Heilsbronn geht auf eine Stiftung von Bischof durch ein Breve des Papstes Benedikt XII. dem Erzengel Otto I. von Bamberg (1102 – 1139) aus dem Jahr 1132 zurück. Michael geweiht. Ausgestellt wurde diese Urkunde in Kapelle Parkplatz Das Münster wurde von 1132 – 1139 in seinem romanischen Teil errichtet, Avignon, das damals Sitz des Papstes in der sogenannten 1263 – 1284 mit einem frühgotischen Chor versehen und 1412 – 1433 „Babylonischen Gefangenschaft“ war. durch das spätgotische Mortuarium erweitert. Das ehemalige Zisterzienser- Da im Kirchturm eine Glocke aus dem Jahr 1295 hängt, Münster Spielplatz kloster mit der größten Hohenzollerngrablege Süddeutschlands trägt auch 1 liegt die Vermutung nahe, dass davor schon ein anderes den Beinamen „Christliche Schlafkammer Frankens“. Gotteshaus vorhanden gewesen sein muss. Krankenhaus Direktvermarkter April bis Oktober täglich geöffnet von 9.00 - 12.00 und 13.30 - 17.30 Uhr Geöffnet: Mai - September von 9.00 - 19.00 Uhr. November, Dezember und März 9.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00 Uhr Gottesdienst: Sonntag 9.00 Uhr Januar und Februar und Dienstags geschlossen. Kartoffelanbau Steinkreuz Gottesdienst: Sonntag 9.30 Uhr Gaststätten Bad 2 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 km 3 Digitale Daten des Bayer. Landesvermessungsamts Kapelle, Aich 13 http://www.bayern.de/vermessung Nutzungserlaubnis vom 13.07.2000, Az: VM 3840 B - 2191 und 07.12.2000, Az: VM 3850 B - 4594 Die Kapelle in der Ortsmitte von Aich wurde 1900 von den Eheleuten Wirth gestiftet. -

The Facts of Fiction, Or the Figure of Vladimir Nabokov in W.G. Sebald
the facts of fiction, or the figure of vladimir nabokov in w. g. sebald Leland de la Durantaye W. G. Sebald began his fi rst creative work by invoking the tradition of artists placing portraits of other artists in their works. “Ja, es scheine,” he wrote in Nach der Natur (1988) [ After Nature ], “als hätten im Kunstwerk / Die Männer einander verehrt wie Brüder, / Einander dort oft ein Denkmal gesetzt, / Wo ihre Wege sich kreuzten” [Indeed, it seems as though in such works of art men honored one another like brothers, placing monuments in each other’s image there where their paths had crossed]. 1 Given the place monumentalized artists take in the works to come, a more fi tting beginning for Sebald’s creative career would be diffi cult to imagine. Sebald’s next work, and his fi rst of prose fi ction, Schwindel. Gefühle. (1990) [Vertigo ], weaves a web of uncertain coincidences around Franz Kafka. Sebald’s subsequent book, Die Ausgewanderten (1992) [ The Emigrants], con- tinues in this vein, but in more subtle and deceptive fashion and it is in this work that we can best grasp Sebald’s practice of literary monumentalization and the role it plays in his art. The Emigrants recounts four stories and, as its title stresses, what they share is fi rst and foremost emigration. The emigration at issue, however, is more than merely geographic. Besides the central emigrants of the four tales, a great many of those who play major and minor roles in those lives are also emigrants. What else links the four stories? Three of the four fl ights were precipitated by the rise of National Socialism; three of the four (not the same three) end in suicide. -

Städtische Einrichtungen Und Stadtwerke Windsbach Präsentierten Sich Auf Der Hausmesse Der Ernst Müller Gmbh Am 07
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Windsbach 04 1 46. Jahrgang Freitag, 03. April 2020 Nr. 04 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 16. März 2020 haben Sie mich mit einem überwältigenden Ergebnis erneut zum 1. Bürgermeister der Stadt Windsbach gewählt. Für diesen großen Vertrau- ensbeweis möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Ich freue mich sehr, unsere Stadt engagiert und verantwortungsvoll in die Zukunft führen zu dürfen. Dabei gilt es, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten und zu verbessern. Wir haben in der Vergangenheit Grundlagen geschaffen auf denen wir heute aufbauen können und so können wir sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Hierfür gilt mein besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Windsbach sowie den Stadtratsmitgliedern der jetzt auslaufenden Legis- laturperiode. Durch diese wertvolle Arbeit hat sich unsere Stadt zu einem interes- santen und zukunftsorientierten Standort entwickelt. Vor uns liegen große Herausforderungen. Dabei gilt es die Maßnahmen und Projekte die in den vergangenen Monaten bereits angestoßen wurden aktiv weiter zu begleiten und im Rahmen unserer Gestaltungsmöglichkeiten richtungsweisende und Projekte für die Zukunft anzustoßen. Dazu wünsche ich mir weiterhin eine offene, konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit im Stadtrat sowie eine rege Bürgerbeteiligung. Ebenso liegt mir es sehr am Herzen die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Kirchen- gemeinden, Rettungskräften, Sozialverbänden und Institutionen fortzusetzen. Gerade in schwierigen Zeiten wie wir sie derzeit durchleben helfen sie mit Geschlossenheit und selbstloser Hilfsbereitschaft unserer Bürgerschaft. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft unserer Stadt gestalten. In diesem Sinne wünsche ich uns einen guten Start in die nächste Legislaturperiode und eine gute Zusammenarbeit zum Wohl unserer schönen Stadt. -

Beschreibungen Unterkunftverzeichnis Gemeinden Und Allgemeine Texte Ob Preisgünstige Pension Oder Schickes Hotel, Familienfreun
Beschreibungen Unterkunftverzeichnis Gemeinden und allgemeine Texte Ob preisgünstige Pension oder schickes Hotel, familienfreundliche Ferienwohnung oder Campingplatz mit Seeblick - im Landkreis Roth finden Sie immer die passende Unterkunft. Die Onlinesuche gibt Ihnen die Möglichkeit, nach Orten oder nach Kategorien zu suchen. Gerne helfen wir Ihnen aber auch telefonisch unter 09171 81-1329 oder per E-Mail an tourismus@landratsamt- roth.de, die passende Unterkunft zu finden. BITTE BEACHTEN SIE: Sollten Sie freie Unterkünfte für den Challenge 2017 suchen, raten wir Ihnen, nicht online nach Zimmern zu suchen, da die Liste der freien Unterkünfte systembedingt nur einmal täglich aktualisiert werden kann. Aktuelle Auskünfte zu Unterkunftsmöglichkeiten erfragen Sie am einfachsten und zuverlässigsten per E-Mail an [email protected]. HIER können Sie in unserem neuen BLÄTTERKATALOG das aktuelle Unterkunftsverzeichnis durchschmökern: Whether you are looking for an inexpensive guest house or a fancy hotel, a holiday home suitable for the whole family or a campsite with a sea-view- in the district of Roth you will always find the perfect accomodation for you. The online search gives you the oppurtunity to search by place or by category. If you have any further questions please call us using the number 09171 81 1329 or send us an email using the address- [email protected], so that we can help you to find accomodation that suits you. PLEASE TAKE NOTE: If you are looking for available accomadation for the Challenge Roth 2017, we would advise you not to search for available rooms online, because the list of available accomodation can only be updated once per day. -

Verzeichnis Der Bach- Und Flussgebiete in Bayern Flussgebiet Main Stand: 2016
Bayerisches Landesamt für Umwelt Gewässerverzeichnis Bayern Verzeichnis der Bach- und Flussgebiete in Bayern Flussgebiet Main Stand: 2016 Durch Klicken auf unterstrichene Gebietsbezeichnungen wird der Kartendienst an der entsprechenden Stelle geöffnet! zurück zur Übersicht Einzugsgebiete Hauptgewässer im Einzugsgebiet Kenn Gebiets- Gebietsbezeichnung Größe in Größe Gesamt- Gewässer Gewässer Länge* in Länge* Länge* Gesamt- zahl- kennzahl Bayern außerhalb größe (km²) -Kennzahl Bayern auf bayer. außerhalb länge* Stufe (km²) Bayerns (km) Grenze Bayerns (km) (km²) (km) (km) 2 24 Main 19716,74 7489,47 27206,21 24 Main 359,32 48,20 66,86 474,38 3 241 Main von Quelle bis Regnitz 3825,81 618,13 4443,94 24 Main 82,59 0 0 82,59 4 2411 Weißer Main 637,17 0 637,17 2411 Weißer Main 51,75 0,00 0,00 51,75 5 24111 Weißer Main von Quelle bis Ölschnitz 55,21 0 55,21 2411 Weißer Main 18,82 0 0 18,82 6 241111 Weißer Main von Quelle bis Kroppenbach 12,32 0 12,32 2411 Weißer Main 4,71 0 0 4,71 6 241112 Kroppenbach 3,81 0 3,81 241112 Kroppenbach 3,45 0 0 3,45 6 241113 Weißer Main von Kroppenbach bis Lützelmainbach 7,12 0 7,12 2411 Weißer Main 3,23 0 0 3,23 6 241114 Lützelmainbach 5,31 0 5,31 241114 Lützelmainbach 2,82 0 0 2,82 * Länge des gesamten Gewässerlaufes innerhalb des relevanten oberirdischen Einzugsgebietes. Ein Gewässerlauf kann Abschnitte mit verschiedenen Gewässernamen, Abschnitte ohne Namen und Seenachsen enthalten Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, www.lfu.bayern.de 1 von 149 Seiten Einzugsgebiete Hauptgewässer im Einzugsgebiet Kenn Gebiets- Gebietsbezeichnung Größe in Größe Gesamt- Gewässer Gewässer Länge* in Länge* Länge* Gesamt- zahl- kennzahl Bayern außerhalb größe (km²) -Kennzahl Bayern auf bayer. -

Adressen Und Sprechzeiten Der Gerichtsvollzieher
DIE DIREKTORIN DES AMTSGERICHTS Promenade 8, 91522 Ansbach, Tel. 0981/58-401 Gz. 234 E Geschäftsverteilung der Gerichtsvollzieher im Bezirk des Amtsgerichts Ansbach ab 19.07.2021 Gerichtsvollzieherbezirk 1: zuständig für die Städte, Märkte, Gemeinden, je mit den Ortsteilen: OGV`in M. Geret Ansbach, hins. d.i. Straßenverzeichnis der Stadt Ansbach Sp. 3 zugewiesenen Fischerstr. 12, 91522 Ansbach Straßen/Ortsteile Tel. 0981/817 986 45 oder 0178/1422307 Fax 0981/817 986 46 Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag Lichtenau, Neuendettelsau, Sachsen bei Ansbach, je von 9.00 bis 11.00 Uhr Windsbach Vertreter: GVin Lang Gerichtsvollzieherbezirk 3: zuständig für die Städte, Märkte, Gemeinden, je mit den Ortsteilen: OGV H. Blomeyer Ansbach, hins. d.i. Straßenverzeichnis der Stadt Ansbach Sp. 3 zugewiesenen Fischerstr. 12, 91522 Ansbach Straßen/Ortsteile Tel.0981/817 987 42, Fax 0981/817 986 44 Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag Colmberg, Flachslanden, Geslau, Lehrberg, Oberdachstetten je von 8.30 bis 10.00 Uhr Vertreter: HGV Popp Gerichtsvollzieherbezirk 5: zuständig für die Städte, Märkte, Gemeinden, je mit den Ortsteilen: HGV U. Krebs Grillenbuckring 51, 91550 Dinkelsbühl Dinkelsbühl, Mönchsroth, Wilburgstetten, Wittelshofen, Tel. 09851/4986, Fax 09851/553859 Weiltingen Sprechzeiten: Dienstag und Freitag je von 9.00 bis 10.00 Uhr Vertreter: HGV Dietmar Blomeyer Gerichtsvollzieherbezirk 6: zuständig für die Städte, Märkte, Gemeinden, je mit den Ortsteilen: HGV`in S. Knapp Ansbach, hins. d.i. Straßenverzeichnis der Stadt Ansbach Sp. 3 zugewiesenen Welserstraße 10, 91522 Ansbach Straßen/Ortsteile Tel. 0981/95383680, Fax 0981/97789715 Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag Adelshofen, Gebsattel, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, je von 9.30 bis 11.00 Uhr Rothenburg o.d.T., Steinsfeld, Windelsbach Vertreter: JS als GV Mann Gerichtsvollzieherbezirk 7: zuständig für die Städte, Märkte, Gemeinden, je mit den Ortsteilen: HGV G. -

The Chronicle of Lucka 66
s • i al THE CHRONICLE OP LUCKA A Thesis Presented to the Faculty of the Rice Institute — 0 *7 f 3 8 5L| l In Partial Fulfillment LsJ of the Requirements for the Degree Master of Arts by Helen Barnett Green '/ May 1950 TABLE OP CONTENTS CHAPTER PAGE I. HISTORICAL BACKGROUND OF THE CHRONICLE 1 II. THE MILITARY SYSTEM DURING THE THIRTY YEARS' WAR 16 III. THE LITERARY BACKGROUND OF THE CHRONICLE 20 IV. A CONSIDERATION OF THE LUCKA CHRONICLE k-2 V. THE TOWN OF LUCKA 53 VI. NOTES TO THE ENGLISH TRANSLATION 55 Editor's Preface 58 The Chronicle of Lucka 66 Extract from the Calendar of Otto Freund 10k Appendix to the Chronicle 126 FOOTNOTES 133 BIBLIOGRAPHY 1^3 CHAPTER I HISTORICAL BACKGROUND OF THE CHRONICLE The town of Lucka is situated in that district of Saxony known as Thuringia, not far from Leipzig (see map). At the end of the Middle Ages, when the empire began to be known as the Holy Roman Empire of the German Nation, it was divided into ten districts or Circles of the Empire. Saxony with Brandenburg and some smaller territories, made up the Upper Saxon Circle. Saxony was also one of the seven electoral states of the empire. In 1485, Saxony divided its territory between two branches of its ruling House of Wettin, the Ernestine, or electoral line, and the Albertine, or ducal line. The latter had its capital at Dresden from which it governed the plains of the Elbe and the Mulde. During the Schmalkald War (1546-1547),^ the emperor formally transferred the electorate from the Ernestine House, long his enemy, to the Albertine or Dresden branch.