Leseprobe-30848.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TU Intern 11/2002 Als Pdf-Datei
ıntern T Die Hochschulzeitung der Technischen Universität Berlin www.tu-berlin.de/presse/tui Nr. 11/November 2002 Solidarpakt ade Start geglückt Jugendlicher Wissensdrang Sind die Tarife im öffentlichen Dienst Zu Beginn des Semesters noch zu retten? Die Berliner Ver.di-Che- besuchten Prominente wie Pawel Piotrowski wurde Bundes- und fin Susanne Stumpenhusen (links) und Rita Süssmuth, Hellmuth Europasieger „Jugend forscht“. Nun Claudia Pfeiffer (rechts) vom Kommuna- Karasek und Sigrid Löffler will er seine Neugier beim Studium der len Arbeitgeberverband erklären ihre (Foto) die TU Berlin Luft- und Raumfahrt an der TU Berlin Standpunkte. Seite 8 befriedigen. Seite 2 Seite 4 Inhalt –––––––––––– Zur Sache –––––––––––– ALUMNI Musik aus dem Weltraum, irdische Infos TU-Präsident Kutzler Unsichtbare Regeln Eine Bauingenieurin erzählte den Mehr als 5000 neue Studierende - Verkehrswesen am beliebtesten verurteilt anti- Berufseinsteigern, wie sie Hürden bei der Gründung überwand semitische Hetze Seite 7 Mit der Veranstaltung „Der Irak – Ein neuer Krieg und die Folgen“ in der so FORSCHUNG genannten Alten TU-Mensa am 27. Auf Trebe Oktober 2002 ist die TU Berlin öffent- Was in Berlin für Wohnungslose lich ins Schussfeld der Kritik geraten. fehlt. Ein Forschungsprojekt Zu Unrecht, stellt Präsident Kurt Seite 9 Kutzler fest, denn die TU Berlin sei nicht verantwortlich für die Veran- INTERNATIONALES staltung. Die Vermietung der Räume, „Litauen wird es schaffen!“ die Prüfung des Veranstalters und des Ein Stipendiat berichtet über Programminhalts falle allein in die seine baltischen Erfahrungen. Das Verantwortung des Studentenwerks. Career Center half ihm auf die Unabhängig davon bedauert der Präsi- Sprünge Seite 11 dent außerordentlich die Inhalte, die auf der Veranstaltung nach Medienbe- MEDIEN richten artikuliert worden sein sollen. -

Kunstbücher & Ausstellungskataloge
Heidrichs Kunst Die meisten der angebotenen Bücher und Kataloge sind wenig gebraucht. Lager- und Gebrauchsspuren wurden bei der Preisgestaltung berücksichtigt. Einzelne Bücher können bereits verkauft sein. Die Abbildungen geben nur einen ersten Eindruck, Farbabweichungen vom Original sind wahrscheinlich. Auf Anfrage erhalten Sie ausführliche Informationen zu den Objekten, die Sie interessieren. KUNSTBÜCHER & AUSSTELLUNGSKATALOGE Preisliste H November 2020 Haack bis Hirano Horst Haack Chronologie terrestre Zweisprachiger (deutsch, französisch) Katalog zur Ausstellung in der Thomas-Mann - Bibliothek Luxemburg, 1985, mit einer Einführung von Brigitte Stranz-Wersche und einer Textmontage von Horst Haack; 32 Seiten, 15 Abbildungen Preis: 5,00 € Bettina van Haaren Katalog zur Ausstellung in St. Ingbert, 1992, mit einer Einführung von Egbert Baqué; 32 Seiten, 12 Abbildungen Preis: 5,00 € Ernst Haas I grandi fotografi Fotobuch in italienischer Sprache mit Texten von Romeo Martinez und Bryn Campbell, Gruppo Editoriale Fabbri, Milano, 1982, 64 Seiten, 56 Abbildungen Preis: 5,00 € Volkmar Haase Katalog des Kunstamtes Berlin-Wilmersdorf zur Ausstellung anlässlich der Berliner Festwochen 1962, mit einem Text von Eberhard Roters; 16 Seiten, 10 Abbildungen Preis: 5,00 € Volkmar Haase Zweisprachiger (deutsch, englisch) Katalog zur Ausstellung in der Galerie S, Berlin, 1968, mit einer Einführung von Curt Grützmacher; 24 Seiten, 17 Abbildungen; Nr. 159 von 250 Exemplaren Preis: 6,00 € 1 Heidrichs Kunst Volkmar Haase Skulpturen 1965-1987 Katalog zur Ausstellung -

Anlass: Nachlass Symposion Zum Umgang Mit Künstlernachlässen
DOKUMENTATION Anlass: Nachlass Symposion zum Umgang mit Künstlernachlässen 12. Dezember 2015 Akademie der Künste, Hanseatenweg Berlin Gefördert von In Kooperation mit der Veranstalter Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Mohrenstraße | 10117 Berlin 1 INHALTSVERZEICHNIS Begrüßung……………………………………………………………………………………………..3 PODIUM I Rechtliche Rahmenbedingungen – Künstlerstiftungen – Rolle der Museen – Dokumentation durch Digitalisierung …………………………………………………………………………..……………..25 PODIUM II Aktiv werden – Möglichkeiten der Vorsorge zu Lebzeiten und besondere Aspekte aus Sicht von Nachlasshaltern …………………………………………………………………………………………..…...49 PODIUM III Anforderungen an die Kulturpolitik………………………………………………..…………………………..72 Offenes Forum…………………………………………………………………………………….……………94 Verabschiedung……………………………………………………………….………………………………112 2 BEGRÜSSUNG Prof. Klaus Staeck: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Monika Grütters, seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Ich grüße auch Siegmund Ehrmann, den Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien. Ich sehe in Ihrer Teilnehme die Wertschätzung der Politik für dieses wichtige Thema. Vor allem begrüße ich natürlich die lieben Kolleginnen und Kollegen unter den Künstlern, Galeristen, Museumsleuten – ein breites Spektrum zur Erörterung dieser Fragen. Und ich glaube, dass hier der richtige Ort dafür ist. Die Akademie verfügt über ein national anerkanntes großes Archiv mit insgesamt 1.200 Künstlernachlässen. In erster Linie sind es Mitglieder der Akademie, die ihren Nachlass hierher geben. Ein Schwerpunkt ist Berlin, wir haben auch viele Einzelerwerbungen. Ich selbst bin dabei, meine Sachen zu ordnen. Wenn man in einem bestimmten Alter ist, denkt man natürlich darüber nach. Wer soll denn mit all den Sachen später etwas machen, wo sollen die hingehen? Das ist der berühmte Vorlass, da bin ich dabei. Für manche Nachlässe, die wir bekommen, gibt es Geld. Teilweise akquirieren wir über Stiftungen, auch der Staat finanziert gelegentlich etwas. Es gibt also viele Facetten, Gegenstand genug für dieses Symposion. -

Download Download
Downloaded from the Humanities Digital Library http://www.humanities-digital-library.org Open Access books made available by the School of Advanced Study, University of London ***** Publication details: Writing and the West German Protest Movements: The Textual Revolution by Mererid Puw Davies https://humanities-digital-library.org/index.php/hdl/catalog/book/writing- west-german-protest-movements DOI: 10.14296/0420.9780854572762 ***** This edition published 2020 by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF MODERN LANGUAGE RESEARCH Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU, United Kingdom ISBN 978-0-85457-276-2 (PDF edition) This work is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses Writing and the West German Protest Movements The Textual Revolution imlr books Established by the Institute of Modern Languages Research, this series (fomerly known as igrs books) aims to bring to the public monographs and collections of essays in the field of modern foreign languages. Proposals for publication are selected by the Institute’s editorial board, which is advised by a peer review committee of 36 senior academics in the field. To make titles as accessible as possible to an English-speaking and multi-lingual readership, volumes are written in English and quotations given in English translation. For further details on the annual competition, visit: http://modernlanguages.sas.ac.uk/publications/igrs-books/ Editorial Board Professor Catherine Davies (Hispanic) Dr Dominic Glynn (French) Dr Katia Pizzi (Italian) Dr Godela Weiss-Sussex (Germanic) imlr books Volume 11 Volume Editor Dr Joanne Leal Writing and the West German Protest Movements The Textual Revolution by Mererid Puw Davies SCHOOL OF ADVANCED STUDY UNIVERSITY OF LONDON Institute of Modern Languages Research 2016 This book is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. -

Press Kit Drawing the City 13.8.20
Press Kit Berlin, 13.8.20 cm, 9 , 34 x 28 , Tuschfeder und Tuschpinsel auf Velinpapier, , Foto: Kai-Annett Becker 1947 2020 Bild-Kunst, Bonn Bonn Bild-Kunst, VG Werner Heldt, Trümmer, Trümmer, Heldt, Werner © Drawing the City Paper-based works from 1945 to the present 14.8.20 – 4.1.21 Contents Press release Drawing the City P. 1 Artists P. 5 Exhibition texts P. 8 Catalogue P. 10 Programme in English P. 11 Press images P. 13 Contact P. 18 Press Release Berlin, 13.8.20 Berlin has been drawn by its history, by triumphs and fiascos, by feudalism, pragmatism, liberalism, democracies and dictatorships. It has also been drawn and painted by many artists. The Berlinische Galerie holds one of the biggest and most significant collections of art about the city of Berlin. The Collec- tion of Prints and Drawings alone houses an abun- dant variety of about 25,000 works on numerous cm 1 , 24 themes. Art from East Berlin accounts for a sub- x 5 , stantial and valuable share of the holdings. In recent 34 years, the Collection of Prints and Drawings has ben- efited from many excellent new acquisitions. , Pastell auf Papier, A special selection will go on display from 14 August, 1972 in many cases for the first time. It will embrace more than 175 works, some as complex series, by 22 women and 47 men: mostly drawings in all formats from big to small, much in colour, much in black-and- white, in very different techniques and with a varie- gated bouquet of representational art, photorealism, surrealism, late Expressionism, abstract styles, illus- trations and comics. -

Behind Closed Doors: Domestic Violence, Citizenship and State-Making in Divided Berlin, 1969-1990
Behind Closed Doors: Domestic Violence, Citizenship and State-Making in Divided Berlin, 1969-1990 By Jane Freeland, BA (Hons), MA A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History Carleton University Ottawa, Ontario © 2015, Jane Freeland Abstract This dissertation investigates the approaches taken to address domestic violence in East and West Berlin between 1969 and 1990. Both Germanys created a language to define domestic violence, which not only reflected and reinforced their self-definition as liberal or socialist states, but did so in a way that had important consequences for women and marginalized communities. Indeed, the contested interactions between the state, activists and citizens in responding to gender violence often centred on competing ideas on the role of gender and gender equality in society. Through an analysis of official state and grassroots responses to domestic violence, this dissertation argues that in addressing these forms of violence, competing visions of citizenship were negotiated by politicians, everyday Germans and activists alike. Although official efforts often only solidified normative heteropatriarchal visions of gender relationships, activists from either side of the Berlin Wall used citizenship as a standpoint to critique the state for failing to protect women from violence. Despite different levels of support available to women living with abusive partners in East and West, women across Germany were primarily responsible for tackling domestic violence and fomenting everyday gender equality. Placing the stories of East and West together then, makes these historically constituted processes of women’s marginalization visible, highlighting the similarities that existed across the Berlin Wall, despite very different political systems. -

East German Poster Collection, Series 4: Art Exhibition Posters, Special
East German Poster Collection, Series 4: Art Exhibition Posters, Special Collections and Archives, GMU Libraries item: AE‐0001 title: Sowjetishes Künstlerishes Glas und Gobelins date: 1977 size (cm): 57.5 x 81 summary: This poster is green with a center image of a blue blown glass vase holding blown glass flowers. It is for an art exhibit of Soviet glass and tapestries at the Exhibition Center in Berlin (July ‐ August 1977). item: AE‐0002 title: Ausstellung Glas aus zwei Jahrtausenden date: 1977 size (cm): 57 x 81 summary: This poster shows an ornate glass vase painted with scenes of villages and people. It is for an exhibit of glass art at the State Gallery in Halle (August 1977 ‐ July 1978). item: AE‐0003 title: Grafik zur Sowjetischen Literatur date: 1977 size (cm): 81 x 57 summary: This poster shows a black and white painting of stylized people spinning in a vortex surrounded by a Soviet cityscape. It is for an exhibit of art in Soviet literature at the Club of Culture in Berlin (October 15, 1977 ‐ November 8, 1977). item: AE‐0004 title: Galerie der Fruendschaft 1973 date: 1973 size (cm): 58.5 x 84 summary: This poster shows a black and white painting of young child in the style of folk art. Behind the child are five circles of bright colors. It is for an exhibit entitled "Gallery of Friendship" at the State Museum in Schwerin (June ‐ July 1973). item: AE‐0005 title: Hans Grundig date: 1973 size (cm): 57 x 81 summary: This poster shows a painting of a pack of wolves surrounding a larger wolf in the middle. -

Komparativna Analiza Studentskog Pokreta U Sr Njemačkoj I Sr Hrvatskoj 1968
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest KOMPARATIVNA ANALIZA STUDENTSKOG POKRETA U SR NJEMAČKOJ I SR HRVATSKOJ 1968. GODINE Diplomski rad Zrinka Borovečki Mentor: doc. dr. sc. Ivica Šute Zagreb, 2012. SADRŽAJ 1. Uvod ..................................................................................................................................3 2. Historiografija o studentskim pokretima u Saveznoj Republici Njemačkoj i Socijalističkoj Republici Hrvatskoj .............................................................................................................. 10 2. Frankfurtska škola i Praxis-filozofija – kritika i humanistički socijalizam ......................... 17 3. Godina 1968. u Saveznoj Republici Njemačkoj i Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ....... 26 3.1. Fenomen 1968. godine ............................................................................................... 26 3.2. Godina 1968. u Saveznoj Republici Njemačkoj ........................................................ 28 3.3. Godina 1968. u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ................................................... 44 3.4. Komparacija 1968. godine u SR Njemačkoj i SR Hrvatskoj ....................................... 54 4. Posljedice studentskih pokreta, studentski časopisi i pitanje karizmatskih vođa kod studenata .............................................................................................................................. 58 4.1. Karizma ili tek popularni nastup? .............................................................................. -

Umbau Der Stasiunterlagen-Behörde Separate Leistungen Für
FÜR FREIHEIT, RECHT UND DEMOKRATIE 13017 Nr. 3/2016 Umbau der Stasiunterlagen-Behörde Separate Leistungen für Zivildeportierte Interniert in Karelien Gegründet 1991 vom BSV-Landesverband Berlin Aktuell2 Inhalt Editorial Aktuell Kein Zweifel 3 Umbau-Pläne in der Kritik Härtefallfallfonds Von Horst Schüler Verstärkte Beratung Auszeichnung Kommentar Senioren-Treff. Einige von uns sind hoch in Hamburg sein Publikum auffordert, in den Achtzigern, andere bereits im fol- „den Finger in alle Frauen zu stecken“, Recht genden Jahrzehnt. Fragt einer die Run- die Mutter zu f... beziehungsweise die 4 Regelbedarfsstufen 2016 de: „Woran denkt ihr eigentlich meist? Schwester „zu knallen“. Und du erin- Hinweis An das, was gestern war? Oder an das, nerst dich bitter daran, daß Deutschland Separate Leistungen was morgen sein wird?“ Und alle sind einst das Land der Dichter und Denker OLG Naumburg präzisiert Rechtsprechung zu Heimkindern sich einig: Die Vergangenheit beherrscht geheißen wurde. ihre Gedanken, die Zukunft kaum. Näch- International ste Frage: Die Gegenwart? „Das ist nicht Wir leben in einer Gesellschaft, in der es 5 Thailand und Laos in Pekings Sog mehr meine Welt“, meint einer, „ich üblich geworden ist, daß die Menschen Proteste gegen chinesischen Präsidenten in Prag verstehe sie nicht mehr.“ Und auch dem nicht mehr von Angesicht zu Angesicht Ehemalige Workutaner kondolieren stimmen alle sofort zu. miteinander kommunizieren, sondern Gefährliche Bücher über Facebook mittels digitaler Technik, Ich bin mir ziemlich sicher, daß die mei- die immer unheimlicher unser Leben be- Interview sten einstigen politischen Häftlinge bei stimmt. Wir erfahren, daß nicht mehr die 6 Orientierung am historischen Ort einer Umfrage ähnlich antworten wür- Deutsche Bundesbank unsere Finanzpo- 7 Dokumentiert den. -

(Gegen)Gewalt, Forum for Modern Language Studies, Volume 53, Issue 4, 1 October 2017, Pages 379–404 Is Available Online At
This is a pre-copyedited, author-produced PDF of an article accepted for publication in Forum for modern language studies following peer review. The version of record Clare Bielby; West Germany’s neue Frauenbewegung and the Productive Potential of Feminist (Gegen)gewalt, Forum for Modern Language Studies, Volume 53, Issue 4, 1 October 2017, Pages 379–404 is available online at: https://doi.org/10.1093/fmls/cqx037 WEST GERMANY’S NEUE FRAUENBEWEGUNG AND THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF FEMINIST (GEGEN)GEWALT CLARE BIELBY ABSTRACT This article explores the feminist potential of (Gegen)gewalt ((counter-)violence) during the founding years of West Germany’s neue Frauenbewegung: firstly, as a discourse and practice which helped create the discursive space to start imagining feminist identity in the late 1960s, when, it has been argued, no such identity existed; secondly, as a militant practice in the early 1970s, through which women were able to change their gendered behavioural scripts in positive feminist ways; finally, as feminist self-defence, understood as enabling women to continue to imagine an active subject position in the mid-1970s, when women as the victims of patriarchal violence had become the predominant idea of the movement. Reading feminist flyers, publications and other documents of the period, as well as more recently published accounts of the movement, alongside the wider discourse on (Gegen)gewalt of the 1960s and 1970s, I trace a cultural history of feminist (Gegen)gewalt. Keywords: Germany; violence; die neue Frauenbewegung; militancy; 1970s; antiauthoritarian student movement _______ (GEGEN)GEWALT WAS a central idea for the West German antiauthoritarian movement of the late 1960s and the movements that developed out of it. -
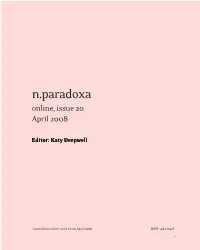
N.Paradoxa Online Issue 20, April 2008
n.paradoxa online, issue 20 April 2008 Editor: Katy Deepwell n.paradoxa online issue no.20 April 2008 ISSN: 1462-0426 1 Published in English as an online edition by KT press, www.ktpress.co.uk, as issue 20, n.paradoxa: international feminist art journal http://www.ktpress.co.uk/pdf/nparadoxaissue20.pdf April 2008, republished in this form: January 2010 ISSN: 1462-0426 All articles are copyright to the author All reproduction & distribution rights reserved to n.paradoxa and KT press. No part of this publication may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, including photocopying and recording, information storage or retrieval, without permission in writing from the editor of n.paradoxa. Views expressed in the online journal are those of the contributors and not necessarily those of the editor or publishers. Editor: [email protected] International Editorial Board: Hilary Robinson, Renee Baert, Janis Jefferies, Joanna Frueh, Hagiwara Hiroko, Olabisi Silva. www.ktpress.co.uk n.paradoxa online issue no.20 April 2008 ISSN: 1462-0426 2 List of Contents Issue 20 (April 2008) Gisela Weimann Shared and/or Divided Times: Questions and Answers and Europe in Exile 4 Brigitte Hammer Shared Times II / Pictures and Sculptures 12 Moira Roth Widening the Spiral: Musings and Readings in a Berkeley cafe, California, March - April 2007 15 Katy Deepwell More than Seven Urgent Questions about Feminism 24 Sanne Kofod Olsen Feminist art in Denmark a short introductory history and an interview with Kirsten -

1 Christina Von Hodenberg Writing Women's Agency Into the History of the Federal Republic
Christina von Hodenberg Writing women’s agency into the history of the Federal Republic: “1968”, historians and gender The emancipation of women was one of the biggest changes transforming post-war West German society after 1945, and indeed Germany throughout the whole of the twentieth century. The change in gender relations was a long, uneven process that included setbacks and several dynamic thrusts of acceleration. In this, the Federal Republic of Germany was no different from many other highly industrialized societies. Still, much of the historiography on post-war Germany has failed to address the issue adequately, and to weave the political actions of women and the rise of female emancipation into its master narratives. This essay addresses the reasons for this failure, but also the implications of its reversal. It aims to show that the addition of feminism to West German history necessarily changes the agents driving the development, but also the definition of “success” in the teleological Westernization narrative of the Federal Republic. The first part of the article engages critically with the omission of female agency in the scholarship on post-war Germany. The second part focuses on a concrete example, based on original research: the role of women activists during West Germany’s “1968.” It serves as a showcase for the wide-ranging implications of the inclusion of feminist agency. The master narratives of the West German Sixties, but also of post-war West German history in general, emerge as in need of rewriting.* Not coincidentally, all historians who have tackled the grueling task of writing large-scale national histories of post-1945 Germany (in German) have so far been men.