Denkmal Und Farbe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jeder Raum Erhält So Seine Binnengliederung, Gestützt Durch
231 Jeder Raum erhält so seine Binnengliederung, gestützt In dem letzten Bauabschnitt (Argentinische Allee, Rie durch ein differenziertes Farbspiel bei den Fenstern und meisterstraße, Onkel-Tom-Straße) Bruno Tauts in "On Türen, die - wie es scheint - auf einer mondrianischen kel Toms Hütte" von 1931/32 zeigen die Baukörper des Bildteilung beruhen kann. mehrgeschossigen Wohnungsbaus, der in einem Kie fernwald eingebettet ist, eine monochrome Fassade, Diese Binnengliederung der Gebäude - auch bei der die mal blau, grün-blau bzw. rot-braun gefaßt ist. Erst Bebauung Am Fischtal - ist immer ein wesentlicher durch eine kontrastierende Farbgebung bei den Bai Bestandteil der Fassadengestaltung bei Taut gewesen. konen erhalten die Fassaden ihre Harmonie in Verbin Durch diese Differenzierung war es möglich, bei glei dung mit dem Landschaftsraum. chen Elementen eine Vielfalt unter Wahrung der Ein heit zu erreichen. Bruno Taut hat in seinen Siedlungsmemoiren den Fran zosen Vaudoyer zitiert: "Die Häuser sind von einer sehr einfachen Modernität und vor allem äußerst heiter. Jede Straße hat hinter ihrem Kiefervorhang ihr Gesicht, ihre Farbe... Gewiß, solche Häuser machen noch nicht das Glück aus, doch mindestens laden sie zum Glücklich• sein ein." Abb. 32: Waldsiedlung Zehlendorf "Onkel Toms Hütte", Berlin- ANMERKUNG Zehlendorf Argentinische Allee 140-148, Bauabschnitt VII, B.Taut, 1931/32 Gartenansicht, Zustand 1987 (1) Vergleiche Franziska Bollerey, Kristiana Hartmann: Bruno Taut Vom Foto: Archiv Architekturwerkstatt Pitz/Brenne phantastischen Ästheten zum ästhetischen Sozial(ideal)isten. In: Ausstellungskatalog Bruno Taut, 1880-1938 (Berlin, 1980), S. 54 Abb. 33: Choriner Wald um 1903, B. Taut Pastell, Kreide auf brau nem Papier Nachlaß: H. Taut 232 SYMPOSIUM BRUNO TAUT TEIL 4 Bruno Tauts Wirken und Wirkungen in Magdeburg 233 Eckhart W. -
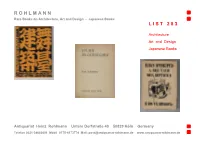
R O H L M a N N L I S T 2
R O H L M A N N Rare Books on Architecture, Art and Design - Japanese Books L I S T 2 8 3 Architecture Art and Design Japanese Books Antiquariat Heinz Rohlmann Untere Dorfstraße 49 50829 Köln Germany Telefon 0221-34666601 Mobil 0175-4173774 Mail: [email protected] www.antiquariat-rohlmann.de 1 ERENBURG (or EHRENBURG), Ilya (Grigorevich). A vse-taki ona vertitsja. [And yet the world goes round]. Moscow and Berlin, Gelikon (1922). 139, (3)pp. and Moscow and 16 photogravures on plates, and line illustrations by F. Léger, and others. 22,5 x 16,5 cm. Original illustrated wrappers (F. Leger). EUR 2400 This rare treatise on contemporary avant-garde art by Ehrenburg (1891-1967) is not only noteworthy for its typographical experiementation, but it defends Contructivism in early art ("Oblozhka raboty Fernanda Lezhe") and includes also a penetrating analysis of the "new architecture" which Vladimir E. Tatlin and his work are seen to have generated. Among the artists the Russian critic considers are Léger, Lipchitz, Lissitzky, Picasso, Rodchenko, Van Doesburg and even from a Charlie Chaplin film. Very fine uncut copy. 2 Kandinsky, Wassily. Kanjinsukî no geijutsuron (カンヂンスキーの芸術論). [Über das Geistige in der Kunst ]. Tokyo, Idea Shoin 1924. 170 leaves: = 110 leaves with printed text; 60 leaves of glossy paper with plates, printed title in Japanese and Western characters on glossy paper, monochrome photographic portrait of Kandinsky. 25,5 x 19,5 cm. Original publisher´s cloth with gilt, original card slipcase. EUR 800 A very scarce edition of Kandinsky's „Uber das Geistige in der Kunst“ published in Japan in 1924. -

In Unserem Heutigen Verständnis Aller- Dings Ein 'Naiv
121 haupt möglich - allgemein, politisch und philosophisch Und: Ich bitte Sie herzlich, sollten Sie auf weitere Hin interessierter - in unserem heutigen Verständnis aller weise, Quellen und Lebenszeugnisse des Künstlers dings ein 'naiv-unpolitischer' Zeitgenosse. stoßen, so bitte ich um Nachricht. Engagiert im 'ARBEITSRAT FÜR KUNST' 1918-1921 Vielen Dank. und mit Ausstellungsbeteiligungen bei der 'NOVEM BERGRUPPE' in Berlin, punktuell bei den 'Großen Ber liner Kunstausstellungen' - Gruppe der 'ABSTRAKTEN', Ausstellungen bei Alfred Flechtheim, Israel Ber Neu mann in Berlin und der Galerie Von der Goltz in Mün chen, befand er sich - mit seiner Unterschrift unter di versen Aufrufen und eigenen Statements zur damals diskutierten 'Revolutionierung des Lebens durch die Kunst', durch die Beteiligung an der '1. DADA-Ausstel- lung' und einer Ausstellung 'Unbekannte Architekten' in der Galerie I. B. Neumann in Berlin, mit zeitgemäßen expressionistisch-utopischen Architekturentwürfen, auf der Höhe der zeitgenössischen künstlerischen Avant garde. ANMERKUNGEN Vor diesem Hintergrund und durch die vielen regiona (1) Kurt Gerstenberg, 'Revolution in der Architektur', CICERONE len wie internationalen Ausstellungsbeteiligungen war Xl. Jg., Heft 9, Januar 1919. und ist er - dank der offensiven Ausstellungsaktivitä (2) Manfred Speidel, Katalog 'Natur und Fantasie - Retrospektive ten der Galerie DER STURM Herwarth Waldens in Ber Bruno Taut in Magdeburg 1995, Berlin 1995. lin - und vor dem Hintergrund seiner bisher sichtbar gewordenen qualitätvollen Bilder, neben all den heute (3) Ausstellungkatalog Der Sturm, 51. Ausstellung, April 1917, Ar noch bekannten und berühmten Künstlerinnen jener nold Topp, Neil Waiden, Berlin 1917. Zeit, gleichberechtigt zugehörig anzusehen. (4) Zitiert nach H.A.Peters in Soester Anzeiger 8./9. Mai 1993. Nachdem, bis in die letzten Jahre, vor allem die gro (5) Katalog GROSSE BERLINER KUNST-AUSSTELLUNG 1926. -

Experiment, Utopie Und Wirklichkeit — Die Mathildenhöhe Und Das Neue Bauen in Der Weimarer Republik
Experiment, Utopie und Wirklichkeit — Die Mathildenhöhe und das Neue Bauen in der Weimarer Republik Olaf Gisbertz Peter Behrens konzipierte mit dem Theaterintendan- 1921 gab die Stadt Magdeburg einen Notgeldschein ten Georg Fuchs die Eröffnungsfeier der Mathilden- in Umlauf, auf dem ein Kristall die Mitte der Stadt er- höhe als Aufführung des Festspiels „Das Zeichen“. Am leuchtet: links abgebildet der Dom, rechts eine Baustelle 15. Mai 1901 schritt der bekannte Bühnenschauspieler mit Handwerkern auf einem Baugerüst als Sinnbild des und Opernsänger Friedrich Riechmann im Gewand Neuen in der als grauen Mietkasernenstadt bis dato ver- eines „Verkünders“ die große Freitreppe vor dem Ernst pönten Elbestadt. (Abb. 1) Ludwig-Haus hinunter und enthüllte unter den Augen Was in der von Bruno Taut gegründeten „Gläser- des Großherzogs den leuchtenden „Kristall der reinen nen Kette“2 nur im Verborgenen unter Pseudonymen Kunst“. Dazu ertönten Fanfaren und alle Anwesenden verhandelt worden war, geriet mit seinen Veröffentli- der Zeremonie waren von einer seltsamen Ergriffenheit chungen zum „Frühlicht“3 in Magdeburg an die Öffent- berührt. So berichteten jedenfalls Augenzeugen von lichkeit. An prominenter Stelle erscheint darin wieder dieser festlichen Handlung neuen Stils.1 Der Impetus der Kristall, hier als „Haus des Himmels“ bezeichnet. So für eine neue Zeitrechnung in Kunst, Kunstgewerbe konnte Bruno Taut seinem Reformwillen als Stadtbau- und Architektur blieb noch zwei Jahrzehnte später eine rat den nötigen Nachdruck verleihen und der Öffent- wichtige Triebfeder für die Durchsetzung der Ideale lichkeit sein Architekturprogramm präsentieren. Waren eines Neuen Bauens zur Zeit der Weimarer Republik: Scharouns wunderbare Aquarelle als reine Kunst zweck- frei von allen realen Bedingungen der Baustelle befreit, verlieh Taut der Zukunft mit dem Motiv des Kristalli- nen eine realisierbare Vision für eine ganze Stadt: dem Neuen Magdeburg. -

Politik & Kultur
Dossier »Wie weiblich ist die Kulturwirtschaft?« , € November/ Dezember 26 Zeitung des Deutschen Kulturrates www.politikundkultur.net In dieser Ausgabe: Tom Buhrow Jutta Cordt . Deutscher Bundestag Berliner Kulturträume Inklusive Kulturpolitik Reformationsjubiläum Henriette Reker Alles neu macht die Bundestags- Quo vadis Museen in der Mehr Barrierefreiheit in Kunst Nicht Luther, sondern Zwingli: Ulla Schmidt wahl: Worauf wird es kultur- Hauptstadt? Partizipation im und Kultur: Menschen mit Was können wir von den politisch in der kommenden Humboldtforum & Architektur Behinderung als Künstler und Schweizer Reformations- Paul Spies Legislaturperiode ankommen? am Kulturforum Kulturkonsumenten feierlichkeiten lernen? und viele andere Seite Seiten und Seite bis Seite Erosion Noch bevor der Deutsche Bundes- tag das erste Mal zusammenkam und die AfD rechts außen mit ihrer großen Fraktion Platz nahm, be- gann im Kulturbereich schon die Erosion des Widerstandes gegen die neue rechtsradikale Partei. Die Dif erenzierer und die Beschwichti- ger meldeten sich immer lauter zu Wort. Die Dif erenzierer machten ei- nen großen Unterschied zwischen der AfD und ihren Wählern. Die AfD selbst sei zwar völkisch national, fremdenfeindlich und lehne kultu- relle Vielfalt, Kunstfreiheit und ein geeintes Europa ab, aber ihre Wähler wollten doch nur protestieren gegen das Establishment und seien unzu- frieden mit ihrem Leben. Eigentlich kann man Menschen nur schwerlich schlimmer herab- setzen als ihnen jede bewusste Ent- scheidung abzusprechen. Wer die AfD gewählt hat, wusste ganz genau, Die Kraft der Worte was er tat, einen »Er will doch nur spielen«-Bonus gibt es nur für Hun- Jahre Heinrich Böll. Seiten bis de, nicht aber für Menschen. Die Beschwichtiger sind nach meiner Ansicht aber noch gefährli- ALLIANCE PICTURE FOTO: cher. -

100 Years of Bauhaus
Excursions to the Visit the Sites of the Bauhaus Sites of and the Bauhaus Modernism A travel planner and Modernism! ↘ bauhaus100.de/en # bauhaus100 The UNESCO World Heritage Sites and the Sites of Bauhaus Modernism Hamburg P. 31 Celle Bernau P. 17 P. 29 Potsdam Berlin P. 13 Caputh P. 17 P. 17 Alfeld Luckenwalde Goslar Wittenberg P. 29 P. 17 Dessau P. 29 P. 10 Quedlinburg P. 10 Essen P. 10 P. 27 Krefeld Leipzig P. 27 P. 19 Düsseldorf Löbau Zwenkau Weimar P. 19 P. 27 Dornburg Dresden P. 19 Gera P. 19 P. 7 P. 7 P. 7 Künzell P. 23 Frankfurt P. 23 Kindenheim P. 25 Ludwigshafen P. 25 Völklingen P. 25 Karlsruhe Stuttgart P. 21 P. 21 Ulm P. 21 Bauhaus institutions that maintain collections Modernist UNESCO World Heritage Sites Additional modernist sites 3 100 years of bauhaus The Bauhaus: an idea that has really caught on. Not just in Germany, but also worldwide. Functional design and modern construction have shaped an era. The dream of a Gesamtkunst- werk—a total work of art that synthesises fine and applied art, architecture and design, dance and theatre—continues to this day to provide impulses for our cultural creation and our living environments. The year 2019 marks the 100 th anniversary of the celebration, but the allure of an idea that transcends founding of the Bauhaus. Established in Weimar both time and borders. The centenary year is being in 1919, relocated to Dessau in 1925 and closed in marked by an extensive programme with a multitude Berlin under pressure from the National Socialists in of exhibitions and events about architecture 1933, the Bauhaus existed for only 14 years. -

Das Haus Der Badischen Heimat in Freiburg Und Seine Farbgebung
Das Haus der Badischen Heimat in Freiburg und seine Farbgebung Gerhard Kabierske Das Haus der Badischen Heimat zeigt sich seit kurzem in einem ungewohnten Kleid. Die an- nähernde Wiederherstellung der ursprünglichen Farbigkeit, wie sie der Architekt Carl Anton Meckel Mitte der Zwanziger Jahre als konstitutiven Bestandteil seiner Architektur verstanden hatte, war ein wichtiges Anliegen der gegenwärtig noch laufenden Sanierungsmaßnahmen, die der Landesverein mit beträchtlichem Aufwand betreibt. Der Beitrag beleuchtet den his- torischen Hintergrund dieser Farbgebung und den Kontext der damaligen Diskussionen, die bereits nach wenigen Jahren zu einem Umstreichen führten. Jedem Passanten in der Freiburger Hansja- die Putzfl ächen sind in dieser satten dun- kobstraße muss es auff allen: In den letzten kelroten Farbe gestrichen, sondern auch die Monaten hat sich das Erscheinungsbild des Fenstergewände. Dagegen erscheinen abge- Hauses der Badischen Heimat stark verändert. setzt in einem kontrastierenden kühlen Hell- Im Rahmen verschiedener Renovierungs- grau der Haussockel, der repräsentative säu- maßnahmen an diesem Gebäude – Münster- lenfl ankierte Portalvorbau sowie vor allem baumeisterin Yvonne Faller hat als verant- die rekonstruierten Klappläden der Fenster- wortliche Architektin bereits im letzten Heft reihe im Obergeschoss und an den einzelnen darüber berichtet – wurde auch am Äußeren Öff nungen der Giebelseiten. Die Haustüren, gearbeitet, das Dach neu gedeckt und die Fas- bislang die einzigen farbigen Akzente in ge- sade saniert.1 Dabei -

„Bücher, Bücher, Bücher, Bücher …“
„Bücher, Bücher, Bücher, Bücher …“ Wertvolle Autographen, Bücher, Graphik, Handschriften und Plakate Gemeinschaftskatalog der Antiquare 2010 veranstaltet von der Genossenschaft der Internet-Antiquare eG Geschäftsbedingungen: 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 Der Gemeinschaftskatalog der Antiquare 2009 wird BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt von der Genossenschaft der Internet-Antiquare eG die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der (GIAQ) herausgegeben, sie selbst bietet jedoch keine Sache. Der Widerruf ist an das jeweilige Antiquariat Waren zum Kauf an. Anbieter sind die jeweiligen zu richten. Die Adresse ist dem Kopf der jeweiligen Antiquariate, an die Bestellungen zu richten sind. Angebotsseiten im Katalog zu entnehmen. Kaufverträge kommen nur zwischen den einzel- nen Antiquariaten und den Käufern zustande, und Widerrufsfolgen: zwar dadurch, daß ein Antiquariat eine Bestellung Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider- annimmt und die Lieferung bestätigt oder die Ware seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren liefert. Für den Vertragsschluß und die Vertrags- und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus- abwicklung gelten die Geschäftsbedingungen des zugeben. Können Sie uns die empfangene Leis- jeweiligen Antiquariates. Soweit dort nichts anderes tung ganz oder teilweise nicht oder nur in ver- geregelt ist gelten folgende Grundsätze: schlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Das Angebot ist freibleibend, Lieferzwang besteht Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der nicht. Preise in € inkl. der gesetzlich gültigen MwSt. Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Der Versand erfolgt in der Reihenfolge der Bestel- Verschlechterung der Sache ausschließlich auf de- lungen und auf Kosten der Besteller. Die Ware bleibt ren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des an- möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. -

Karl Schuchardt – Leben Und Werk
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Abteilung für Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Nordwestdeutsche Kieferklinik) Direktor: Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzle Karl Schuchardt – Leben und Werk Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Zahnmedizin dem Fachbereich Medizin der Universität Hamburg vorgelegt von Silke Katharine Riemer aus Annaberg-Buchholz Hamburg 2001 angenommen von dem Fachbereich Medizin der Universität Hamburg am: 28.10.2002 gedruckt mit Genehmigung des Fachbereichs Medizin der Universität Hamburg Datum des Rigorosums: 06.03.2003 Dekan: Referent: Korreferent: Prof. Dr. C. Wagener Prof. Dr. Dr. G. Gehrke Prof. Dr. Dr. R. Schmelzle Prof. Dr. U. Weisser Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Abteilung für Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Nordwestdeutsche Kieferklinik) Direktor: Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzle Karl Schuchardt – Leben und Werk Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Zahnmedizin dem Fachbereich Medizin der Universität Hamburg vorgelegt von Silke Katharine Riemer aus Annaberg-Buchholz Hamburg 2001 2 Abb. 1. Fotografie Karl Schuchardts um 1950. 3 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 8 1.1 Themenstellung 8 1.2 Forschungsstand 9 1.3 Material und Methode 9 2. Lebensstationen, Werdegang und wissenschaftliche Karriere 12 von Karl Schuchardt 2.1 Tabellarische Übersicht 12 2.2 Persönlicher Werdegang 13 2.2.1 Zur Geschichte zahnheilkundlicher Berufsgruppen -

Bruno Taut Et La Gläserne Kette : Architecture D'émotion
Université Paris I Panthéon-Sorbonne UFR d’Arts Plastiques et Sciences de l’Art Master 1 Esthétique Adeline GASNIER BRUNO TAUT ET LA GLÄSERNE KETTE : ARCHITECTURE D'ÉMOTION Article de recherche préparé sous la direction de Monsieur Olivier SCHEFER Dans le cadre de son séminaire "Les Utopies" Mai 2011 Je remercie Monsieur Olivier Schefer, Maître de conférences en Esthétique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour la discussion à propos de cet article, ayant permis de clarifier certains points confus. Table des matières : Préambule p. 02 Introduction p. 03 I. Matériau inépuisable : le cristal p. 04 II. Un contexte écrasant p. 07 III. De l'art pour modéliser un nouvel ensemble p. 12 IV. Cristal astral, palais et cœur de verre p. 21 Conclusion p. 27 Bibliographie p. 28 Annexes (CD, "01.pdf") : Présentation de Bruno Taut p. 02 Présentation de Paul Scheerbart p. 02 Illustrations p. 03 CD joint : "Bruno Taut et la Gläserne Kette : architecture d'émotion" 01_BTGK.pdf + Annexes 01.pdf "Cosmic Incubadora : cristallisation émouvante" 02_CICE.pdf + Annexes 02.pdf "No Ghost, Just Someone? Les agents conversationnels" 03_NGJS.pdf + Annexes 03.pdf "Modèles émotionnels et agents conversationnels" 04_MEAC.pdf + Annexes 04.pdf PRÉAMBULE Ces quatre articles de recherche vont proposer d’ouvrir une amorce de réflexion sur les architectures de l’émotion1 ainsi que sur les processus de cristallisation (au sens large), en vue d’inscrire ces notions dans un contexte computationnel, ou plutôt, en vue de tenter de les y distinguer et de les comprendre. La -

Revista Der Querschnitt
REVISTA DER QUERSCHNITT 1924 Der Querschnitt, a. 4, no 2/3, Verão. Berlim: Galeria Simon e Flechtheim Capa: litografia por Picasso. 1o encarte entre pp. 100-101 – Fotografia, retrato, s.d. Legenda: “Raymond Radiguet”. Necrológio 1903-1923. – Reprodução de obra, pintura, 1897. Legenda: “Henri Rousseau. La bohémienne endormie [A cigana adormecida]”. Foto: Galeria Simon (seleção e clichê), Antuérpia. – Reprodução de obra, pintura, 1897. Legenda: “Pierre-Auguste Renoir. Am Meer [No mar]”. Foto: Barnes Foundation, Filadélfia (clichê de Paul Guillaume). – Fotografia, mobília, s.d. Legenda: “Pierre Roussel. [Pequena cômoda à Luís XV]”. 1723-178 Foto: Flatow & Priemer, Berlim. – Reprodução de obra, pintura, s.d. Legenda: “WandbiLd in der ViLLa Item bei Pompei. [MuraL na Villa Item em Pompeia]”, (helênico). Foto: Extraída de Ernst Pfhul. MaLerei und Zeichnung der Griechen [‟Pintura e desenho dos gregosˮ], s.d, F. Bruckmann A. G., Munique. – Fotografia, teatro, s.d. Legenda: “Marc Chagall. BühnenbiLd zu Agenten im jüdischen Kammertheater SchoLom Aleichum in Moskau. [Cenografia para Agenten [Agentes] no teatro de câmara judaico SchoLom Aleichum, Moscou]”. Foto: – – Fotografia, teatro, s.d. Legenda: “Bühnenbild zu Carl Sternheim Nebbich, Kammerspiele Rosen, Berlin. [Cenografia para Nebbich [Que pena], conhecida como Mops, de Carl Sternheim, Kammerspiele Rosen, Berlim]”. Foto: Zander & Labisch. 2o encarte entre pp. 116-117 2 – Reprodução de obra, pintura, s.d. Legenda: “Édouard Manet. Le père Lathuile [O pai Lathuile]”. Pastel. Foto: Galeria Flechtheim, Berlim. – Fotografia, automóvel, s.d. Legenda: “Sechssitziger Reise Phaëton. [Phäton de seis Lugares]”. Foto: Clichê Szawe. – Reprodução de obra, fototipia, s.d. Legenda: “Egon Schiele. StiLLeben [Natureza morta]”. Aquarela. Foto: Associação Wurble, Viena. – Fotografia, cinema, s.d. -
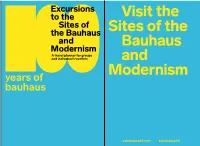
Excursions to the Sites of the Bauhaus and Modernism
Excursions to the Visit the Sites of the Bauhaus Sites of the and Bauhaus Modernism A travel planner for groups and individual travellers and Modernism ↘ bauhaus100.com # bauhaus100 The UNESCO- World Heritage Sites and the Sites of the Bauhaus and Modernism Hamburg P. 31 Celle Bernau P. 17 P. 29 Potsdam Berlin P. 13 Caputh P. 17 P. 17 Alfeld Luckenwalde Goslar Wittenberg P. 29 P. 17 Dessau P. 29 P. 10 Quedlinburg P. 10 Essen P. 10 P. 27 Krefeld Leipzig P. 27 P. 19 Düsseldorf Löbau Zwenkau Weimar P. 19 P. 27 Dornburg Dresden P. 19 Gera P. 19 P. 7 P. 7 P. 7 Künzell P. 23 Frankfurt P. 23 Kindenheim P. 25 Ludwigshafen P. 25 Völklingen P. 25 Karlsruhe Stuttgart P. 21 P. 21 Ulm P. 21 Bauhaus institutions that maintain collections The UNESCO-World Heritage Sites of Modernism Additional modernist sites 2 3 100 years of bauhaus The Bauhaus: an idea that has really caught on. Not just in Germany, but also worldwide. Functional design and modern construction have shaped an era. The dream of a Gesamtkunst- werk – a total work of art that synthesises fine and applied art, architecture and design, dance and theatre – continues to this day to provide impulses for our cultural creation and our living environments The year 2019 marks the 100th anniversary of the ion, but the allure of an idea that transcends both founding of the Bauhaus. Established in Weimar in time and borders. The centenary year is being mar- 1919, relocated to Dessau in 1925 and closed in Ber- ked by an extensive programme with a multitude of lin under pressure from the National Socialists in exhibitions and events about architecture and design, 1933, the Bauhaus existed for only 14 years.