Entwurf Des Erläuterungsberichtes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

April 1945 April 1945
3/11/2016 After Action April 1945 April 1945 SECRET HEADQUARTERS 5TH ARMORED DIVISION APO No 255 U.S. Army 17 April 1945 Auth: CG 5th Armd Div Initials: 319~1 GD.JG 8 May 1945. 1. Campaign: Battle of Germany. a. Personnel: Personnel Officers Enlisted Men Total Killed In Action 10 58 68 Seriously Wounded In Action 1 53 54 Lightly Wounded In Action 17 158 175 Seriously Injured In Action 1 2 3 Lightly Injured In Action 1 27 28 Missing In Action 0 8* 8 Total 30 306 336 (Four (4) of this number returned to duty the first few days in May) b. Vehicular: Type Destroyed or Abandoned Evacuated Car, Armored, Light, M8 2 Carrier, Pers, H/T 6 2 Tank, Med., w/75MM gun 7 8 Tank, Med., M4A1, w/76MM gun 6 6 Exploder, Mine, (Crab) 1 Trailer, Ammunition, M10 1 2 Truck, 1/4 ton, 4x4 10 22 Truck, 2 1/2-ton, 6x6, Cargo 5 1 Trailer, 1 Ton, Two wheel, Cargo 2 2 Vehicle, Tank, Recovery, M32 Series 1 http://www.5ad.org/04_45.html 1/29 3/11/2016 After Action April 1945 Gun, 57mm, M1, w/Carr., M1A3 1 Total 39 46 3. AMMUNITION EXPENDITURES AND LOSSES: Type Expended Loss Due to Enemy Action Carbine, Cal, .30 32,000 Cal, 30 646,000 146,500 Cal, 45 61,306 Cal, 50 182,373 60,780 37mm 3,122 1,878 57mm 386 60mm 212 81mm 340 75mm How 1,968 870 76mm Gun 1,776 406 90mm Gun 607 105mm Howitzer 21,994 105mm Gun 2,032 Grenades 1,698 344 Signal, Assorted 120 Rockets, AT 110 Total Tonnage 766.3 34.0 4. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -
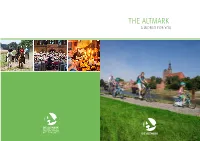
The Altmark. a World for You
THE ALTMARK A WORLD FOR YOU The Altmark – a world for you. Dear readers, Overview Active Map of the Altmark Washed with all waters | 20 Inside cover The Blue Belt in the Altmark Editorial | 01 Freedom now starts where it used to stop | 22 The Altmark – a world for you. The Green Belt – from deadly no man's land to paradise And if it were true …? | 02 Legends and truth in the Altmark tourist region The wonderful difficulty of having to decide | 24 Cycling in the Altmark Little Venice and the medieval beer rebels | 04 Towns and places in the Altmark On the film set of reality | 26 Magical hiking and riding in the Altmark Towns and places in the Altmark | 06 The Hanseatic League & contemporary witnesses of medieval prosperity DELIGHT The difference between liquid and solid gold | 28 Culture Beautiful views in Tangerhütte park Culinary specialities from the Altmark Where life blossoms eternally | 08 When the imperial couple enters Tangermünde … | 30 We would like to take you on a trip to the Altmark in the This brochure reveals to you all the variety the Altmark has Rich landscaped gardens and wide parks Folk festivals and Altmark gastronomy north of Saxony-Anhalt. On a journey into a world that to offer: so if you are looking for new inspiration for a city Scattered beauties | 10 is about the red bricks on the Romanesque Road, about trip, if you like hiking or cycling, if you enjoy concerts in Castles and manor houses in the Altmark magnificent Hanseatic towns and uniquely preserved nat- Romanesque churches, or if you are interested in history ural landscapes: in the glow of the sun, the blue of Arend- and want to walk in the footsteps of "Iron Chancellor" "See red" on the Romanesque Road | 12 The Altmark see Lake is dazzling and can be found in the Drömling Otto von Bismarck … then you will find exactly what you Churches, monasteries and the magic of bricks The Altmark's economy | 32 Biosphere Reserve in the diverse play of nature's colours. -

10 Dedelstorf Oerrel BB
Schülerströme Zone 12 Schülerströme Zone 13 Wohnort Ortsteil Schule Schulort Anzahl der SuS Wohnort Ortsteil Schule Schulort Anzahl der SuS 12 -> 10 Dedelstorf Oerrel BBS I Gifhorn 1 13->10 Wittingen Wittingen BBS I Gifhorn 7 BBS II Gifhorn 1 BBS II Gifhorn 4 HG Gifhorn 1 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn 1 Weddersehl BBS II Gifhorn 1 Knesebeck BBS I Gifhorn 4 Hankensbüttel Hankensbüttel BBS I Gifhorn 5 BBS II Gifhorn 2 BBS II Gifhorn 6 Oskar-Kämmer-Schule Gifhorn 1 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn 1 Rischbornschule Gifhorn 1 Emmen BBS II Gifhorn 1 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn 2 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Obernholz Obernholz BBS II Gifhorn 1 Außenstelle Gifhorn 2 Steinhorst Steinhorst BBS I Gifhorn 2 Schneflingen BBS I Gifhorn 1 BBS II Gifhorn 1 Kakerbeck BBS I Gifhorn 1 Vorhop BBS II Gifhorn 1 12 -> 11 Dedelstorf Lingwedel GS Wahrenholz Wahrenholz 1 Radenbeck OHG Gifhorn 2 Dedelstorf OBS Wesendorf Wesendorf 1 GS Hankensbüttel Hankensbüttel 7 13->11 Wittingen Knesebeck OBS Wesendorf Wesendorf 5 Hankensbüttel Hankensbüttel OBS Wesendorf Wesendorf 6 Vorhop OBS Wesendorf Wesendorf 4 Sprakensehl Hagen OBS Wesendorf Wesendorf 1 Wittingen OBS Wesendorf Wesendorf 3 Steinhorst Steinhorst OBS Wesendorf Wesendorf 3 13->12 Wittingen Boitzenhagen Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 4 12->12 Dedelstorf Allersehl GS Hankensbüttel Hankensbüttel 3 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 1 Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 2 Darringsdorf Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 6 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 1 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 2 Langwedel GS Hankensbüttel Hankensbüttel 4 Erpsen Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 1 Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 3 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 1 Oerrel GS Hankensbüttel Hankensbüttel 11 Eutzen Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 2 Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 10 Gannerwinkel Gymn. -

Bekanntmachung Der Stadt Wittingen
Bekanntmachung der Stadt Wittingen Bildung von Wahlbezirken und Wahlvorständen In der Stadt Wittingen sind gem. § 12 Abs. 1 Europawahlordnung (EuWO) 21 Wahlbezirke gebildet. Sie sind räumlich wie folgt gegliedert: O r t s c h a f t W i t t i n g e n Wittingen I Alle Straßen nördlich der Bahnhofstr. / Celler Str. (einschließlich Bahnhofstr. / Celler Str.), östlich abgegrenzt durch die Straßen Hindenburgwall / Dammstr. / Uelzener Str. (ausschließlich Hindenburgwall / Dammstr. / Uelzener Str.) und alle Straßen südlich der Bahnhofstr. / Celler Str., südlich abgegrenzt durch die Spörkenstr. / Knesebecker Str. (ausschließlich Spörkenstr. / Knesebecker Str.) Wittingen II Alle Straßen östlich der Dammstr. / Uelzener Str. (einschließlich Dammstr. / Uelzener Str.), südlich abgegrenzt durch die Straßen Hindenburgwall / Ernst-Stackmann-Str. / Salzwedeler Str. (ausschließlich Hindenburgwall / Ernst-Stackmann-Str. / Salzwedeler Str.) Wittingen III Alle Straßen südlich der Straßen Spörkenstr. / Hindenburgwall / Ernst-Stackmann-Str. / Salzwedeler Str. (einschließlich Spörkenstr. / Hindenburgwall / Ernst-Stackmann-Str. / Salzwedeler Str.), O r t s c h a f t K n e s e b e c k Knesebeck „Nord“ Alle Straßen nördlich der Gifhorner Str. und Marktstr. (einschließlich Gifhorner Str. und Marktstr.). Knesebeck „Süd“ Alle Straßen südlich der Gifhorner Str. und Marktstr. (ausschließlich Gifhorner Str. und Marktstr.) D i e O r t s c h a f t e n Boitzenhagen, Darrigsdorf / Wollerstorf, Erpensen, Eutzen / Wunderbüttel, Gannerwinkel, Glüsingen, Hagen / Mahnburg, Kakerbeck / Suderwittingen, Lüben, Ohrdorf, Rade, Radenbeck, Schneflingen / Teschendorf / Küstorf, Stöcken, Vorhop, Zasenbeck / Plastau bilden je einen Wahlbezirk. 2 Für jeden Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand berufen. Diesem gehören neben der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher, ihrem / seinem Stellvertreter noch weitere 3 bis 7 Mitglieder an. -

Landfrauen Programm 2017 Vorträge - Seminare - Fahrten Für Alle Frauen Auf Dem Land Vorwort
www.landfrauen-wittingen.de LandFrauen Programm 2017 Vorträge - Seminare - Fahrten für alle Frauen auf dem Land Vorwort Liebe LandFrauen, liebe interessierte Frauen auf dem Lande, mit diesem Heft stellen wir unsere Aktivitäten vor und wünschen Ihnen beim Durchstöbern viel Freude. Sind Sie gespannt? Dann blättern Sie ruhig darin und informieren sich über unser vielseitiges abwechslungsreiches Programm, das wir für sie zusammengestellt haben. Das bieten wir: - nette Leute kennenlernen - Tradition bewahren und offen sein für alles Neue - das Leben im Umfeld mitgestalten - Fahrten, Fahrradtouren, Wanderungen als Abwechslung vom Alltag - in Gemeinschaft kreativ sein Wir laden Sie zu unseren Veranstaltungen auf‘s herzlichste ein und freuen uns auf Sie. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Ihr Vorstandsteam vom LandFrauenVerein Wittingen 2 Pinnwand IN ZUSAMMENARBEIT MIT Das köstlichste Gut, das ein vernünftiger Mensch besitzt, ist seine freie Zeit. Paul Ernst DER LFV-VORSTAND 3 Das Programm Eine Einführung unserer Veranstaltungen Wir sind eine Gemeinschaft von Frauen jeden Alters, aus allen Be- rufen und Lebenssituationen, parteipolitisch unabhöngig und über- konfessionell. Unser Verein ist mit ca. 500 Mitgliedern die größte Frauenvereinigung in unserer Region. Einmal im Monat treffen wir uns montags im St. Stephanus-Ge- meindehaus Wittingen. Eine nette Runde erwartet Sie zu Themen in allen Lebensbereichen. Erleben Sie im LandFrauenverein Wittingen Fachvorträge, Lesun- gen, Seminare, praktische Kurse, Ausflüge und Besichtigungsfahr- ten und versuchen Sie mit uns das Arbeiten mit Beton oder halten sich mit uns fit durch Aquajogging. Auch das gesellige Beisammensein kommt dabei nicht zu kurz. Im März treffen wir uns an einem Samstagvormittag zu unserem beliebten Frauenfrühstück in der Stadthalle Wittingen. Wir beteiligen uns in diesem Jahr am Sommerfest des HGV der Stadt Wittingen mit dem von uns organisierten sog. -

Maneuver Center of Excellence (Mcoe) Libraries Mcoe HQ Donovan Research Library Fort Benning, Georgia
Maneuver Center of Excellence (MCoE) Libraries MCoE HQ Donovan Research Library Fort Benning, Georgia Report date: August 1944 – April 1945 Title: After Action Report, United States Army 5th Armored Division Abstract: U.S. Army 5th Armored Division After Action Report from August 1944 to April 1945 in the European Theater of Operations to include narratives and journals. Number of pages: 159 (some pages from the original document are not legible) Notes: The Armor Library historical documents collection is located at the MCoE HQ Donovan Research Library, Fort Benning, GA. Document#: 805 AD 402 Classification: Unclassified; Approved for public release IWMP~UI Sr £t~f 191 B t.- . 1 AFi.. AGTI0ij R1CIT .7 -WD- D I riSIUT 'I UjUT 44 TLU ALIL 45 4 V I3ocC ......T T.iSJHz A KJPSR. iTY r c? ,x iD S .k ._.9 .. R J J K.'D A £, 1 0 , 3-2. IFW'-lD JL-,1' VZ-,I SZQTA9I, -I. C,.E DIVI a Ki"" T-5,T-L72. w - Av. rI. -R S -- fib SECRET J / *1- REPORT AFTER ACTTOl" AGAINST ENEIT AUGUST 1944 HU DQUARTERS 5TH AR.ORf) DIVISION CONTENTS Pbara*t 1. Campaign 1 2. 1oa6s In Action 1-2 Jkpanditures a0d Lossos awmmition 2 4. Qpur. aders 2 - 2 5. 0 Ommenta - 21 6. a:1I 7 s 1o DEC 26 ~# hotI a ~14 *"4Jour gi '4 -- ~~y-r'~c S EQ tT5S '9 The following image(s) may be of poor quality due to the poor quality of the original. S 2 .L *Dats 13 Nov 44 .. .. ssss sss~sss : :s : 46 13 Niovember 1944. -

Radwegeentwicklungsko
RADWEGEENTWICKLUNGSKONZEPT STADT WITTINGEN Zwischenbericht / Version 4 / 28.02.2021 Stadt Wittingen, Abteilung Kultur, Sport und Tourismus - Radwegeentwicklungskonzept 1 ASPEKTE Geschichte/Attraktion/Thema/Aktivität Beschilderung/Wegebeschreibungen Tourismus / Radtouren / Freizeit Handlungsbedarf/Maßnahmen Vernetzung Verbindung zu Arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen, Behörden und Einkauf Alltagsradverkehr Möglichst naheliegende, sichere, schnelle Verbindungen •Beschilderung / Verkehrsführung / Wegezustand • Vernetzung Lokal / regional Interessen- und Entscheidungsebene Überregional Stadt Wittingen, Abteilung Kultur, Sport und Tourismus - Radwegeentwicklungskonzept 2 CLUSTER 1 - „Wittingen-Ost“ Boitzenhagen, Küstorf,, Ohrdorf, Plastau, Radenbeck, Schneflingen, Teschendorf, Zasenbeck Stadt Wittingen, Abteilung Kultur, Sport und Tourismus - Radwegeentwicklungskonzept 3 RÜCKMELDUNGEN – CLUSTER 1 Interesse an Vorschläge davon lokale / davon Mitwirkung regionale Ebene überregionale Ebene Bürger 6 7 4 3 Vereine 1 6 3 3 Ortsvorsteher 4 9 5 4 Unternehmen 1 0 0 0 Summe 12 22 12 10 Stadt Wittingen, Abteilung Kultur, Sport und Tourismus - Radwegeentwicklungskonzept 4 Auswahl von Rückmeldungen / lokale Ebene Wege / Infrastruktur / Beschilderung Nutzung der OHE – Trasse als Radweg OHE – Trasse nicht als Radweg nutzen Benchmark mit Wegenetz in der Altmark Wege neue befestigen und anlegen (Alter Postweg) Beschilderung verbessern Zustand von Rastplätzen und Hinweisschildern teilweise mangelhaft Zustand und Ausweisung verschiedener Wege im Raum -

Und Gemeindeliste
Kirchengemeinde Ort Kirchengemeinde Ort Almke Almke Hasenwinkel Uhry Brome-Tülau Altendorf Hattorf Hattorf Brome-Tülau Benitz Hehlingen Hehlingen Brome-Tülau Brome Heiligendorf Barnstorf Brome-Tülau Croya Heiligendorf Heiligendorf Brome-Tülau Kaiserwinkel Heiligendorf Waldhof Brome-Tülau Tülau Jembke Barwedel Brome-Tülau Voitze Jembke Bokensdorf Brome-Tülau Wiswedel Jembke Hoitlingen Darrigsdorf Darrigsdorf Jembke Jembke Darrigsdorf Glüsingen Jembke Tiddische Darrigsdorf Hahnenberg Knesebeck Eutzen Ehmen Ehmen Knesebeck Friedrichsmühle Ehra Boitzenhagen Knesebeck Knesebeck Ehra Ehra Knesebeck Schönewörde Ehra Lessien Knesebeck Transvaal Fallerleben Fallersleben Knesebeck Vorhop Fallerleben Ilkerbruch Knesebeck Weißes Moor Fallerleben Sandkamp Mörse Mörse Groß Oesingen Groß Oesingen Neindorf Neindorf Groß Oesingen Klein Oesingen Ohrdorf Küstorf Groß Oesingen Schmarloh Ohrdorf Ohrdorf Groß Oesingen Texas Ohrdorf Schneflingen Groß Oesingen Zahrenholz Ohrdorf Teschendorf Hankensbüttel Alt-Isenhagen Sprakensehl Behren Hankensbüttel Bottendorf Sprakensehl Blickwedel Hankensbüttel Dedelsdorf Sprakensehl Bokel Hankensbüttel Emmen Sprakensehl Breitenhees Hankensbüttel Hankensbüttel Sprakensehl Hagen Hankensbüttel Langwedel Sprakensehl Sprakensehl Hankensbüttel Lingwedel Steinhorst Auermühle Hankensbüttel Masel Steinhorst Im Reinhorn Hankensbüttel Obernholz Steinhorst Lüsche Hankensbüttel Oerrel Steinhorst Räderloh Hankensbüttel Repke Steinhorst Steinhorst Hankensbüttel Schweimke Sülfeld Sülfeld Hankensbüttel Steimke Wettmershagen Allenbüttel Hankensbüttel -

Landfrauenprogramm 2015
www.landfrauen-wittingen.de LandFrauenprogramm 2015 Vorträge - Seminare - Pflege der Gemeinschaft für alle Frauen auf dem Land Vorwort Liebe LandFrauen, liebe interessierte Frauen auf dem Land, mit diesem Heft präsentieren wir Ihnen wieder interessante Aktionen, kulturelle Veranstaltungen wie Theater- und Kinobesuche, Bildungsreisen, Ausflüge, Fahrradtouren - kurz gesagt, unser neues Programm 2015. Sind Sie gespannt? Dann blättern Sie ruhig darin und informieren sich über unser vielseitiges abwechslungsreiches Programm, dass wir, der Vorstand und alle Ortsvertrauensfrauen, für Sie zusammengestellt haben. Wir möchten Sie mit unseren Vorträgen, Reisen und Seminaren be- geistern und anregen, viele neue Begegnungen und Erlebnisse zu sammeln. Sehen wir uns bei den LandFrauen? Ich würde mich riesig darüber freuen! Übrigens: Gäste sind jederzeit herzlich willkommen, einmal bei uns vorbei zu schauen. Die Liste der Ansprechpartnerinnen in den einzelnen Orten finden Sie in diesem Heft. Ihre Dörte Dreblow - im Namen des Vorstandes - 2 Pinnwand IN ZUSAMMENARBEIT MIT Um große Dinge zu erreichen, müssen wir nicht nur handeln, sondern auch träumen, nicht nur planen, sondern auch glauben. (Anatole France) DER LFV-VORSTAND 3 Das Programm Eine Einführung unserer Veranstaltungen Einmal im Monat treffen wir uns montags im St. Stephanus-Ge- meindehaus Wittingen zu einem geselligen Beisammensein. Wir veranstalten z.B. Vorträge, Lesungen, versuchen uns u.a. mit dem Basteln von Drahthühnern oder halten uns fit durch Yoga oder Jogging. Außerdem organisieren wir Besichtigungen in Städten, in Museen oder bei Firmen in der näheren und manchmal auch weiteren Umgebung. Dabei sind wir nicht nur mit dem Bus unterwegs, nein, auch das Fahrrad wird zur Erkundung eingesetzt. Alle zwei Jahre findet der traditionelle und liebgewonnene Klön- nachmittag auf den Dörfern statt. -

Materialband ILEK Für Den Landkreis Gifhorn
Materialband ILEK für den Landkreis Gifhorn Sammlung der Projektsteckbriefe Projektsteckbriefe des Handlungsfeldes Wirtschaft, Infrastruktur W 1 Entwicklung von Gewerbestandorten W 1.1 Gewerbeflächenentwicklungskonzept Darstellung des Projektansatzes (Auszug aus dem Protokoll der Projektgruppensitzung Interkommunale Zusammenarbeit am 23.04.2007) „Übereinstimmend wurde festgestellt, dass eine gemeinsame Gewerbegebietsausweisung benachbarter Komm. Gebietskörperschaften durchaus sinnvoll ist. Gleichermaßen wurde aber realistisch dargelegt, dass für das Gebiet des LK GF – unabhängig von der Art der Zusammenarbeit – nicht mit erheblichen Zuwächsen bei der gewerblichen Ansiedlung zu rechnen ist. Vielmehr muss darauf geachtet werden, bestehende und vorhandene Potenziale zu schützen und auszubauen. Für eine evt. Ansiedlung ist eine umfassende Bedarfsplanung und ein Entwicklungskonzept erforderlich. Ziel muss es insbesondere sein, gewerbliche Betriebe aus dem Umkreis anzusiedeln.“ Die Stadt Wittingen hat ebenfalls den Projekttitel Erarbeitung eines Gewerbeentwicklungskonzeptes genannt. Nähere Angaben liegen nicht vor. W 1.2 Entwicklung einzelner Standorte W 1.2.1 Schaffung eines Rastplatzes an der BAB 39 Darstellung des Projektansatzes (Auszug aus dem Protokoll der Projektgruppensitzung Interkommunale Zusammenarbeit am 23.04.2007) „Ein solcher könnte als attraktive Anlage (interkommunal) einerseits für den Tourismus (Hotel) aber auch für das heimische Gewerbe, bzw. mit Unterstützung durch das heimische Gewerbe (Verkauf von Bioprodukten) gestaltet -
ISEK Stadt Wittingen Und Vorbereitende Untersuchungen Innenstadt Wittingen Und Innerörtlicher Versorgungsbereich Knesebeck
ISEK Stadt Wittingen und Vorbereitende Untersuchungen Innenstadt Wittingen und innerörtlicher Versorgungsbereich Knesebeck Auftaktveranstaltung, 20.10.2016 ABLAUF 2 18:00 - 18:10 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Gäste 10 Min. Bürgermeister Karl Ridder 18:10 - 18:45 Uhr Einführungsvortrag 35 Min. Ackers Partner Städtebau Arbeitsweise Planerische Grundlagen Erste Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Analyse Erste Ziele und Fragen Verfahrensablauf / vorläufige Terminschiene 18:45 - 19:35 Uhr Arbeiten in Gruppen 50 Min. Sammlung und Bewertung von Stärken, Schwächen und ersten Zielen Paralleles Arbeiten in Gruppen an Tischen 19:35 - 19:55 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse 20 Min. Vortrag der Ergebnisse aus den Gruppen durch jeweils einen Vertreter der Arbeitsgruppen und abschließende Diskussion 19:55 - 20:00 Uhr Ausblick und Schlusswort 5 Min. Günter Kruse, Amtsleiter Amt für Wirtschaft, Sport und Kultur Integration - sucht nach der Eigenart - denkt in Zusammenhängen - formt das Gemeinsame Darrigsdorf 4 Fragenfür die Arbeit in Gruppen Wie sehen Sie Ihre Stadt? Welche Bedeutung haben Freizeitmöglichkeiten und Landschaft für Sie? Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von Wittingen? Lange Straße, Innenstadt Wittingen 5 Ganzheitliche Betrachtung: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Langfristige Perspektiven und Potentiale analysieren und aufzeigen Konzept: Analyse Ziele und Leitbild Maßnahmen und Projekte Ausarbeitung Beschluss Städtebauliche Vertiefung 6 Vertiefende Betrachtung: Vorbereitende Untersuchungen Innenstadt Wittingen und innerörtlicher