Chronik Jübar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

April 1945 April 1945
3/11/2016 After Action April 1945 April 1945 SECRET HEADQUARTERS 5TH ARMORED DIVISION APO No 255 U.S. Army 17 April 1945 Auth: CG 5th Armd Div Initials: 319~1 GD.JG 8 May 1945. 1. Campaign: Battle of Germany. a. Personnel: Personnel Officers Enlisted Men Total Killed In Action 10 58 68 Seriously Wounded In Action 1 53 54 Lightly Wounded In Action 17 158 175 Seriously Injured In Action 1 2 3 Lightly Injured In Action 1 27 28 Missing In Action 0 8* 8 Total 30 306 336 (Four (4) of this number returned to duty the first few days in May) b. Vehicular: Type Destroyed or Abandoned Evacuated Car, Armored, Light, M8 2 Carrier, Pers, H/T 6 2 Tank, Med., w/75MM gun 7 8 Tank, Med., M4A1, w/76MM gun 6 6 Exploder, Mine, (Crab) 1 Trailer, Ammunition, M10 1 2 Truck, 1/4 ton, 4x4 10 22 Truck, 2 1/2-ton, 6x6, Cargo 5 1 Trailer, 1 Ton, Two wheel, Cargo 2 2 Vehicle, Tank, Recovery, M32 Series 1 http://www.5ad.org/04_45.html 1/29 3/11/2016 After Action April 1945 Gun, 57mm, M1, w/Carr., M1A3 1 Total 39 46 3. AMMUNITION EXPENDITURES AND LOSSES: Type Expended Loss Due to Enemy Action Carbine, Cal, .30 32,000 Cal, 30 646,000 146,500 Cal, 45 61,306 Cal, 50 182,373 60,780 37mm 3,122 1,878 57mm 386 60mm 212 81mm 340 75mm How 1,968 870 76mm Gun 1,776 406 90mm Gun 607 105mm Howitzer 21,994 105mm Gun 2,032 Grenades 1,698 344 Signal, Assorted 120 Rockets, AT 110 Total Tonnage 766.3 34.0 4. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

Satzung Rettungsdienstbereichsplan Altmarkkreis Salzwedel 2,01 MB
Altmarkkreis Salzwedel Der Landrat Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Präambel Seite 3 I. Geltungsbereich, Inhalt, Trägerschaft und Grundsätze der Versorgungsplanung Seite 3 - 5 § 1 Geltungsbereich / Inhalt Seite 3 § 2 Träger des Rettungsdienstes / Grundsätze der Versorgungsplanung Seite 4 - 5 II. Versorgungsziele und Einsatzgrundsätze Seite 5 - 8 § 3 Notfallrettung Seite 5 § 4 Qualifizierte Patientenbeförderung Seite 5 - 6 § 5 Personelle Besetzung und Ausstattung der Rettungsmittel Seite 6 - 7 § 6 Rettungswachenstandorte und Versorgungsbereiche Seite 7 § 7 Bedarfsgerechte Rettungsmittelausstattung / Vorhaltezeit Seite 8 III. Sonstiges Seite 9 - 14 § 8 Bereichsübergreifender Rettungsdienst Seite 9 § 9 Integrierte Einsatzleitstelle Altmark (ILS Altmark) Seite 10 § 10 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Seite 10 § 11 Ereignisse mit einer großen Anzahl verletzter oder erkrankter Personen (MANV) Seite 10 - 12 § 12 Mitwirkung im Katastrophenschutz Seite 12 § 13 Maßnahmen der Qualitätssicherung Seite 12 - 13 § 14 Bereichsbeirat Seite 13 § 15 Konzessionierung Seite 14 § 16 Inkrafttreten Seite 14 Anlagen: Anlage 1: Notarztversorgungsbereiche Altmarkkreis Salzwedel (Liste) Anlage 2: Kartographische Darstellung Notarztversorgungsbereiche Anlage 3: Rettungswachenversorgungsbereiche Altmarkkreis Salzwedel (Liste) Anlage 4: Kartographische Darstellung der Rettungswachenversorgungsbereiche Abkürzungsverzeichnis -

Steckbrief Altmarkkreis Salzwedel
NETZWERKE WASSER 2.0 STECKBRIEF ALTMARKKREIS SALZWEDEL KURZINFORMATION Bevölkerung (Stand 30.06.2016) 85.664 Fläche (Stand: 31.12.2016) 2.293 km² davon Landwirtschaftsfläche 1.255 km² davon Ackerland 937 km² (Stand: 2016) davon Grünland 318 km² (Stand: 2016) Nutzbare 25,03 Mio Grundwasserdargebotsreserve m³/a* Genehmigte Mengen zu 6,7 Mio Beregnungszwecken m³/a (Stand: 05.08.2019) * Aus den aufgeführten Angaben lassen sich keine Entscheidungen über örtlich und zeitlich konkrete Entnahmemengen ableiten. Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (STALA) 2017; Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW); Altmarkkreis Salzwedel GEOGRAPHIE UND BÖDEN Der Altmarkkreis Salzwedel umfasst eine Fläche von 2.293 km² und liegt im Nordwesten Sachsen-Anhalts an der Grenze zu Niedersachsen. In der Norddeutschen Tiefebene gelegen durchfließen als größte Flüsse Jeetze und Milde den Landkreis. Im Süden, Osten und äußersten Norden des Landkreises prägen Urstromtäler und Niederungen die Landschaft. In ihren Senken charakterisieren fluviatile Ablagerungen die Böden und ermöglichen ein hohes Wasserspeichervermögen – ähnlich dem der Moore, die die Urstromtäler im nördlichen Teil bedecken. Zu ihnen gehört auch das Naturschutzgebiet Ohre-Dröm- ling im Westen, das an den niedersächs- ischen Landkreis Gifhorn angrenzt. Zwischen der Bodenlandschaft der Urstromtäler liegen im südlichen Teil Endmoränen mit sandigen Podsol-Böden, während im nördlichen Bereich lehmige Gley- und Braunerde-Böden der Grundmoränenplatten vorzufinden sind. -
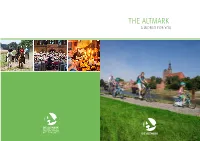
The Altmark. a World for You
THE ALTMARK A WORLD FOR YOU The Altmark – a world for you. Dear readers, Overview Active Map of the Altmark Washed with all waters | 20 Inside cover The Blue Belt in the Altmark Editorial | 01 Freedom now starts where it used to stop | 22 The Altmark – a world for you. The Green Belt – from deadly no man's land to paradise And if it were true …? | 02 Legends and truth in the Altmark tourist region The wonderful difficulty of having to decide | 24 Cycling in the Altmark Little Venice and the medieval beer rebels | 04 Towns and places in the Altmark On the film set of reality | 26 Magical hiking and riding in the Altmark Towns and places in the Altmark | 06 The Hanseatic League & contemporary witnesses of medieval prosperity DELIGHT The difference between liquid and solid gold | 28 Culture Beautiful views in Tangerhütte park Culinary specialities from the Altmark Where life blossoms eternally | 08 When the imperial couple enters Tangermünde … | 30 We would like to take you on a trip to the Altmark in the This brochure reveals to you all the variety the Altmark has Rich landscaped gardens and wide parks Folk festivals and Altmark gastronomy north of Saxony-Anhalt. On a journey into a world that to offer: so if you are looking for new inspiration for a city Scattered beauties | 10 is about the red bricks on the Romanesque Road, about trip, if you like hiking or cycling, if you enjoy concerts in Castles and manor houses in the Altmark magnificent Hanseatic towns and uniquely preserved nat- Romanesque churches, or if you are interested in history ural landscapes: in the glow of the sun, the blue of Arend- and want to walk in the footsteps of "Iron Chancellor" "See red" on the Romanesque Road | 12 The Altmark see Lake is dazzling and can be found in the Drömling Otto von Bismarck … then you will find exactly what you Churches, monasteries and the magic of bricks The Altmark's economy | 32 Biosphere Reserve in the diverse play of nature's colours. -

Flyer Wirtschaft Im Altmarkkreis Salzwedel 0,72 MB
Kontakt: Wirtschafts- und Gründerpreis Ihre Ansprechpartner vor Ort: sowie Existenzgründungsberatungen: Altmarkkreis Salzwedel Herausgeber Unternehmerische Exzellenz wird seit 2003 mit dem Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel | Der Landrat Wirtschaftspreis Altmark prämiert. Seither erfolgt jährlich Sachgebiet Wirtschaftsförderung/Tourismus Karl-Marx-Straße 32 | 29410 Hansestadt Salzwedel Wirtschaft T 03901 840 0 eine Preisverleihung in den Kategorien Verarbeitendes Karl-Marx-Straße 32 | 29410 Hansestadt Salzwedel [email protected] Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleis- T 03901 840 260 | [email protected] www.altmarkkreis-salzwedel.de tung. Mehr als 350 altmärkische Unternehmen haben Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) sich seit 2003 um diesen Preis beworben. Wirtschaftsförderung Bürgermeister Norman Klebe Altmarkkreis Salzwedel | Amt für Kreisentwicklung | Büro des Landrates Am Markt 3 | 39619 Arendsee Wirtschaftsförderung | Tourismus | Ländliche Entwicklung Aufstrebende Jungunternehmen können seit 2006 den T 039384 97 60 | [email protected] altmarkkreis-salzwedel.de Karl-Marx-Straße 32 | 29410 Hansestadt Salzwedel Existenzgründerpreis Altmark gewinnen. Prämiert T 03901 840 260 | F 03901 840 208 werden dabei Unternehmen, die mit ihren Produkten Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf [email protected] www.altmarkkreis-salzwedel.de und Dienstleistungen, mit wirtschaftlicher Kompetenz, Verbandsgemeindebürgermeister Michael Olms Verlässlichkeit und Ideenreichtum -

10 Dedelstorf Oerrel BB
Schülerströme Zone 12 Schülerströme Zone 13 Wohnort Ortsteil Schule Schulort Anzahl der SuS Wohnort Ortsteil Schule Schulort Anzahl der SuS 12 -> 10 Dedelstorf Oerrel BBS I Gifhorn 1 13->10 Wittingen Wittingen BBS I Gifhorn 7 BBS II Gifhorn 1 BBS II Gifhorn 4 HG Gifhorn 1 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn 1 Weddersehl BBS II Gifhorn 1 Knesebeck BBS I Gifhorn 4 Hankensbüttel Hankensbüttel BBS I Gifhorn 5 BBS II Gifhorn 2 BBS II Gifhorn 6 Oskar-Kämmer-Schule Gifhorn 1 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn 1 Rischbornschule Gifhorn 1 Emmen BBS II Gifhorn 1 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn 2 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Obernholz Obernholz BBS II Gifhorn 1 Außenstelle Gifhorn 2 Steinhorst Steinhorst BBS I Gifhorn 2 Schneflingen BBS I Gifhorn 1 BBS II Gifhorn 1 Kakerbeck BBS I Gifhorn 1 Vorhop BBS II Gifhorn 1 12 -> 11 Dedelstorf Lingwedel GS Wahrenholz Wahrenholz 1 Radenbeck OHG Gifhorn 2 Dedelstorf OBS Wesendorf Wesendorf 1 GS Hankensbüttel Hankensbüttel 7 13->11 Wittingen Knesebeck OBS Wesendorf Wesendorf 5 Hankensbüttel Hankensbüttel OBS Wesendorf Wesendorf 6 Vorhop OBS Wesendorf Wesendorf 4 Sprakensehl Hagen OBS Wesendorf Wesendorf 1 Wittingen OBS Wesendorf Wesendorf 3 Steinhorst Steinhorst OBS Wesendorf Wesendorf 3 13->12 Wittingen Boitzenhagen Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 4 12->12 Dedelstorf Allersehl GS Hankensbüttel Hankensbüttel 3 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 1 Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 2 Darringsdorf Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 6 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 1 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 2 Langwedel GS Hankensbüttel Hankensbüttel 4 Erpsen Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 1 Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 3 HS Hankensbüttel Hankensbüttel 1 Oerrel GS Hankensbüttel Hankensbüttel 11 Eutzen Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 2 Gymn. Hankensbüttel Hankensbüttel 10 Gannerwinkel Gymn. -

Ausbildungsbetriebe in Der Agrarwirtschaft Im Altmarkkreis Salzwedel
Ausbildungsbetriebe in der Agrarwirtschaft im Altmarkkreis Salzwedel Auskünfte und Ausbildungsberatung im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25 39576 Stendal Ansprechpartner: Frau Seehaus 03931 / 633 611 oder Herr Damker 03931 / 633 610 Kennzeichnung der Betriebszweige: Pflanzenproduktion: Tierproduktion: 1 = Getreidebau 1 = Milchviehhaltung 2 = Zuckerrübenbau 2 = Rinderaufzucht o. Rindermast 3 = Kartoffelbau 3 = Sauenhaltung u. Ferkelerzeugung 4 = Körnermaisbau 4 = Schweineaufzucht o. Schweinemast 5 = Ölfrüchtebau 5 = Legehennenhaltung 6 = Hülsenfrüchtebau 6 = Geflügelaufzucht o. Geflügelmast 7 = Ackerfutterbau 7 = Schafhaltung 8 = Grünland o. Ackergras 8 = Pferdehaltung 9 = Waldbau Betriebszweige Betrieb Besonderheiten Unterkunft Ansprechpartner/ Ausbilder, Tel. E-Mail Adresse Plätze Plätze anerkannt Landwirt Agrarerzeugergemeinschaft Abbendorf e. G. 2 PP 1,2,5,8 nein Hohenböddenstedter Str. 13 TP 1,2 29413 Diesdorf OT Abbendorf Herr Jacobs 03902/242 [email protected] Milchhof GmbH und Co.KG 1 PP 1,4,5,7,8 Altensalzwedel 64 TP 1,2 nein 38486 Apenburg - Winterfeld Herr Rohloff/ Frau Busse 039035/239 [email protected] Jürges GbR Dorfstraße 2 1 PP 1,2,5,8 nein 38486 Klein Apenburg TP 1,2 Herr Jürges 0175/4622282 039001/63091 [email protected] Rindergut Apenburg Paul- Werner von der Schulenburg 1 PP 1,3,4,6,7,8 ja Hinterstr. 6 TP 2 38486 Apenburg-Winterfeld Naturland- Betrieb Herr v. d. Schulenburg/ Herr Warlich Ausbildungskooperation 039001/ 63009 [email protected] Betriebszweige Betrieb Besonderheiten Unterkunft Ansprechpartner/ Ausbilder, Tel. E-Mail Adresse Plätze Plätze anerkannt Landwirtschaftlicher Betrieb PP 1, 4, 5, 7, 8 ja Jens Doose TP 1, 2 Recklinger Str. 18 38486 Apenburg - Winterfeld Herr Doose 039009/50427 [email protected] Landwirtschaftsgesellschaft Arendsee GmbH 2 PP 1,5,8 nein Hasenwinkel 1 TP 1,2 39619 Arendsee Herr Lehmann 039384/2310 o. -

Filming the End of the Holocaust War, Culture and Society
Filming the End of the Holocaust War, Culture and Society Series Editor: Stephen McVeigh, Associate Professor, Swansea University, UK Editorial Board: Paul Preston LSE, UK Joanna Bourke Birkbeck, University of London, UK Debra Kelly University of Westminster, UK Patricia Rae Queen’s University, Ontario, Canada James J. Weingartner Southern Illimois University, USA (Emeritus) Kurt Piehler Florida State University, USA Ian Scott University of Manchester, UK War, Culture and Society is a multi- and interdisciplinary series which encourages the parallel and complementary military, historical and sociocultural investigation of 20th- and 21st-century war and conflict. Published: The British Imperial Army in the Middle East, James Kitchen (2014) The Testimonies of Indian Soldiers and the Two World Wars, Gajendra Singh (2014) South Africa’s “Border War,” Gary Baines (2014) Forthcoming: Cultural Responses to Occupation in Japan, Adam Broinowski (2015) 9/11 and the American Western, Stephen McVeigh (2015) Jewish Volunteers, the International Brigades and the Spanish Civil War, Gerben Zaagsma (2015) Military Law, the State, and Citizenship in the Modern Age, Gerard Oram (2015) The Japanese Comfort Women and Sexual Slavery During the China and Pacific Wars, Caroline Norma (2015) The Lost Cause of the Confederacy and American Civil War Memory, David J. Anderson (2015) Filming the End of the Holocaust Allied Documentaries, Nuremberg and the Liberation of the Concentration Camps John J. Michalczyk Bloomsbury Academic An Imprint of Bloomsbury Publishing Plc LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury Publishing Plc 50 Bedford Square 1385 Broadway London New York WC1B 3DP NY 10018 UK USA www.bloomsbury.com BLOOMSBURY and the Diana logo are trademarks of Bloomsbury Publishing Plc First published 2014 Paperback edition fi rst published 2016 © John J. -

Entwurf Des Erläuterungsberichtes
Verfahrensstand: § 3 (2) / § 4 (2) BauGB Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan „Schulheide“, Stadt Wittingen in der Ortschaft Kakerbeck __________________________________________________________________ INHALTSVERZEICHNIS 1. Allgemeines 1.1 Vorbemerkung 1.2 Planungsanlass 1.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 1.4 Geltungsbereich 1.5 Rechtsverhältnisse 1.6 Gegebenheiten innerhalb des Plangebietes 1.7 Äußere Einflüsse auf das Plangebiet 1.8 Ziel und Zweck der Planung 1.9 Rechtsgrundlagen 2. Planinhalte 2.1 Erschließung 2.2 Bauliche und sonstige Nutzung 2.3 Ver- und Entsorgung 2.4 Immissionen 2.5 Altlasten 2.6 Kreisarchäologie 2.7 Landschaftsplanerischer Fachbeitrag zur Eingriffsregelung 3. Plandarstellung 4. Flächenbilanz 5. Kosten und Finanzierung 6. Nachrichtliche Übernahmen 7. Hinweise aus der Fachplanung 8. Ergänzende Gründe für die Planentscheidung 9. Ordnungswidrigkeiten 10. Umweltbericht 10.1 Einleitung 10.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 10.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 10.4 Zusätzliche Angaben 11. Verfahrensvermerk Anlage - Prognose von Schallimmissionen - Biotoptypenplan - Konfliktplan - Lage der Kompensationsflächen C·G·P Bauleitplanung, Nelkenweg 9, 29392 Wesendorf 2 1. Allgemeines 1.1 Vorbemerkung Die Stadt Wittingen liegt im Nordosten des Landkreises Gifhorn und besteht aus 25 Ortschaf- ten. Sie grenzt östlich an den Altmarkkreis Salzwedel, nördlich schließt der Landkreis Uelzen an. Westlich befindet sich die Samtgemeinde Hankensbüttel, südwestlich die Samtgemeinde Wesendorf und südlich die Samtgemeinde Brome. Nach den Darstellungen des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) ist die Stadt Wittingen Mittelzentrum und dem ländlichen Raum zugeordnet. Diese Vorgaben aus dem LROP wurden als verbindliche Festlegungen in das Regionale Raumordnungspro- gramm 2008 (RROP 2008) des Zweckverbandes Großraum Braunschweig übernommen (II 1.1 (8) [Z]*). Das Mittelzentrum Wittingen besteht aus den Ortschaften Wittingen und Glü- singen. -

Feststellung Des Grundversorgers Gemäß §§ 36, 118 Abs. 3 Enwg in Dem Gasnetz Der Avacon Netz Gmbh
Feststellung des Grundversorgers gemäß §§ 36, 118 Abs. 3 EnWG in dem Gasnetz der Avacon Netz GmbH Der Status Grundversorger beschränkt sich in Gemeinden mit zwei oder mehreren Netzbetreibern auf das jeweilige Konzessionsgebiet der Avacon Netz GmbH. Amtlicher Gemeinde- Bundesland Landkreis Gemeinde Teilversorgung Grundversorger Ortsteil Schlüssel 3102000 Niedersachsen Salzgitter, Stadt Salzgitter, Stadt nein WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG 3153006 Niedersachsen Goslar Hahausen nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3153008 Niedersachsen Goslar Liebenburg nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3153009 Niedersachsen Goslar Lutter am Barenberge, Flecken nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3153014 Niedersachsen Goslar Wallmoden ja E.ON Energie Deutschland GmbH Neuwallmoden, Bodenstein 3154002 Niedersachsen Helmstedt Beierstedt nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154403 Niedersachsen Helmstedt Nord-Elm nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154006 Niedersachsen Helmstedt Gevensleben nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154008 Niedersachsen Helmstedt Grasleben nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154012 Niedersachsen Helmstedt Jerxheim nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154013 Niedersachsen Helmstedt Königslutter am Elm, Stadt ja E.ON Energie Deutschland GmbH Bornum am Elm 3154014 Niedersachsen Helmstedt Lehre nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154015 Niedersachsen Helmstedt Mariental nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154016 Niedersachsen Helmstedt Querenhorst nein E.ON Energie Deutschland GmbH 3154019 Niedersachsen Helmstedt Schöningen, Stadt nein E.ON