Archiv Für Religionswissenschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ngā Ariki Kaipūtahi and the Mangatū Lands
Wai 814, #P21 Wai 1489, #A22 Ngā Ariki Kaipūtahi and the Mangatū Lands 28 May 2018 Anthony Pātete A report commissioned by the Crown Forestry Rental Trust for the Waitangi Tribunal Mangatū Remedies district inquiry Ngā Ariki Kaipūtahi and the Mangatū Lands, May 2018 Contents Introduction ................................................................................................................................ 4 Summary of the findings of the Mangatū Remedies Inquiry ................................................. 5 The identity of Ngā Ariki Kaipūtahi .......................................................................................... 6 Whakapapa ............................................................................................................................. 6 Protest ..................................................................................................................................... 8 Organisation ........................................................................................................................... 9 The rohe of Ngā Ariki Kaipūtahi ............................................................................................. 13 Customary interests of Ngā Ariki Kaipūtahi ........................................................................... 17 Comment on land block interests ......................................................................................... 20 Impact on Ngā Ariki Kaipūtahi............................................................................................... -

Download Download
THE JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY VOLUME 127 No.3 SEPTEMBER 2018 VOICES ON THE WIND, TRACES IN THE EARTH: INTEGRATING ORAL NARRATIVE AND ARCHAEOLOGY IN POLYNESIAN HISTORY PATRICK VINTON KIRCH 2018 Nayacakalou Medal Recipient University of California, Berkeley The Polynesian peoples have long been noted for their propensity to encode the rich traditions of their ancestors in oral narrative accounts, often memorised by priests or other specialists, and passed down orally from generation to generation. Anthropologists refer to these as oral traditions, oral history or oral narratives, although they are also often categorised as “legend” or “myth”, terms that tend to dismiss their value as witnesses of real human affairs—that is to say, of history. In this lecture, I focus on a particular form of Polynesian oral narrative or oral history—one that is fundamentally chronological in its structure in that it is explicitly tied to a genealogical framework. Now I confess that I am not a specialist in oral tradition, a subject that is sometimes subsumed under the discipline of “folklore”. I am by training and by practice, over nearly half a century now, an archaeologist first and foremost. But I am also an anthropologist who believes in the holistic vision of that discipline as conceived by such disciplinary ancestors as Alfred Kroeber and Edward Sapir at the beginning of the 20th century. While this may make me something of a living fossil in the eyes of younger scholars who hew to narrower subdisciplinary paths, my holistic training and predilections incline me to see the value in working across and between the different branches of anthropology. -

A Handbook for Transnational Samoan Matai (Chiefs)
A HANDBOOK FOR TRANSNATIONAL SAMOAN MATAI (CHIEFS) TUSIFAITAU O MATAI FAFO O SAMOA Editors LUPEMATASILA MISATAUVEVE MELANI ANAE SEUGALUPEMAALII INGRID PETERSON A HANDBOOK FOR TRANSNATIONAL SAMOAN MATAI (CHIEFS) TUSIFAITAU O MATAI FAFO O SAMOA Chapter Editors Seulupe Dr Falaniko Tominiko Muliagatele Vavao Fetui Malepeai Ieti Lima COVER PAGE Samoan matai protestors outside New Zealand Parliament. On 28 March 2003, this group of performers were amongst the estimated 3,000 Samoans, including hundreds of transnational matai, who protested against the Citizenship [Western Samoa] Act 1982 outside the New Zealand Parliament in Wellington. They presented a petition signed by around 100,000 people calling for its repeal (NZ Herald 28 March 2003. Photo by Mark Mitchell). Macmillan Brown Centre for Pacific Studies, University of Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand Website: https://www.canterbury.ac.nz/mbc/ ISBN: 978-0-473-53063-1 Copyright © 2020 Macmillan Brown Center for Pacific Studies, University of Canterbury All rights reserved. This book is copyright. Except for the purpose of fair review, no part may be stored or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including recording or storage in any information retrieval system, without permission from the publisher. No royalties are paid on this book The opinions expressed and the conclusions drawn in this book are solely those of the writer. They do not necessarily represent the views of the Macmillan Brown Centre for Pacific Studies Editing & Graphic Designing Dr Rosemarie Martin-Neuninger Published by MacMillan Brown Centre for Pacific Studies, University of Canterbury DEDICATION A Tribute This book is dedicated to one of the symposium participants, Tuifa'asisina Eseta Motofoua Iosia, who passed away on 8 April 2020. -

¹Traditionalº M~Ori Patriarchy
I]Z9ZVi]d[@dgdEV`V/ ¹IgVY^i^dcVaºB~dg^EVig^VgX]n 7gZcYVc=d`dl]^ij Deconstruction does not say there is no subject, there is no truth, there is no history. It simply questions the privileging of identity so that someone is believed to have the truth. It is not the exposure of error. It is constantly and persistently looking into how truths are produced. (Spivak 1988, 28) This paper starts from the simple question of what knowledge is produced about M~ori men and why. In Nietzschean style, I am less concerned with the misrepresentation of truths than with how such truths have come to be privileged. I do not argue that the tropes such as the M~ori sportsman, manual laborer, violent criminal, or especially the M~ori patriarch, are “false,” for indeed there are many M~ori men who embody these catego- rizations.1 To propose such tropes are false would suggest that other forms of M~ori masculinity are “truer,” “more authentic” embodiments. Alter- natively, I am stimulated to uncloak the processes that produce M~ori masculine subjectivities. Specifically, this article deconstructs the inven- tion, authentication, and re-authentication of “traditional” M~ori patri- archy. Here, “invention” refers to the creation of a colonial hybrid. This is not to say, however, that colonization provided the environment for the genesis of M~ori patriarchy, for it is probable that modes of M~ori patri- archy existed prior to colonization (ie, patriarchy as constructed by M~ori tribal epistemologies, focused on notions such as whakapapa [genealogy] and mana [power/prestige/respect]). -

Aristocratic Titles and Cook Islands Nationalism Since Self-Government
Royal Backbone and Body Politic: Aristocratic Titles and Cook Islands Nationalism since Self-Government Jeffrey Sissons Nation building has everywhere entailed the encompassment of earlier or alternative imagined communities (Anderson 1991). European and Asian nationalists have incorporated monarchical and dynastic imagin ings into their modern communal designs; Islamic nationalists have derived principles oflegitimacy from an ideal ofreligious community; and African and Pacific leaders have used kinship ideologies to naturalize and lend an air of primordial authenticity to their postcolonial identities. Since self-government was gained in the Cook Islands in 1965, holders of tradi tional titles-ariki, mata'iapo, and rangatira-have come to symbolize continuity between a precolonial past and a postcolonial present. Albert Henry and Cook Islands leaders who followed him sought to include ele ments of this traditional hierarchy in the nation-state and, through ideo logical inversion, to represent themselves as ideally subordinate to, or in partnership with, its leadership. But including elements ofthe old in the new, the traditional in the mod ern, also introduces contradiction into the heart ofthe national imagining. Elements that at first expressed continuity between past and present may later come to serve as a perpetual reminder of rupture, of a past (a para dise?) that has been lost but might yet be regained. Since the late 1980s, in the context of a rapidly expanding tourist industry that values (as it commodifies) indigenous distinctiveness, Cook Islands traditional leaders have been pursuing, with renewed enthusiasm, a greater role in local gov ernment and more autonomy in deciding matters of land and title succes sion. -

Tongan Metaphors of Social Work Practice
Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and private study only. The thesis may not be reproduced elsewhere without the permission of the Author. Tongan Metaphors of Social Work Practice: Hange h� Pa kuo Fa'u� A thesis presented in partial fu lfilment of the requirements fo r the degree of Doctor of Philosophy in Social Work at Massey University Palmerston North Ne w Zealand Tracie Ailong Mafile'o 2005 Abstract This study explores Tongan social work practice and examines how social and community work is constructed from a Tongan worldview. Tongan social workers in Aotearoa New Zealand participated in individual interviews and focus group meetings which explored the Tongan values, knowledge, skills and processes fo undational to their practice. The participants' narratives contribute to an understanding of Tongan conceptions of wellbeing, personal and social change and to an identification of key components of a Tongan theoretical framework for social and community work practice. This exploratory study contributes to the growing literature articulating indigenous and non-western frameworks fo r social and community work practice. Seeking to draw on a Tongan interpretive framework, the thesis employs metaphors, in particular two fishing practices (poia and uku), to draw the findings together. Pola, a community fishing practice, illustrates a Tongan social welfare system comprised of core values, namely: fe tokoni'aki (mutual helpfulness), tauhi vii (looking after relationships),faka 'apa 'apa (respect) and 'ofa (love). Maintaining this Tongan system in the diaspora is central to the purpose of Tongan social and community work and the values themselves are a basis fo r practice. -
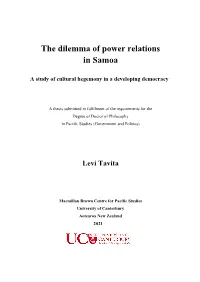
The Dilemma of Power Relations in Samoa
P a g e | 1 The dilemma of power relations in Samoa A study of cultural hegemony in a developing democracy A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Pacific Studies (Government and Politics) Levi Tavita Macmillan Brown Centre for Pacific Studies University of Canterbury Aotearoa New Zealand 2021 P a g e | 2 I do not think that a society can exist without power relations, if by that one means the strategies by which individuals try to direct and control the conduct of others. The problem, then, is not to try and dissolve them in the utopia of completely transparent communication, but to acquire the rules of law, the management techniques, and also morality, the ethos, the practice of the self that will allow us to play these games of power with as little domination as possible ______ Michel Foucault E gase toa ae ola pule The warrior will falter but good governance prevails _____ Samoan proverb P a g e | 3 Table of Contents Glossary …………………………………………………….…….................……....8 List of Tables/Figures ………………………………………...................................11 Map of Samoa ...........................................................................................................12 Acknowledgements ……………………………………….......................................13 Abstract …………………………………………………………….……....…........15 Abbreviations ………………………………………………………………............16 Chapter 1 Introduction 17 1.1 Broad aim of study ……………………………………….……….…...…...….19 1.2 Specific Objectives ………………………………..………...…...........…….…19 1.3 Rationale ……………………..………...…….………………...…...…….........19 1.4 Introducing my conceptual framework ……………………………...….....…...22 1.5 The dilemma in past literature ……………………………….………...........…23 1.6 Thesis Overview ……………………………………...………………..…....…24 1.7 Conclusion ………………………...…………...……...…..…..….…….…….. 26 Chapter 2 Context of Study 27 2.1 Samoa’s geographical & geopolitical composition ……………..…….….…... 27 2.2 A brief history of genealogy and pre-colonial contact legacy…..……...…...... -

Rapa Nui's Sea Creatures Georgia Lee Easter Island Foundation
Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation Volume 18 Article 12 Issue 1 May 2004 Rapa Nui's Sea Creatures Georgia Lee Easter Island Foundation Follow this and additional works at: https://kahualike.manoa.hawaii.edu/rnj Part of the History of the Pacific slI ands Commons, and the Pacific slI ands Languages and Societies Commons Recommended Citation Lee, Georgia (2004) "Rapa Nui's Sea Creatures," Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation: Vol. 18 : Iss. 1 , Article 12. Available at: https://kahualike.manoa.hawaii.edu/rnj/vol18/iss1/12 This Research Paper is brought to you for free and open access by the University of Hawai`i Press at Kahualike. It has been accepted for inclusion in Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation by an authorized editor of Kahualike. For more information, please contact [email protected]. Lee: Rapa Nui's Sea Creatures RAPA NUl's SEA CREATURES Georgia Lee Easter Island Foundation he petroglyphs of Rapa Nui are intriguing for their vari petroglyphs (not counting cupules), only 264 repre ent deni T ety of design motifs and their complexity. In The Rock zens of the ocean. The number, however, may not reflect im Art of Easter Island (1992), I described and illustrated many portance. Some petroglyphs depicting sea creatures are very varietie of "sea creature" image to be found in the island's large and complex and many were carved with great care and rock art. Due to space constraints, not all recorded examples effort, including double outlining. In many instance , the natu were included in that publication, and subsequent archaeologi ral model is clear: whale look like whales, sharks look like cal work has uncovered a few others. -

Revista Española Del Pacífico. Nº 6. Año VI. 1996
Revista Española del Pacífico Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP) Nº 6. Año VI. 1996 SUMARIO PRES ENTACIÓ N ART ÍCULOS Dossier sobre la revueltas filipina de 1896-97 La re vuelta tagala de 1896/97: Primo de Rivera y los acuerdos de Biac-na-Bató. Luis E. Togores Sánchez Rizal. Breve esquema biográfico. Pedro Ortiz Armengol Apuntes sobre el Katipunan. Carmen Molina Gómez-Arnau Fuentes documentales y bibliográficas española para el estudio de la Revuelta Tagala de 1896/97 en Filipinas. Luis E. Togores Sánchez Apéndice documental Documento 1: Real Decreto de 12 de septiembre de 1897. Reformando la Legislación Vigente en las Islas Filipinas. Documento 2: El último poema de Rizal: Mi último pensamiento. José Rizal Astrofísica desde el Pacífico sur. José Medina y Manuel Cornide Sobre la interesante concepción de los genitales femeninos en Chuuk (Micronesia). Beatriz Moral Una tableta “ika” con escritura jeroglífica de la isla de Pascua hallada en Madrid. Francisco Mellén Blanco Pronunciación de lenguas del Pacífico (5): Motu. Carlo A. Caranci Lo que perdió también España en la batalla de Manila. Florentino Rodao Manifestaciones de malestar social en la China actual. M.ª Jesús Merinero Martín Retana y bibliografía filipina 1800-1872. El “Aparato bibliográfico” como fuente para la historia de Filipinas (2.ª parte: Fuentes específicas). Antonio Caulín Martínez NOTAS Conferencia sobre el centenario de la revolución filipina. Manila, 21-23 de agosto de 1996. Florentino Rodao Notas de un breve viaje Nueva Zelanda. Jos Martín El desconocido epistolario de Mariano Fernández Henestrosa: un diplomático español en la península de Indochina. -

Remembering Makea Takau Ariki, the Queen of Rarotonga, 1871-1911
COVER IMAGE Natasha Te Arahori Keating & Bethany Matai Edmunds, ‘Te Kōpū’, an installation held at Māngere Arts Centre Ngā Tohu o Uenuku, 27 January – 3 March 2018. ‘Te Kōpū’ is a collaborative exhibition showcasing the work of Natasha Te Arahori (Ngāti Tūwharetoa and Ngāi Tūhoe), and Bethany Matai Edmunds (Ngāti Kuri). The collaborative works are paintings on upcycled native timber by Keating, and woven adornments by Edmunds, made from flowers and fibres harvested in the bush and the streets of Tāmaki Makaurau. In this exhibition the artists create a space in which atua wāhine — Māori goddesses — are depicted. As wāhine Māori, the artists are challenging the known creation narratives, often authored by non-Māori males, and in so doing creating a safe place from which reflection can take place. The exhibition also acknowledges the political legacy of the women who asserted their right to vote, and is part of the wider celebration of women’s suffrage. For more on ‘Te Kōpū’ see <http://ondemand.facetv.co.nz/watch.php?vid=8580181a2>. EDITOR Nadia Gush EDITORIAL ASSISTANT Fiona Martin EDITORIAL ADVISORY GROUP Giselle Byrnes, Massey University Te Kunenga Ki Purehuroa, Palmerston North. Catharine Coleborne, University of Newcastle, Australia. Nadia Gush, University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato, Hamilton. Stephen Hamilton, Charles Darwin University, Darwin, Australia; Massey University Te Kunenga Ki Purehuroa, Palmerston North. Bronwyn Labrum, Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Wellington. Mark Smith, University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato, Hamilton; Oamaru Whitestone Civic Trust, Oamaru. NZJPH6.1 2018 ISSN 2253-153X © 2018 The New Zealand Journal of Public History REMEMBERING MAKEA TAKAU ARIKI, THE QUEEN OF RAROTONGA, 1871–1911. -

Two Views of Ancient Hawaiian Society a Thesis Submitted to the Graduate Division of the University of Hawai'i at Mānoa in Pa
TWO VIEWS OF ANCIENT HAWAIIAN SOCIETY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN HISTORY MAY 2012 By Mark Alfred Kawika Fontaine Thesis Committee: John Rosa, Chairperson David Chappell Kerri Inglis Keywords: Ancient, Hawaiian, Society Abstract Since 1950, two opposing views of Hawaii’s history in pre-western-contact times have developed. One view is that a dramatic change occurred around the year 1450 CE with the implementation of the ahupuaa system. A culture that had been based in a kinship relationship between chiefs and commoners changed. Power was gathered into the hands of an elite who then exploited and extracted labor and the fruits of that labor from a larger group of workers in order to maintain a privileged lifestyle and pursue political goals. In opposition is another picture of Hawaii’s history. This view is that power was shared between chiefs and commoners in a reciprocal and mutually beneficial relationship. Balancing mechanisms functioned to move the society towards the good, a state sometimes referred to as the Hawaiian word “pono.” In this study I will compare and contrast the two views. ii Table of Contents Page Abstract . ii Table of Contents . iii Introduction . 1 1. Background and the Second Migration: Years up to 1450 CE. 10 Background . 11 The Second Migration . 28 2. Anthropologist views: Internal developments culminate . 44 in the ahupuaa system. Cordy . 45 Earle . 58 Goldman . 62 Hommon . 67 Kirch . 74 Sahlins . 79 3. Comparison and Contrast I: The Causes of Societal Change. -

Nature Based Solutions for People and Planet World Indigenous
!"#$%&'(")&*'+,-$#.,/)'0,%'1&,2-&'"/*'1-"/&#'' 3,%-*'4/*.5&/,$)'1&,2-&)'3&6./"%'7878' 9,,:'4)-"/*)'9$)#,*."/)',0'(.,*.;&%).#<'='>&>.:"' +:./?"%&'"/*'>@A>4'BC2&%.&/?&)' "#$#%&!'&(!)*)*! D&<'E,%*)' Custodians of Biodiversity Traditional Knowledge Sustainability Cook Islands Polynesian Maori Koutu Nui Nagoya Protocol ABS TVATI F%'G%"H"I'J"#H&),/'(K+?LJ&*M'J((+'JBL(.,I&*M'1HF' >&%&"'J"#"."2,'1"$-'A--)E,%#HN'1%&).*&/#',0'#H&'D,$#$'!$.',0' #H&'9,,:'4)-"/*)' O&//.0&%'P&/%<'(ALA??M'N'F.%&?#,%'9,,:'4)-"/*)'J&*.?"-' Q&)&"%?H'"/*'F&;&-,2I&/# Cook Islands Medical Research CIMRAD And Development Group ! !"#$%&'(")&*'),-$#.,/)'0,%'1&,2-&'"/*'1-"/&#' 4/#%,*$?#.,/' The Covid 19 outbreak has impacted the world in so many ways. Perhaps one of the most significant impacts is a re-evaluation of the entire approach to health, economics and social wellbeing. Perhaps for the first time in several decades, the established mantra of more money, more stuff, and more efficiency are being challenged by the possibility that more health, more community and more resilience are preferable. This global catastrophe brings the spotlight onto indigenous communities around the world for both reasons of concern; with these communities likely to feel the worst of the health impacts should the pandemic spread unabated; and for reasons of hope, with their traditions of sustainable, resilient, community focused approach that prioritizes oneness of the people with their environment, and their unique means of working with their environment to provide health, sustainability and wellbeing. The Cook Islands is a small island state in the middle of the South Pacific Ocean, and we have a rich history of traditional knowledge including medicinal plants that were integral to the lives of our ancestors.