Julius-Kühn-Archiv
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
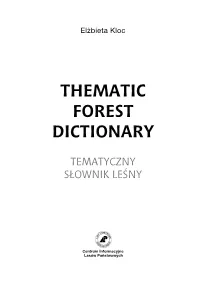
Thematic Forest Dictionary
Elżbieta Kloc THEMATIC FOREST DICTIONARY TEMATYCZNY SŁOWNIK LEÂNY Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Warszawa 2015 © Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa tel. 22 18 55 353 e-mail: [email protected] www.lasy.gov.pl © Elżbieta Kloc Konsultacja merytoryczna: dr inż. Krzysztof Michalec Konsultacja i współautorstwo haseł z zakresu hodowli lasu: dr inż. Maciej Pach Recenzja: dr Ewa Bandura Ilustracje: Bartłomiej Gaczorek Zdjęcia na okładce Paweł Fabijański Korekta Anna Wikło ISBN 978-83-63895-48-8 Projek graficzny i przygotowanie do druku PLUPART Druk i oprawa Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu TABLE OF CONTENTS – SPIS TREÂCI ENGLISH-POLISH THEMATIC FOREST DICTIONARY ANGIELSKO-POLSKI TEMATYCZNY SŁOWNIK LEÂNY OD AUTORKI ................................................... 9 WYKAZ OBJAŚNIEŃ I SKRÓTÓW ................................... 10 PLANTS – ROŚLINY ............................................ 13 1. Taxa – jednostki taksonomiczne .................................. 14 2. Plant classification – klasyfikacja roślin ............................. 14 3. List of forest plant species – lista gatunków roślin leśnych .............. 17 4. List of tree and shrub species – lista gatunków drzew i krzewów ......... 19 5. Plant morphology – morfologia roślin .............................. 22 6. Plant cells, tissues and their compounds – komórki i tkanki roślinne oraz ich części składowe .................. 30 7. Plant habitat preferences – preferencje środowiskowe roślin -
![Études Rurales, 185 | 2010, « Proliférantes Natures » [En Ligne], Mis En Ligne Le , Consulté Le 23 Septembre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/6296/%C3%A9tudes-rurales-185-2010-%C2%AB-prolif%C3%A9rantes-natures-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-consult%C3%A9-le-23-septembre-2020-306296.webp)
Études Rurales, 185 | 2010, « Proliférantes Natures » [En Ligne], Mis En Ligne Le , Consulté Le 23 Septembre 2020
Études rurales 185 | 2010 Proliférantes natures Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/9014 DOI : 10.4000/etudesrurales.9014 ISSN : 1777-537X Éditeur Éditions de l’EHESS Édition imprimée Date de publication : 1 septembre 2010 Référence électronique Études rurales, 185 | 2010, « Proliférantes natures » [En ligne], mis en ligne le , consulté le 23 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/9014 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ etudesrurales.9014 Ce document a été généré automatiquement le 23 septembre 2020. © Tous droits réservés 1 SOMMAIRE PROLIFÉRANTES NATURES INTRODUCTION Cécilia Claeys et Olivier Sirost Taxonomies REWEAVING NARRATIVES ABOUT HUMANS AND INVASIVE SPECIES Brendon M.H. Larson De la validité d'une invasion biologique Prunis serotina en forêt de Compiègne Aurélie Javelle, Bernard Kalaora et Guillaume Decocq Comment catégoriser les espèces exotiques envahissantes Marie-Jo Menozzi L’incroyable expansion d'un lapin casanier Catherine Mougenot et Lucienne Strivay Vie et mort de la manne blanche des riverains de la Saône Nicolas Césard Controverses Les « bonnes » et les « mauvaises » proliférantes Controverses camarguaises Cécilia Claeys Comment gérer une prolifération Peut-on composer avec les criquets pèlerins ? Antoine Doré Les goélands leucophée sont-ils trop nombreux ? L’émergence d’un problème public Christelle Gramaglia Governing Moth and Man Political Strategies to Manage Demands for Spraying Rolf Lidskog Mythologies Cultural Representation of Problem Animals in National Geographic Linda Kalof et Ramona Fruja Amthor Les natures apocryphes de la Seine L’envasement des plages du Calvados Olivier Sirost Études rurales, 185 | 2010 2 The Myth of Plant-Invaded Gardens and Landscapes Gert Gröning et Joachim Wolschke-Bulmahn À propos des introductions d’espèces Écologie et idéologies Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou, Alain Pavé et Claudine Schmidt-Lainé Chronique ENJEUX FONCIERS. -

Biyolojik Mücadelede Önemli Entomofag Kuģlar
Türk. biyo. müc. derg., 2015, 6 (1): 51-65 ISSN 2146-0035 Derleme (Review) Biyolojik mücadelede önemli entomofag kuĢlar Ali KAYAHAN1, Ġsmail KARACA1 Important entomophagus birds in biological control Abstract: The pressure of vertebrates on pests is very high. Among these vertebrates, birds rank first. Insectivorous birds are accepted as active agents in the control of forest and agricultural pests. They protect the natural balance by eating the adults, larvae, pupae and eggs of insects. In this review, we aimed to especially give information about the importance of birds that are effective in protecting against pests of forests within biological control. Key words: Biological control, entomophagous, birds, forest pests Özet: Zararlı böcekler üzerinde omurgalıların baskısı oldukça yüksektir. Bu omurgalılar arasında kuĢlar ilk sırayı almaktadır. Böcekçil kuĢlar, ormanlarda ve tarımda zararlı olan böceklerin mücadelesinde potansiyel etkin etmen olarak kabul görmektedirler. Böceklerin erginlerini, pupalarını, larvalarını ve yumurtalarını yiyerek doğal dengeyi korunmaktadırlar. Bu derlemede özellikle ormanların zararlılara karĢı korunmasında etkili olan kuĢların biyolojik mücadeledeki önemi hakkında bilgiler verilmeye çalıĢılmıĢtır. Anahtar sözcükler: Biyolojik etmen, entomofag kuĢlar, orman zararlıları GiriĢ KuĢlar yüksek oranda enerji tükettiklerinden sık sık beslenmek zorundadırlar. Beslenmeleri için gerekli olan adaptasyonları kuĢların evriminin çarpıcı bir özelliğidir. Bu adaptasyonlar yalnızca beslenirken hareket etmeleri ve besinlerini yakalamaları değil aynı zamanda çok çeĢitli dil yapılarıyla baĢlayan sindirim sistemlerinin tamamının özelleĢmiĢ olmasıdır (Kasarov 1996). KuĢlar diğer omurgalılar gibi diĢlere sahip olmadıkları için gagalarını yalnızca kabuklu tohumların kabuklarını ayırmak için ya da ağızla alınamayacak kadar büyük olan avlarını parçalamak için kullanırlar. Besin gagayla alındıktan sonra ilk olarak proventrikulusta kimyasal enzimlere maruz bırakılır, sonrasında fiziksel sindirim için gizzarda gönderilir ve sindirim olayı gerçekleĢtirilir. -

Schutz Des Naturhaushaltes Vor Den Auswirkungen Der Anwendung Von Pflanzenschutzmitteln Aus Der Luft in Wäldern Und Im Weinbau
TEXTE 21/2017 Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Forschungskennzahl 3714 67 406 0 UBA-FB 002461 Schutz des Naturhaushaltes vor den Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft in Wäldern und im Weinbau von Dr. Ingo Brunk, Thomas Sobczyk, Dr. Jörg Lorenz Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Tharandt Im Auftrag des Umweltbundesamtes Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 Fax: +49 340-2103-2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Durchführung der Studie: Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Professur für Forstzoologie, Prof. Dr. Mechthild Roth Pienner Straße 7 (Cotta-Bau), 01737 Tharandt Abschlussdatum: Januar 2017 Redaktion: Fachgebiet IV 1.3 Pflanzenschutz Dr. Mareike Güth, Dr. Daniela Felsmann Publikationen als pdf: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen ISSN 1862-4359 Dessau-Roßlau, März 2017 Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unter der Forschungskennzahl 3714 67 406 0 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. UBA Texte Entwicklung geeigneter Risikominimierungsansätze für die Luftausbringung von PSM Kurzbeschreibung Die Bekämpfung -

Review Article Skin Reactions to Pine Processionary Caterpillar Thaumetopoea Pityocampa Schiff
Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal Volume 2013, Article ID 867431, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/867431 Review Article Skin Reactions to Pine Processionary Caterpillar Thaumetopoea pityocampa Schiff Domenico Bonamonte, Caterina Foti, Michelangelo Vestita, and Gianni Angelini Department of Biomedical Sciences and Human Oncology, Section of Dermatology, University of Bari, Piazza Giulio Cesare 1, 70124 Bari, Italy Correspondence should be addressed to Domenico Bonamonte; [email protected] Received 10 April 2013; Accepted 8 May 2013 Academic Editors: R. Siebers and K. Sugiura Copyright © 2013 Domenico Bonamonte et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Pine caterpillar, Thaumetopoea pityocampa Schiff, is a phyto- and xylophagous lepidopteran, responsible for the delay in the growth or the death of various types of pines. Besides nature damage, pine caterpillar causes dermatological reactions in humans by contact with its irritating larvae hairs. Although the dermatitis occurs among outdoor professionals, it is primarily extraprofessional. Contamination generally occurs in pinewoods, rarely in cities. Means of contamination comprise direct contact with the nest or the processional caterpillar and indirect contact with air dispersed hairs. The dermatitis is generally observed in late spring and particularly from April to June, among campers and tourers. The eruption has its onset 1–12 hours after contact with the hairs and presents with intense and continuous itching. Morphologically, it is strophulus-like and consists of papulous, excoriated, and pinkish lesions on an oedematous base. -

Processionary Moths Screening Aid Thaumetopoea Spp
Processionary Moths Screening Aid Thaumetopoea spp. Todd M. Gilligan1, Steven C. Passoa2, and Frans Groenen3 1) Identification Technology Program (ITP) / Colorado State University, USDA-APHIS-PPQ-Science & Technology (S&T), 2301 Research Boulevard, Suite 108, Fort Collins, Colorado 80526 U.S.A. (Email: [email protected]) 2) USDA-APHIS-PPQ, The Ohio State University and USDA Forest Service Northern Research Station, 1315 Kinnear Road, Columbus, Ohio 43212 U.S.A. (Email: [email protected]) 3) Dorpstraat 171, NL-5575 AG, Luyksgestel, Netherlands (Email: [email protected]) This CAPS (Cooperative Agricultural Pest Survey) screening aid produced for and distributed by: Version 2.0 USDA-APHIS-PPQ National Identification Services (NIS) 27 Jun 2014 This and other identification resources are available at: http://caps.ceris.purdue.edu/taxonomic_services The genus Thaumetopoea contains approximately 15 species that are distributed across Europe, northern Africa, and the Middle East. Thaumetopoea are currently in the Notodontidae (Thaumetopoeinae), but were sometimes placed their own family (Thaumetopoeidae) in older literature. Moths in this genus are often referred to as “processionary moths” because their larvae (Figs. 1, 3) are gregarious and will form long lines or “processions” when moving to feed. Thaumetopoea caterpillars are considered a serious health hazard because they are covered in long urticating setae (hairs) that contain a toxin (thaumetopoein). Severe skin dermatitis and allergic reactions in both people and animals can result from direct contact with larvae, larval nests, or larval setae that have been blown by the wind. In addition to creating health Fig. 1: T. pityocampa larvae (Photo by John problems, heavy infestations of larvae can defoliate entire trees, although H. -

Outbreaks of Xylophagous Cerambycid Beetles
Pest specific plant health response plan: Outbreaks of xylophagous cerambycid beetles Figure 1. Adult Saperda candida. © Figure 2. Adult Oemona hirta. © Gilles Gonthier under licence Epitree under licence (https://creativecommons.org/licenses/ (https://creativecommons.org/licen by/2.0/). ses/by-nc/2.0/). 1 © Crown copyright 2019 You may re-use this information (not including logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open Government Licence. To view this licence, visit www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ or write to the Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, or e-mail: [email protected] This document is also available on our website at: https://planthealthportal.defra.gov.uk/pests-and-diseases/contingency-planning/ Any enquiries regarding this document should be sent to us at: The UK Chief Plant Health Officer Department for Environment, Food and Rural Affairs Room 11G32 National Agri-Food Innovation Campus Sand Hutton York YO41 1LZ Email: [email protected] 2 Contents 1. Introduction and scope .............................................................................................. 4 2. Summary of threat ...................................................................................................... 4 3. Response .................................................................................................................... 4 Official action to be taken following the suspicion or confirmation of a cerambycid on imported -

(Lep. Thaumetopoeidae) Dans Les Forêts De C
Diversité des ennemis naturels de Thaumetopoea pityocampa et Thaumetopoea bonjeani (Lep. Thaumetopoeidae) dans les forêts de Cedrus atlantica Manetti Mohamed Zamoum, Mustapha Gachi, Noureddine Rahim, Mohamed Khemici, Jean Claude Martin, Nadia Bouragba-Brague, Athmane Briki To cite this version: Mohamed Zamoum, Mustapha Gachi, Noureddine Rahim, Mohamed Khemici, Jean Claude Martin, et al.. Diversité des ennemis naturels de Thaumetopoea pityocampa et Thaumetopoea bonjeani (Lep. Thaumetopoeidae) dans les forêts de Cedrus atlantica Manetti. Séminaire international Biodiversité et changements globaux, Nov 2015, Djelfa, Algérie. pp.71-83, 2016. hal-01602925 HAL Id: hal-01602925 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01602925 Submitted on 5 Jun 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License Diversité des ennemis naturels de Thaumetopoea pityocampa et Thaumetopoea bonjeani (Lep. Thaumetopoeidae) dans les forêts de Cedrus atlantica Manetti. Zamoum Mohamed (1), Gachi Mustapha (1), -

Entomologiske Meddelelser
Entomologiske Meddelelser Indeks for Bind 1-67 (1887-1999) Entomologisk Forening København 2000 FORORD Tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser" - Entomologisk Forenings medlemsblad - blev grundlagt i 1887, og er således det ældste danske entomologiske tidsskrift, som stadig udgives. Det har siden sin start haft til formål at udbrede kendskabet til entomologien i almindelighed og dansk entomologi i særdeleshed. De første 5 bind udkom i årene 1887-1896 og omhandlede primært artikler af særlig relevans for dansk entomologi. Herefter skiftede det format, såvel rent fysisk som (mere gradvis) indholdsmæssigt, og fik efterhånden et mere internationalt tilsnit med en vis andel af bl.a. tysk- og engelsksprogede artikler. I forbindelse med overgangen til det nye format, benævntes tidsskriftet nu som "Entomologiske Meddelelser, 2. Række" og nummereringen af de enkelte bind startede forfra. Efter at have praktiseret denne nummerering i nogle år, droppedes dog betegnelsen "2. Række", og man vendte tilbage til at nummerere bindene fortløbende fra det først udkomne bind. Efter at tidsskriftet op igennem 1900-tallet havde fået et stigende indhold af artikler med internationalt sigte, blev det fra bind 39 (1971) besluttet at koncentrere indholdet til primært dansksprogede artikler af særlig relevans for den danske fauna. Samtidig overgik de enkelte bind til at udgøre årgange i stedet for, som tidligere, at være flerårige. "Entomologiske Meddelelser" har siden sin start bragt hen mod 1600 originale, videnskabelige artikler eller mindre meddelelser, næsten 500 boganmeldelser, over 100 biografier eller nekrologer over primært danske entomologer, samt enkelte meddelelser af anden slags. For at lette overskueligheden over den meget betydelige mængde af information disse publikationer rummer, har Entomologisk Forenings bestyrelse fundet tiden moden til at sammenstille et indeks over indholdet af samtlige udkomne numre af "Entomologiske Meddelser" til og med bind 67 (årgang 1999). -

N Achrichten
©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at N achrichten des entomologischen Vereins Apollo (e. V, gegr. 1897) Supplementum 10 Ernst BROCKMANN: Kommentierte Bibliographie zur Faunistik der hessischen Lepidopteren 1990 Frankfurt am Main ISSN 0723-9920 ©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo Herausgeber Entomologischer Verein Apollo e. V.. Frankfurt am Main, ge gründet 1897. Erster Vorsitzender: Dr. Klaus G. Schurian. Schriftleitung verantwortlicher Redakteur: Wolfgang A. Nässig, Postfach 3063, D-6052 M uhlheim 3. Redaktionskomitee Dr. Wolfgang Eckweiler. Gronauer Str. 40, 6000 Frankfurt; Ernst Görgner, Wilhelmstraße 31, 6050 Offenbach; P. J. Hof mann, Bergstraße 40, 6477 Limeshain 3; Wolfgang A. Nässig. Postfach 3063, 605Z MUhlheim 3; Dr. Klaus G. Schurian, Am Mannstein 13, 6233 Kelkheim 2. Manuskripte an W. A. Nässig, Postfach 3063, D-6052 MUhlheim 3. Inhalt Die Autoren sind fUr den Inhalt ihrer Beiträge allein ver antwortlich; die Artikel geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion oder des Vereins wieder, Autorenrichtlinien sind kostenlos in der jeweils gültigen Version von der Redaktion (W. A. Nässig) erhältlich. Freiexemplare Die Autoren erhalten 50 Freiexemplare ihrer Artikel (Originalarbeiten); werden weitere 50 Exemplare zum Selbst kostenpreis gewünscht, so ist dies beim Einreichen des Manuskriptes zu vermerken. Farbtafeln Prinzipiell besteht die Möglichkeit, auch Farbtafeln drucken zu lassen. Die Finanzierung solcher Tafeln kann nicht durch den Verein erfolgen, sondern muß durch den Autor des Artikels organisiert werden. Interessierte Autoren wen den sich bitte an W. A. Nässig. Abonnement Jahresbeitrag z. Zt. DM 30-, Schüler und Studenten DM 15,-, AufnahmegebUhr DM 5,-. -

I. Einführung Und Aktuelle Gefährdungssituation
Ökologische Schäden, gesundheitliche Gefahren und Maßnahmen zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners im Forst und im urbanen Grün Ökologische Schäden, gesundheitliche Gefahren und Maßnahmen zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners im Forst und im urbanen Grün I. Einführung und aktuelle Gefährdungssituation Moderation: Dr. M. Hommes, Julius Kühn-Institut, Braunschweig Die Prozessionsspinner Mitteleuropas - Ein Überblick The Processionary Moths of Central Europe - An Overview Dr. Nadine Bräsicke Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Germany, [email protected] DOI 10.5073/jka.2013.440.001 Zusammenfassung Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich bereits auch in Deutschland beobachten. Dabei werden die Waldökosysteme in besonderer Weise betroffen. Waldstandorte sind stärker trockenen Bedingungen ausgesetzt, die zusammen mit höheren Vegetationszeittemperaturen eine erhöhte Stressanfälligkeit der Bäume verursachen. Bei den Insekten beeinflusst eine erhöhte Temperatur u. a. die Entwicklungsdauer, die Populationsdichte und die Verwertbarkeit der Wirtspflanzen als Nahrung (BMLFUW 2003, PETERCORD et al. 2008). Es ist zu erwarten, dass die Wachstumsrate und die Entwicklung der Insektenarten beeinflusst wird (NETHERER & SCHOPF 2009), die aufgrund eines relativ hohen Populationswachstums und hoher Mobili- tät durch Migration oder Adaption auf veränderte Klimabedingungen rascher reagieren (HARRINGTON et al. 2001). Bei einigen Schädlingen -

Normes OEPP EPPO Standards
© 2004 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 34, 155 –157 Blackwell Publishing, Ltd. Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes European and Mediterranean Plant Protection Organization Normes OEPP EPPO Standards Diagnostic protocols for regulated pests Protocoles de diagnostic pour les organismes réglementés PM 7/37 Organization Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes 1, rue Le Nôtre, 75016 Paris, France 155 156 Diagnostic protocols Approval • laboratory procedures presented in the protocols may be adjusted to the standards of individual laboratories, provided EPPO Standards are approved by EPPO Council. The date of that they are adequately validated or that proper positive and approval appears in each individual standard. In the terms of negative controls are included. Article II of the IPPC, EPPO Standards are Regional Standards for the members of EPPO. References Review EPPO/CABI (1996) Quarantine Pests for Europe, 2nd edn. CAB Interna- tional, Wallingford (GB). EPPO Standards are subject to periodic review and amendment. EU (2000) Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective The next review date for this EPPO Standard is decided by the measures against the introduction into the Community of organisms EPPO Working Party on Phytosanitary Regulations harmful to plants or plant products and against their spread within the Community. Official Journal of the European Communities L169, 1–112. FAO (1997) International Plant Protection Convention (new revised text). Amendment record FAO, Rome (IT). IPPC (1993) Principles of plant quarantine as related to international trade. Amendments will be issued as necessary, numbered and dated. ISPM no. 1. IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).