Der Eichenprozessionsspinner in Deutschland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
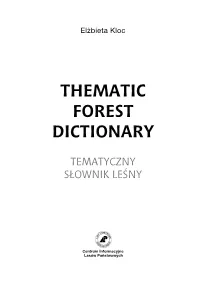
Thematic Forest Dictionary
Elżbieta Kloc THEMATIC FOREST DICTIONARY TEMATYCZNY SŁOWNIK LEÂNY Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Warszawa 2015 © Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa tel. 22 18 55 353 e-mail: [email protected] www.lasy.gov.pl © Elżbieta Kloc Konsultacja merytoryczna: dr inż. Krzysztof Michalec Konsultacja i współautorstwo haseł z zakresu hodowli lasu: dr inż. Maciej Pach Recenzja: dr Ewa Bandura Ilustracje: Bartłomiej Gaczorek Zdjęcia na okładce Paweł Fabijański Korekta Anna Wikło ISBN 978-83-63895-48-8 Projek graficzny i przygotowanie do druku PLUPART Druk i oprawa Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu TABLE OF CONTENTS – SPIS TREÂCI ENGLISH-POLISH THEMATIC FOREST DICTIONARY ANGIELSKO-POLSKI TEMATYCZNY SŁOWNIK LEÂNY OD AUTORKI ................................................... 9 WYKAZ OBJAŚNIEŃ I SKRÓTÓW ................................... 10 PLANTS – ROŚLINY ............................................ 13 1. Taxa – jednostki taksonomiczne .................................. 14 2. Plant classification – klasyfikacja roślin ............................. 14 3. List of forest plant species – lista gatunków roślin leśnych .............. 17 4. List of tree and shrub species – lista gatunków drzew i krzewów ......... 19 5. Plant morphology – morfologia roślin .............................. 22 6. Plant cells, tissues and their compounds – komórki i tkanki roślinne oraz ich części składowe .................. 30 7. Plant habitat preferences – preferencje środowiskowe roślin -

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve, Periodic Review 2005-2015
This Periodic Review can also be downloaded at www.vattenriket.kristianstad.se/unesco/. Title: Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve. Periodic Review 2005-2015 Authors: This review is produced by the Biosphere Office, Kristianstads kommun: Carina Wettemark, Johanna Källén, Åsa Pearce, Karin Magntorn, Jonas Dahl, Hans Cronert; Karin Hernborg and Ebba Trolle. In addition a large number of people have contributed directly and indirectly. Cover photo: Patrik Olofsson/N Maps: Stadsbyggnadskontoret Kristianstads kommun PERIODIC REVIEW FOR BIOSPHERE RESERVE INTRODUCTION The UNESCO General Conference, at its 28th session, adopted Resolution 28 C/2.4 on the Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves. This text defines in particular the criteria for an area to be qualified for designation as a biosphere reserve (Article 4). In addition, Article 9 foresees a periodic review every ten years The periodic review is based on a report prepared by the relevant authority, on the basis of the criteria of Article 4. The periodic review must be submitted by the national MAB Committee to the MAB Secretariat in Paris. The text of the Statutory Framework is presented in the third annex. The form which follows is provided to help States prepare their national reports in accordance with Article 9 and to update the Secretariat's information on the biosphere reserve concerned. This report should enable the International Coordinating Council (ICC) of the MAB Programme to review how each biosphere reserve is fulfilling the criteria of Article 4 of the Statutory Framework and, in particular, the three functions: conservation, development and support. It should be noted that it is requested, in the last part of the form (Criteria and Progress Made), that an indication be given of how the biosphere reserve fulfils each of these criteria. -

Review on Quercus Dalechampii Ten. and Quercus Petraea (Mattuschka) Liebl
Early view, On-line since 31st March 2016 Г О Д И Ш Н И К НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА 2 – БОТАНИКА Том 100, 2015 A N N U A I R E DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI” FACULTE DE BIOLOGIE LIVRE 2 – BOTANIQUE Tome 100, 2015 СОФИЯ · 2016 ИЗДАТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ PRESSES UNIVERSITAIRES “ST. KLIMENT OHRIDSKI” Editor-in-Chief Prof. Maya Stoyneva-Gärtner, PhD, DrSc Editorial Board Prof. Dimiter Ivanov, PhD, DrSc Prof. Iva Apostolova, PhD Prof. Mariana Lyubenova, PhD Prof. Veneta Kapchina-Toteva , PhD Assoc. Prof. Aneli Nedelcheva, PhD Assoc. Prof. Anna Ganeva, PhD Assoc. Prof. Dimitrina Koleva, PhD Assoc. Prof. Dolya Pavlova, PhD Assoc. Prof. Juliana Atanasova, PhD Assoc. Prof. Melania Gyosheva, PhD Assoc. Prof. Rosen Tsonev, PhD Assistant Editor Main Assist. Blagoy Uzunov, PhD © СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 2016 ISSN 0204-9910 (Print) ISSN 2367-9190 (Online) Early view, On-line since 31st March 2016 ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” FACULTY OF BIOLOGY BOOK 2 – BOTANY Volume 100, 2015 ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI” FACULTE DE BIOLOGIE LIVRE 2 – BOTANIQUE Tome 100, 2015 REVIEW ON QUERCUS DALECHAMPII TEN. AND QUERCUS PETRAEA (MATTUSCHKA) LIEBL. IN THE VEGETATION OF BULGARIA Eva Filipova¹ & Asen Asenov²* ¹ Department of Ecology and EP, Faculty of Biology, St Kliment Ohridski University of Sofia, 8 Dragan Tzankov Blvd., 1164 Sofia, Bulgaria ² Department of Botany, Faculty of Biology, St Kliment Ohridski University of Sofia, 8 Dragan Tzankov Blvd., 1164 Sofia, Bulgaria Abstract. Quercus dalechampii Ten. -

Biodiversity Climate Change Impacts Report Card Technical Paper 12. the Impact of Climate Change on Biological Phenology In
Sparks Pheno logy Biodiversity Report Card paper 12 2015 Biodiversity Climate Change impacts report card technical paper 12. The impact of climate change on biological phenology in the UK Tim Sparks1 & Humphrey Crick2 1 Faculty of Engineering and Computing, Coventry University, Priory Street, Coventry, CV1 5FB 2 Natural England, Eastbrook, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8DR Email: [email protected]; [email protected] 1 Sparks Pheno logy Biodiversity Report Card paper 12 2015 Executive summary Phenology can be described as the study of the timing of recurring natural events. The UK has a long history of phenological recording, particularly of first and last dates, but systematic national recording schemes are able to provide information on the distributions of events. The majority of data concern spring phenology, autumn phenology is relatively under-recorded. The UK is not usually water-limited in spring and therefore the major driver of the timing of life cycles (phenology) in the UK is temperature [H]. Phenological responses to temperature vary between species [H] but climate change remains the major driver of changed phenology [M]. For some species, other factors may also be important, such as soil biota, nutrients and daylength [M]. Wherever data is collected the majority of evidence suggests that spring events have advanced [H]. Thus, data show advances in the timing of bird spring migration [H], short distance migrants responding more than long-distance migrants [H], of egg laying in birds [H], in the flowering and leafing of plants[H] (although annual species may be more responsive than perennial species [L]), in the emergence dates of various invertebrates (butterflies [H], moths [M], aphids [H], dragonflies [M], hoverflies [L], carabid beetles [M]), in the migration [M] and breeding [M] of amphibians, in the fruiting of spring fungi [M], in freshwater fish migration [L] and spawning [L], in freshwater plankton [M], in the breeding activity among ruminant mammals [L] and the questing behaviour of ticks [L]. -
![Études Rurales, 185 | 2010, « Proliférantes Natures » [En Ligne], Mis En Ligne Le , Consulté Le 23 Septembre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/6296/%C3%A9tudes-rurales-185-2010-%C2%AB-prolif%C3%A9rantes-natures-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-consult%C3%A9-le-23-septembre-2020-306296.webp)
Études Rurales, 185 | 2010, « Proliférantes Natures » [En Ligne], Mis En Ligne Le , Consulté Le 23 Septembre 2020
Études rurales 185 | 2010 Proliférantes natures Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/9014 DOI : 10.4000/etudesrurales.9014 ISSN : 1777-537X Éditeur Éditions de l’EHESS Édition imprimée Date de publication : 1 septembre 2010 Référence électronique Études rurales, 185 | 2010, « Proliférantes natures » [En ligne], mis en ligne le , consulté le 23 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/9014 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ etudesrurales.9014 Ce document a été généré automatiquement le 23 septembre 2020. © Tous droits réservés 1 SOMMAIRE PROLIFÉRANTES NATURES INTRODUCTION Cécilia Claeys et Olivier Sirost Taxonomies REWEAVING NARRATIVES ABOUT HUMANS AND INVASIVE SPECIES Brendon M.H. Larson De la validité d'une invasion biologique Prunis serotina en forêt de Compiègne Aurélie Javelle, Bernard Kalaora et Guillaume Decocq Comment catégoriser les espèces exotiques envahissantes Marie-Jo Menozzi L’incroyable expansion d'un lapin casanier Catherine Mougenot et Lucienne Strivay Vie et mort de la manne blanche des riverains de la Saône Nicolas Césard Controverses Les « bonnes » et les « mauvaises » proliférantes Controverses camarguaises Cécilia Claeys Comment gérer une prolifération Peut-on composer avec les criquets pèlerins ? Antoine Doré Les goélands leucophée sont-ils trop nombreux ? L’émergence d’un problème public Christelle Gramaglia Governing Moth and Man Political Strategies to Manage Demands for Spraying Rolf Lidskog Mythologies Cultural Representation of Problem Animals in National Geographic Linda Kalof et Ramona Fruja Amthor Les natures apocryphes de la Seine L’envasement des plages du Calvados Olivier Sirost Études rurales, 185 | 2010 2 The Myth of Plant-Invaded Gardens and Landscapes Gert Gröning et Joachim Wolschke-Bulmahn À propos des introductions d’espèces Écologie et idéologies Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou, Alain Pavé et Claudine Schmidt-Lainé Chronique ENJEUX FONCIERS. -

Biyolojik Mücadelede Önemli Entomofag Kuģlar
Türk. biyo. müc. derg., 2015, 6 (1): 51-65 ISSN 2146-0035 Derleme (Review) Biyolojik mücadelede önemli entomofag kuĢlar Ali KAYAHAN1, Ġsmail KARACA1 Important entomophagus birds in biological control Abstract: The pressure of vertebrates on pests is very high. Among these vertebrates, birds rank first. Insectivorous birds are accepted as active agents in the control of forest and agricultural pests. They protect the natural balance by eating the adults, larvae, pupae and eggs of insects. In this review, we aimed to especially give information about the importance of birds that are effective in protecting against pests of forests within biological control. Key words: Biological control, entomophagous, birds, forest pests Özet: Zararlı böcekler üzerinde omurgalıların baskısı oldukça yüksektir. Bu omurgalılar arasında kuĢlar ilk sırayı almaktadır. Böcekçil kuĢlar, ormanlarda ve tarımda zararlı olan böceklerin mücadelesinde potansiyel etkin etmen olarak kabul görmektedirler. Böceklerin erginlerini, pupalarını, larvalarını ve yumurtalarını yiyerek doğal dengeyi korunmaktadırlar. Bu derlemede özellikle ormanların zararlılara karĢı korunmasında etkili olan kuĢların biyolojik mücadeledeki önemi hakkında bilgiler verilmeye çalıĢılmıĢtır. Anahtar sözcükler: Biyolojik etmen, entomofag kuĢlar, orman zararlıları GiriĢ KuĢlar yüksek oranda enerji tükettiklerinden sık sık beslenmek zorundadırlar. Beslenmeleri için gerekli olan adaptasyonları kuĢların evriminin çarpıcı bir özelliğidir. Bu adaptasyonlar yalnızca beslenirken hareket etmeleri ve besinlerini yakalamaları değil aynı zamanda çok çeĢitli dil yapılarıyla baĢlayan sindirim sistemlerinin tamamının özelleĢmiĢ olmasıdır (Kasarov 1996). KuĢlar diğer omurgalılar gibi diĢlere sahip olmadıkları için gagalarını yalnızca kabuklu tohumların kabuklarını ayırmak için ya da ağızla alınamayacak kadar büyük olan avlarını parçalamak için kullanırlar. Besin gagayla alındıktan sonra ilk olarak proventrikulusta kimyasal enzimlere maruz bırakılır, sonrasında fiziksel sindirim için gizzarda gönderilir ve sindirim olayı gerçekleĢtirilir. -

Predicting the Invasion Range for a Highly Polyphagous And
A peer-reviewed open-access journal NeoBiota 59: 1–20 (2020) Winter moth environmental niche 1 doi: 10.3897/neobiota.59.53550 RESEARCH ARTICLE NeoBiota http://neobiota.pensoft.net Advancing research on alien species and biological invasions Predicting the invasion range for a highly polyphagous and widespread forest herbivore Laura M. Blackburn1, Joseph S. Elkinton2, Nathan P. Havill3, Hannah J. Broadley2, Jeremy C. Andersen2, Andrew М. Liebhold1,4 1 Northern Research Station, USDA Forest Service, Morgantown, West Virginia, USA 2 Department of En- vironmental Conservation, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA 3 Northern Research Station, USDA Forest Service, Hamden, Connecticut, USA 4 Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, 165 00 Praha 6 – Suchdol, Czech Republic Corresponding author: Andrew Liebhold ([email protected]) Academic editor: Ingolf Kühn | Received 23 April 2020 | Accepted 26 June 2020 | Published 28 July 2020 Citation: Blackburn LM, Elkinton JS, Havill NP, Broadley HJ, Andersen JC, Liebhold AМ (2020) Predicting the invasion range for a highly polyphagous and widespread forest herbivore. NeoBiota 59: 1–20. https://doi.org/10.3897/ neobiota.59.53550 Abstract Here we compare the environmental niche of a highly polyphagous forest Lepidoptera species, the winter moth (Operophtera brumata), in its native and invaded range. During the last 90 years, this European tree fo- livore has invaded North America in at least three regions and exhibited eruptive population behavior in both its native and invaded range. Despite its importance as both a forest and agricultural pest, neither the poten- tial extent of this species’ invaded range nor the geographic source of invading populations from its native range are known. -

(Amaranthaceae) in Italy. V. Atriplex Tornabenei
Phytotaxa 145 (1): 54–60 (2013) ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ Article PHYTOTAXA Copyright © 2013 Magnolia Press ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.145.1.6 Studies on the genus Atriplex (Amaranthaceae) in Italy. V. Atriplex tornabenei DUILIO IAMONICO1 1 Laboratory of Phytogeography and Applied Geobotany, Department PDTA, Section Environment and Landscape, University of Rome Sapienza, 00196 Roma, Italy. Email: [email protected] Abstract The typification of the name Atriplex tornabenei (a nomen novum pro A. arenaria) is discussed. An illustration by Cupani is designated as the lectotype, while a specimen from FI is designated as the epitype. Chorological and morphological notes in comparison with the related species A. rosea and A. tatarica are also provided. A nomenclatural change (Atriplex tornabenei subsp. pedunculata stat. nov.) is proposed. Key words: Atriplex tornabenei var. pedunculata, epitype, infraspecific variability, lectotype, Mediterranean, nomenclatural change, nomen novum Introduction Atriplex Linnaeus (1753: 1054) is a genus of about 260 species distributed in arid and semiarid regions of Eurasia, America and Australia (Sukhorukov & Danin 2009). Several names (at species, subspecies, variety and form ranks) were described related to the high phenotipic variability of this critical genus (Al-Turki et al. 2000). As conseguence, misapplication of names and nomenclatural disorders exist and need clarification. In this paper, the identity of the A. tornabenei Tineo ex Gussone (1843: 589) is discussed as part of the treatment of the genus Atriplex for the new edition of the Italian Flora (editor, Prof. S. Pignatti) and within the initiative “Italian Loci Classici Census” (Domina et al. -

Schutz Des Naturhaushaltes Vor Den Auswirkungen Der Anwendung Von Pflanzenschutzmitteln Aus Der Luft in Wäldern Und Im Weinbau
TEXTE 21/2017 Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Forschungskennzahl 3714 67 406 0 UBA-FB 002461 Schutz des Naturhaushaltes vor den Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft in Wäldern und im Weinbau von Dr. Ingo Brunk, Thomas Sobczyk, Dr. Jörg Lorenz Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Tharandt Im Auftrag des Umweltbundesamtes Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 Fax: +49 340-2103-2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Durchführung der Studie: Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Professur für Forstzoologie, Prof. Dr. Mechthild Roth Pienner Straße 7 (Cotta-Bau), 01737 Tharandt Abschlussdatum: Januar 2017 Redaktion: Fachgebiet IV 1.3 Pflanzenschutz Dr. Mareike Güth, Dr. Daniela Felsmann Publikationen als pdf: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen ISSN 1862-4359 Dessau-Roßlau, März 2017 Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unter der Forschungskennzahl 3714 67 406 0 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. UBA Texte Entwicklung geeigneter Risikominimierungsansätze für die Luftausbringung von PSM Kurzbeschreibung Die Bekämpfung -

Comitetul De Redacţie
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, s. Biologie animală, Tom LIII, 2007 LEAF-MINING INSECTS ENCOUNTERED IN THE FOREST RESERVE OF HÂRBOANCA, VASLUI COUNTY Alina-Maria STOLNICU “Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi, the Faculty of Biology, Carol I Blvd., no. 22, 700505, Iaşi, Romania e-mail: [email protected] Abstract. As a result of a series of studies conducted within the Forest Reserve of Hârboanca (Vaslui) between June 2005 and October 2006, there were identified 60 species of leaf-mining insects, belonging to 14 families, from three different orders: Lepidoptera (83%), Diptera (12%) and Hymenoptera (5%). The “mines” caused by the larvae of these insects were identified on 34 different species of hosting plants, mostly wooden plants. The leaf-mining Lepidoptera and Hymenoptera larvae are more likely to grow on wooden plants, while those belonging to the Diptera order prefer herbaceous plants. One of the species, Phyllonorycter issikii (Kumata) found here was signaled for the first time in Romanian fauna, while other ten species were encountered for the first time in Moldavia. Keywords: leaf-mining insects, Forest Reserve of Hârboanca, Romanian, fauna. Rezumat. Insecte miniere semnalate în Rezervaţia Forestieră Hârboanca (Vaslui). În urma studiilor efectuate în Rezervaţia Forestieră Hârboanca (Vaslui) în perioada iunie 2005 - octombrie 2006 s-au identificat 60 de specii de insecte miniere care aparţin la 14 familii, grupate în 3 ordine: Lepidoptera (83%), Diptera (12%) şi Hymenoptera (5%). Minele provocate de larvele insectelor miniere au fost identificate pe 34 de specii de plante-gazdă, majoritatea fiind de esenţă lemnoasă. Larvele lepidopterelor şi himenopterelor miniere se dezvoltă mai mult pe plantele lemnoase, în schimb dipterele preferă plantele ierboase. -

Additions, Deletions and Corrections to An
Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

Bosco Palazzi
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ISSN: 2340-4078 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Bella, S; Parenzan, P.; Russo, P. Diversity of the Macrolepidoptera from a “Bosco Palazzi” area in a woodland of Quercus trojana Webb., in southeastern Murgia (Apulia region, Italy) (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 46, no. 182, 2018, April-June, pp. 315-345 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45559600012 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 46 (182) junio 2018: 315-345 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 Diversity of the Macrolepidoptera from a “Bosco Palazzi” area in a woodland of Quercus trojana Webb., in southeastern Murgia (Apulia region, Italy) (Insecta: Lepidoptera) S. Bella, P. Parenzan & P. Russo Abstract This study summarises the known records of the Macrolepidoptera species of the “Bosco Palazzi” area near the municipality of Putignano (Apulia region) in the Murgia mountains in southern Italy. The list of species is based on historical bibliographic data along with new material collected by other entomologists in the last few decades. A total of 207 species belonging to the families Cossidae (3 species), Drepanidae (4 species), Lasiocampidae (7 species), Limacodidae (1 species), Saturniidae (2 species), Sphingidae (5 species), Brahmaeidae (1 species), Geometridae (55 species), Notodontidae (5 species), Nolidae (3 species), Euteliidae (1 species), Noctuidae (96 species), and Erebidae (24 species) were identified.