Karl Ehregott (Andreas) Mangelsdorf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bischofswerda the Town and Its People Contents
Bischofswerda The town and its people Contents 0.1 Bischofswerda ............................................. 1 0.1.1 Geography .......................................... 1 0.1.2 History ............................................ 1 0.1.3 Sights ............................................. 2 0.1.4 Economy and traffic ...................................... 2 0.1.5 Culture and sports ....................................... 3 0.1.6 Partnership .......................................... 3 0.1.7 Personality .......................................... 3 0.1.8 Notes ............................................. 4 0.1.9 External links ......................................... 4 0.2 Großdrebnitz ............................................. 4 0.2.1 History ............................................ 4 0.2.2 People ............................................ 5 0.2.3 Literature ........................................... 6 0.2.4 Footnotes ........................................... 6 0.3 Wesenitz ................................................ 6 0.3.1 Geography .......................................... 6 0.3.2 Touristic Attractions ..................................... 6 0.3.3 Historical Usage ....................................... 7 0.3.4 Fauna ............................................. 7 0.3.5 References .......................................... 7 1 People born in or working for Bischofswerda 8 1.1 Abd-ru-shin .............................................. 8 1.1.1 Life, Publishing, Legacy ................................... 8 1.1.2 Legacy -

The Doctrine of the Church and Its Ministry According to the Evangelical Lutheran Synod of the Usa
THE DOCTRINE OF THE CHURCH AND ITS MINISTRY ACCORDING TO THE EVANGELICAL LUTHERAN SYNOD OF THE USA by KARL EDWIN KUENZEL Submitted in accordance with the requirements for the degree of DOCTOR OF THEOLOGY In the subject SYSTEMATIC THEOLOGY at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA PROMOTER: PROFESSOR ERASMUS VAN NIEKERK November 2006 ii Summary Nothing has influenced and affected the Lutheran Church in the U.S.A. in the past century more than the doctrine of the Church and its Ministry. When the first Norwegian immigrants entered the U.S. in the middle of the 19th century, there were not enough Lutheran pastors to minister to the spiritual needs of the people. Some of these immigrants resorted to a practice that had been used in Norway, that of using lay-preachers. This created problems because of a lack of proper theological training. The result was the teaching of false doctrine. Some thought more highly of the lay-preachers than they did of the ordained clergy. Consequently clergy were often viewed with a discerning eye and even despised. This was one of the earliest struggles within the Norwegian Synod. Further controversies involved whether the local congregation is the only form in which the church exists. Another facet of the controversy involves whether or not the ministry includes only the pastoral office; whether or not only ordained clergy do the ministry; whether teachers in the Lutheran schools are involved in the ministry; and whether or not any Christian can participate in the public ministry. Is a missionary, who serves on behalf of the entire church body, a pastor? If only the local congregation can call a pastor, then a missionary cannot be a pastor because he serves the entire church body in establishing new congregations. -

Die Halleschen Zeitungen Und Zeitschriften Im Zeitalter Der Aufklärung (1688-1815) Bibliographisches Verzeichnis
Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt 98 Anne Purschwitz Die halleschen Zeitungen und Zeitschriften im Zeitalter der Aufklärung (1688-1815) Bibliographisches Verzeichnis Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt 98 Herausgegeben von Anke Berghaus-Sprengel Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Anne Purschwitz Die halleschen Zeitungen und Zeitschriften im Zeitalter der Aufklärung (1688-1815) Bibliographisches Verzeichnis Halle (Saale) 2018 Purschwitz, Anne Die halleschen Zeitungen und Zeitschriften im Zeitalter der Aufklärung (1688-1815) : Bibliographisches Verzeichnis / Anne Purschwitz - Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen- Anhalt, 2018. - XXXVI, 226 Seiten. (Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 98) ISBN 978-3-86829-956-4 © Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018 Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Namensnennung- NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland-Lizenz. Inhalt Einleitung ........................................................................................................ III Handhabung .............................................................................................. XXXII Abkürzungsverzeichnisse ....................................................................... XXXIV Allgemein ..................................................................................... XXXIV Bibliotheken ................................................................................ -

Erziehung Körper Entkörperung. Forschungen Zur Pädagogischen
Wehren, Sylvia Erziehung – Körper – Entkörperung. Forschungen zur pädagogischen Theorieentwicklung Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2020, 271 S. - (Historische Bildungsforschung) - (Dissertation, Universität Hamburg, 2018) Empfohlene Zitierung/ Suggested Citation: Wehren, Sylvia: Erziehung – Körper – Entkörperung. Forschungen zur pädagogischen Theorieentwicklung. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2020, 271 S. - (Historische Bildungsforschung) - (Dissertation, Universität Hamburg, 2018) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-202096 - DOI: 10.35468/5824 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-202096 http://dx.doi.org/10.35468/5824 in Kooperation mit / in cooperation with: http://www.klinkhardt.de Nutzungsbedingungen Terms of use Dieses Dokument steht unter folgender Creative Commons-Lizenz: This document is published under following Creative Commons-License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de - Sie dürfen das http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en - You may copy, Werk bzw. den Inhalt unter folgenden Bedingungen vervielfältigen, verbreiten distribute and transmit, adapt or exhibit the work in the public and alter, und öffentlich zugänglich machen sowie Abwandlungen und Bearbeitungen transform or change this work as long as you attribute the work in the manner des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen: Sie müssen den Namen des specified by the author or licensor. You are not allowed to make commercial Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen. Dieses use of the work. If you alter, transform, or change this work in any way, you Werk bzw. der Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. may distribute the resulting work only under this or a comparable license. Die neu entstandenen Werke bzw. Inhalte dürfen nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergegeben werden, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind. -

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation Schweiz Nord- Und Osteuropa
DIE PHILOSOPHIE DES 18. JAHRHUNDERTS BANDS HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION SCHWEIZ NORD- UND OSTEUROPA HERAUSGEGEBEN VON HELMUT HOLZHEY UND VILEM MUDROCH SCHWABE VERLAG BASEL 2014 INHALT ERSTER HALBBAND Verzeichnis der Siglen . XIX Vorwort (Helmut Holzhey und Vilem Mudroch) . XXI ERSTER TEIL HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION ERSTES KAPITEL DIE INSTITUTIONELLEN BEDINGUNGEN DER PHILOSOPHIE UND DIE FORMEN IHRER VERMITTLUNG . • . • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . 1 § 1. Der Weg zur Aufklärung an den Universitäten und Hohen Schulen (Notker Hammerstein) . 3 1. Die neuen Universitäten 3. - 2. Der Aufstieg der Philosophischen Fakultät und der Philosophie 7. - 3. Die Hohen Schulen 14. § 2. Außeruniversitäre Institutionen und regionale Zentren der Aufklärung . 15 1. Akademien, Reformgesellschaften, Geheimbünde und Salons (Helmut Reinalter) 15. - 2. Regionale Zentren der Aufklärung (Notker Hammerstein) 23. § 3. Vermittlungsinstanzen des aufklärerischen Gedankenguts und seiner Kritik (Hanspeter Marti) . 27 1. Medien der Wissensverbreitung 28. - 2. Zeitschriften 30. - 3. Zen- sur 34. - 4. Bibliotheken 37. § 4. Sprachen, Übersetzungen, literarische Formen (Ulrich Gaier) . 40 1. Latein und Deutsch 41. -2. Übersetzungen aus Nationalsprachen 43. - 3. Literarische Formen der Philosophie 46. - 4. Philosophische Fiktion 50. Sekundärliteratur zum ersten Kapitel 52 ZWEITES KAPITEL DER ThOMASIANISMUS • • . • • • . • . • • • • • . • • . • . • . • • . • . • . • . • • • . • . • • . • • • 61 Einleitung (Werner Schneiders) ........... -

Lessing's Philosophy of Religion and the German Enlightenment
Lessing's Philosophy of Religion and the German Enlightenment Recent Titles in AMERICAN ACADEMY OF RELI0GION Reection and Theory in the Study ofReligion Series SERIES EDITOR May McClintock Fulkerson, Duke University A Publication Series of The American Academy ofReligion and Oxford University Press WORKING EMPTINESS Toward a Third Reading of Emptiness in Buddhism and Postmodern Thought Newman Robert Glass WITTGENSTEIN AND THE MYSTICAL Philosophy as an Ascetic Practice Frederick Sontag AN ESSAY ON THEOLOGICAL METHOD Third Edition Gordon D. Kaufman BETTER THAN WINE Love, Poetry, and Prayer in the Thought ofFranz Rosenzweig Yudit Kornberg Greenberg HEALING DECONSTRUCTION Postmodern Thought in Buddhism and Christianity Edited byDavid Loy ROOTS OF RELATIONAL ETHICS Responsibility in Origin and Maturity in H. Richard Niebuhr Melvin Keiser HEGEL'S SPECULATIVE GOOD FRIDAY The Death ofGod in Philosophical Perspective Deland S. Anderson NEWMAN AND GADAMER Toward a Hermeneutics of Religious Knowledge Thomas K. Carr GOD, PHILOSOPHY AND ACADEMIC CULTURE A Discussion between Scholars in the AAR and the APA Edited byWilliam J. Wainwright LIVING WORDS Studies in Dialogues about Religion Terence J. Martin LIKE AND UNLIKE GOD Religious Imaginations in Modern and Contemporary Fiction John Neary BEYOND THE NECESSARY GOD Trinitarian Faith and Philosophy in the Thought ofEberhard Paul DeHart LESSING'S PHILOSOPHY OF RELIGION AND THE GERMAN ENLIGHTENMENT Toshimasa Yasukata Lessing's Philosophy of Religion and the German Enlightenment Lessing on Christianity and -

Karl Friedrich Bahrdt - Wikipedia
Karl Friedrich Bahrdt - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Bahrdt Karl Friedrich Bahrdt Karl Friedrich Bahrdt[1][2] (German pronunciation: [kaʁl ˈfʁiːdʁɪç ˈbaːɐ̯ t]; August 25, 1741 – April 23, 1792), also spelled Carl Friedrich Bahrdt,[3][4] was an unorthodox German Protestant biblical scholar, theologian, and polemicist. Controversial during his day, he is sometimes considered an "enfant terrible"[2] and one of the most immoral characters in German learning.[5] Contents Life Works Notes References Life Karl Friedrich Bahrdt. Bahrdt was born on August 25, 1741, at Bischofswerda, Upper Lusatia,[2] where his father was pastor of the local church.[1] The elder Bahrdt was later a professor,[1] canon, and general superintendent at Leipzig.[6] He received his early education at the celebrated school of Pforta,[1] but some commenters have found his training to have been grossly neglected.[6] At sixteen,[6] he enrolled in the University of Leipzig, where he studied under the mystic Christian August Crusius,[1] who was then head of the theological faculty. The boy varied the monotony of his studies by pranks which revealed his unbalanced character, including an attempt to raise spirits with the aid of Dr Faust's Höllenzwang.[6] After graduation, he lectured on biblical exegesis for a time as an adjunct to his father[1] before becoming a catechist (Katechet) at the church of St Peter. He proved an eloquent and popular preacher and returned to the university as a visiting professor (professor extraordinarius) of biblical philology.[6] He published a popular book of devotions, The Christian in Solitude, but was required to resign his positions and leave the Leipzig in 1768 on account of his irregular conduct.[1] 1 of 4 07/16/2021, 05:01 Karl Friedrich Bahrdt - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Bahrdt Christian Adolph Klotz was then able to secure him the chair in biblical antiquities at the University of Erfurt. -

How to Sabotage a Secret Society. the Demise of Carl Friedrich
DEMISE OF GERMAN UNION HOW TO SABOTAGE A SECRET SOCIETY. THE DEMISE OF CARL FRIEDRICH BAHRDT’S GERMAN UNION IN 1789.* ANDREW MCKENZIE-MCHARG University of Cambridge ABSTRACT. In 1789 in Leipzig a slim pamphlet of 128 pages appeared that sent shock waves through the German republic of letters. The pamphlet, bearing the title Mehr Noten als Text (More Notes than Text), was an ‘exposure’ whose most sensational element was a list naming numerous members of the North German intelligentsia as initiates of a secret society. This secret society, known as the German Union, aimed to push back against anti- Enlightenment tendencies most obviously manifest in the policies promulgated under the new Prussian king Frederick William II. The German Union was the brainchild of the notorious theologian Carl Friedrich Bahrdt (1741-1792). But who was responsible for the ‘exposure’? Using material culled from several archives, this article pieces together for the first time the back story to Mehr Noten als Text and in doing so uncovers a surprisingly heterogeneous network of Freemasons, publishers and state officials. The findings prompt us to reconsider general questions about the relationship of state and society in the late Enlightenment, the interplay of the public and the arcane spheres and the status of religious heterodoxy at this time. [fig.1: The title page of Mehr Noten als Text] 1 DEMISE OF GERMAN UNION I. In early modern Europe a fugitive existence was the price tag often attached to heterodoxy or dissidence. Those whose beliefs challenged the status quo had to stay one step ahead of the religious and political authorities that guarded it. -

This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. The ‘Awakening movement’ in early nineteenth-century Germany: The making of a modern and orthodox Protestantism By Andrew Alan Kloes Doctor of Philosophy The University of Edinburgh 2015 2 Declarations I, Andrew Alan Kloes, hereby certify that this thesis has been written by me; that it is the record of work carried out by me; and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. In compliance with university regulations for the assessment of research degrees, I acknowledge that some of the contents of this thesis, totaling less than 5,000 words in total, appear in the following journal articles that have been previously published or that are scheduled for publication. -
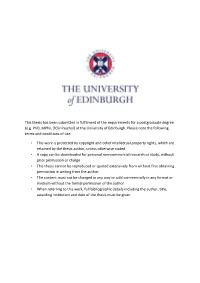
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Geography and Enlightenment in the German states, c.1690 – c.1815 Luise Fischer Doctor of Philosophy The University of Edinburgh 2014 Abstract This thesis is concerned with the science of geography in the German states during the ‘long’ eighteenth century, c.1690 – c.1815. It speaks to recent scholarly debates in historical geography, the history of science, book history, and Enlightenment studies. The thesis investigates the forms taken by eighteenth-century German geography, its meanings, and practices. This is of particular interest, since this topic is understudied. The thesis is based upon an analysis of geographical print (books and periodicals) and manuscript correspondence. The thesis proposes that geography’s definition was understood as ‘description of the earth’. The interpretative meaning of this definition, geography’s purpose in print, and its educational practice (content and methods) were, in contrast, debated. -

JOHANN GEORG HAMANN: Writings on Philosophy and Language
CAMBRIDGE TEXTS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY JOHANN GEORG HAMANN Writings on Philosophy and Language CAMBRIDGE TEXTS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY Series editors KARL AMERIKS Professor of Philosophy, University of Notre Dame DESMOND M. CLARKE Professor of Philosophy, University College Cork The main objective of Cambridge Textsin the History of Philosophy is to expand the range, variety and quality of texts in the history of philosophy which are available in English. The series includes texts by familiar names (such as Descartes and Kant) and also by less well-known authors. Wherever possible, texts are published in complete and unabridged form, and translations are specially commissioned for the series. Each volume contains a critical introduction together with a guide to further reading and any necessary glossaries and textual apparatus. The volumes are designed for student use at undergraduate and postgraduate level and will be of interest not only to students of philosophy, but also to a wider audience of readers in the history of science, the history of theology and the history of ideas. Foralist of titles published in the series, please see end of book. JOHANN GEORG HAMANN Writings on Philosophy and Language TRANSLATED AND EDITED BY KENNETH HAYNES Brown University CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521817417 © Cambridge University Press 2007 This publication is in copyright. Subject to statutory exception and to the provision of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. -

Early French and German Defenses of Freedom of the Press (Brill's
EARLY FRENCH AND GERMAN DEFENSES OF FREEDOM OF THE PRESS BRILL’S STUDIES IN INTELLECTUAL HISTORY General Editor A.J. Vanderjagt, University of Groningen Editorial Board M. Colish, Oberlin College J.I. Israel, University College, London J.D. North, University of Groningen R.H. Popkin, Washington University, St. Louis-UCLA VOLUME 113 BSIH-113-laursen.qxd 03/06/2003 09:31 Page iii EARLY FRENCH AND GERMAN DEFENSES OF FREEDOM OF THE PRESS Elie Luzac’s Essay on Freedom of Expression (1749) and Carl Friedrich Bahrdt’s On Freedom of the Press and its Limits (1787) in English Translation EDITED BY JOHN CHRISTIAN LAURSEN AND JOHAN VAN DER ZANDE BRILL LEIDEN • BOSTON 2003 BSIH-113-laursen.qxd 07/05/2003 14:58 Page iv This book is printed on acid-free paper. On the cover: Print-shop, from Denis Diderot, Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie (1765), Plates, vol. 7, opp. p. 12 (call no. AE 25 E45). Courtesy of the Bancroft Library, University of California, Berkeley. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Early French and German defenses of freedom of the press / edited and introduced by John Christian Laursen and Johan van der Zande. p. cm. (Brill’s studies in intellectual history, 0920-8607 ; v. 113) Includes bibliographical references and index. ISBN 9004130179 (alk. paper) 1. Freedom of the press—France. 2. Freedom of the press—Germany. I. Laursen, John Christian. II. Zande, Johan van der. III. Luzac, Elie, 1723-1796. IV. Bahrdt, Karl Friedrich, 1741-1792. V. Series. PN4748.F7 E27 2003 323.44/5/0943 21 ISSN 0920-8607 ISBN 90 04 13017 9 © Copyright 2003 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands All rights reserved.