Freizeit Und Erholung Im Karwendel Interreg II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Akademische Sektion Zweig Innsbruck Touristenklub Innsbruck
tmyv. Akademische Sektion Zweig Innsbruck ATS 20 Touristenklub Innsbruck SUPERANGEBOTE FÜR BERGFANS ENDURO MC KINLEY Kletterschuh „CLIFFHANGER" Nachfolger des legendären MARIACHER Wander- und Kletterrucksack s\att Super-Ausstattung Größen: 36 44 A#^ 35 Liter Inhalt SPORTIVA „TRANGO statt Allroundschuh für Bergwanderungen und 45 Liter Inhalt Klettersteig, Vibramsohle statt statt Größen: 37 - 45 NORDISK Set-Angebot **£,*,. Thermosflasche GRIVEL Gl 2, Vacuumflasche Edelstahl Steigeisen für alle Größen, für Kalt- und mit Kipphebelbindung Warmgetränke oder zum Schnüren 1 Liter (wahlweise) + GRIVEL Eispickel „JORASSES" Jedes Produkt auch JfrF einzeln erhältlich! GRIVEL Steigeisen G 10 statt-H99r- 699,- GRIVEL Steigeisen G 12 statt-WMr- 899,- MC KINLEY GRIVEL „PAMIR" Eispickel statt+rtf^ 699,- Faserpelz-Gilet GRIVEL „JORASSES" Eispickel statt-kHflr- 999, in den Farben blau und grau, Größen: S - XL INTERSPORT NAKAMURA ESCAPE V4 Mountainbike 26" OKAY 24 Gang - STX RC, DIA COMBE V-Brake, irnt Innsbruck Maria-Theresien-Str.47 Tel.051 2/5831 41 Daumenschalthebel, ohne Federqabel, IHR SPORTHAUS IM ZENTRUM 1. Service gratis, Rad-Werkstätte vis ä vis (LANDHAUSPASSAGE) O Kostenlos Parken! Parkscheine haben wir immer für Sie bereit! Innsbruck Alpin Es geht bergauf... auch mit den Subventionen für die Alpine Auskunft! Jahreshaupt versammlung f Wie vielleicht viele Alpenvereinsmitglieder wissen, betreut der ÖAV-Zweig Innsbruck des OEAV Gesamtvereines — schon seit langer Zeit die “Alpine Auskunftsstelle” für Bergsteiger, Wanderer und Touristen aus aller Herren Länder. Jeder, der in fremden Land reist, weiß wie wichtig genaue Informationen von fach Ing. Ernst Schmidt zum Gedenken kundigen Personen vor Ort sein können. Viele Fragen werden an unsere fachkom petente Auskunftsperson, Herrn Klaus Springfeld, herangetragen. Um nur einige aufzuzählen: Öffnungszeiten von Hütten,'Telefonnummern, Wegverhältnisse, Geh zeiten, Zugverbindungen, Nächtigungspreise bis hin zu Hütten für Silvesterfeiern Touristenklub reicht die Pallette. -

Field Trip 8 Innsbruck´S Geology in a Nutshell: from the Hafelekar to the Hötting Breccia 215-228 Geo.Alp, Vol
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Geo.Alp Jahr/Year: 2016 Band/Volume: 013 Autor(en)/Author(s): Krainer Karl, Meyer Michael Artikel/Article: Field trip 8 Innsbruck´s geology in a nutshell: from the Hafelekar to the Hötting Breccia 215-228 Geo.Alp, Vol. 13 2016 215 - 228 Field trip 8 Innsbruck´s geology in a nutshell: from the Hafelekar to the Hötting Breccia Karl Krainer1 and Michael Meyer1 1 Institute of Geology, University of Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck 1 Introduction Alpen, southwest of Innsbruck Stubaier Alpen and north of Innsbruck Karwendel as part of the Hafelekar Spitze provides an excellent panora- Northern Calcareous Alps. mic overview of the main geologic units around The excursion starts at the cable railway station Innsbruck. The city of Innsbruck is located on an Hungerburgbahn next to the Innsbruck Congress alluvial fan which was formed by the Sill river at Centre (Fig. 1). The Hungerburgbahn will bring us its confluence with the Inn river. The mountain onto the Hungerburg terrace (868 m), from there group southeast of Innsbruck is termed Tuxer we continue with a cablecar (Seegrubenbahn ) to Fig. 1: Map showing excursion route to Hafelekar Spitze (Wetterstein Reef Complex) and Hungerburg – Alpenzoo (Hötting Breccia). 215 Figure 1 Seegrube (1905 m) and ascend Hafelekar (2260 m) composed of the famous Höttinger Breccie (see . via a second cablecar. From the top station of the excursion route part 2 – the Hötting Breccia) Hafelekarbahn the excursion route follows the The Valley which extends from Innsbruck to the trail to Hafelekar Spitze and continues East where Brennerpass in the south (Silltal-Wipptal) repre- the trail meets the Goetheweg, one of the most sents a big west-dipping normal fault (Brenner spectacular panoramic trails around Innsbruck. -
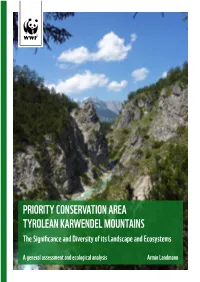
PRIORITY CONSERVATION AREA TYROLEAN KARWENDEL MOUNTAINS the Significance and Diversity of Its Landscape and Ecosystems
PRIORITY CONSERVATION AREA TYROLEAN KARWENDEL MOUNTAINS The Significance and Diversity of its Landscape and Ecosystems A general assessment and ecological analysis Armin Landmann PRIORITY CONSERVATION AREA TYROLEAN KARWENDEL MOUNTAINS The Significance and Diversity of its Landscape and Ecosystems A general assessment and ecological analysis Armin Landmann editor: WWF Austria as per Februar 2015 author: Univ.- Doz. Mag. Dr. Armin Landmann, Karl Kapfererstr.3, A-6020 Innsbruck, Austria (mail: [email protected]) citation: Landmann, A. (2015): Priority conservation area Tyrolean Karwendel Mountains: The Significance and Diversity of its Landscape and Ecosystems. WWF Österreich coordination: Karin Enzenhofer design: Andreas Zednicek CONTENTS Preface 6 1. The Tyrolean Karwendel Mountains: Geographical position, boundaries and size 8 2. PCA Karwendel Mountains: General natural characteristics and landscape settings 10 3. Aquatic and terrestrial ecosystems: an overview and balance 17 3.1 Freshwater systems 17 3.2 Terrestrial ecosystems and habitats 21 4. Biodiversity and conservation value of habitats, plant and animal communities 28 4.1 Aquatic and riverine habitats and organisms 28 4.2 Protected and endangered terrestrial habitats and plant communities 29 4.3 Endemism, biodiversity and specificity of terrestrial organisms 32 4.3.1 Endemism 32 4.3.2 Biodiversity and value of vascular plants, fungi, mosses and lichens 34 4.3.3 Biodiversity and value of animals: selected Invertebrates and Vertebrates 37 5. Dimension and significance of human impact; cultural and scientific values 43 5.1 Cultural history and values; dimension and degree of human impact 43 5.2 Scientific value; research 49 6. Conservation and threats 50 6.1 Dimension and significance of conservation reserves 50 6.2 Threats and Management 52 6.3 Proposed actions 54 7. -
Naturpark Karwendel
KARTENLEGENDE Schutzhütte, Berggasthof Hotel, Gasthof, Restaurant Jausenstation, Almwirtschaft Hütte/Biwak (unbewirtschaftet) Berggipfel Bergkette Kirche, Kloster Denkmal Weg Fußweg Steig Weg (Variante) Fußweg (Variante) Steig (Variante) Gehrichtung Gehrichtung (Variante) 201/201 Wegnummern Eisenbahn, S-Bahn Hauptstraße Nebenstraße Bach, Fluss Brücke Seilbahn/Gondel/Materialseilbahn Bedeutsamer Punkt Bahnhof, S-Bahn-Haltestelle Parkplatz Bushaltestelle Krankenhaus Touristeninformation 112 140 Euro-Notruf Österr. Bergrettung ÜBERSICHT DER WANDERTOUREN Sylvenstein-Stausee Fall Juifen 19 1988 Isar 12 13 Schafreiter Achenkirch 2101 4 Krün Mondscheinspitze 2106 8 14 Hinterriß 20 Achensee Mittenwald Rißbach 19 9 14 Mahnkopf Pertisau 2094 18 Eng Pleisenspitze 2569 Birkkar- Lamsenspitze spitze 11 2508 Scharnitz 3 7 2 2749 18 Jenbach 5 20 Stans Großer Bettelwurf Schwaz 15 2726 Seefeld Erlspitze 2405 16 Großer Solstein 6 1 2541 Absam Reith bei 17 10 Seefeld Rum Hall in Tirol Hochzirl Innsbruck Zirl Kranebitten 3 INHALTSVERZEICHNIS Kartenlegende und Notrufnummern (Umschlagklappe vorne) Übersicht der Wandertouren 2 Vorwort 4 Einleitung 5 Tourenplanung 8 Tipps für Ihre Sicherheit 9 Verhaltenstipps 12 EINTAGESTOUREN 1 Durch die Schlossbachklamm (Sanfte Tour) 14 2 Vom Großen Ahornboden zur Binsalm (Sanfte Tour) 16 3 Rund um die Karwendelschlucht (Sanfte Tour) 18 4 Zur Moosenalm am Achensee (Sanfte Tour) 20 5 Durch die Wolfsklamm nach St. Georgenberg (Sanfte Tour) 22 6 Geschichte und Natur im wilden Halltal 24 7 Auf den Gipfel der Pleisenspitze 26 8 Zur -

Unlimited B2B HANDBUCH 2017/18 Sehr Geehrte Reiseveranstalter Und Busunternehmer
DE WWW.INNSBRUCK.INFO #MYINNSBRUCK unlimited B2B HANDBUCH 2017/18 Sehr geehrte Reiseveranstalter und Busunternehmer, es freut uns, dass Sie sich für die Region Innsbruck interessieren! Hiermit halten Sie das „B2B Handbuch“ 2017/18 in Händen, welches Ihnen als Arbeitserleichterung dienen und einen möglichst guten Überblick über unsere Region liefern soll. Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über Sehenswürdigkeiten, Stadt- führungen, die Innsbruck Card, den Busparkplatz im Zentrum Innsbrucks, jährlich wiederkehrende Veranstaltungen und vieles mehr. Die im Handbuch angegebenen Preise dienen als Anhaltspunkte. Natürlich erhalten Sie Incomingpreise bei den jeweiligen Institutionen auf Anfrage. Die Innsbruck Card beinhaltet alle Museen und Ausstellungen sowie Bergbahnen und öffentliche Verkehrsmittel. Die an der Innsbruck Card teilnehmenden Betriebe sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Sie als (Gruppen-)Reiseveranstalter erhalten natürlich Sonderkonditionen, bitte fragen Sie einfach direkt bei uns nach! Zur Planung Ihrer Reise stehen wir Ihnen gerne jederzeit kompetent und kostenlos zur Verfügung. Unsere Kollegen der Innsbruck Information und Reservierung GmbH sind Ihnen gerne bei der Buchung von Unterkünften sowie bei Reservierungen von Stadtführungen behilflich. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Blättern und freuen uns, Sie bald in der Region Innsbruck begrüßen zu dürfen. Gerne erhalten Sie auf Wunsch weitere Informationen und Broschüren, beispielsweise zu den Themen Innsbruck Card, Busparkplatz, Hotel-Preislisten, -
Mit Öffentlicher Anreise Kartenlegende
mit öffentlicher Anreise KARTENLEGENDE Schutzhütte, Berggasthof Hotel, Gasthof, Restaurant Jausenstation, Almwirtschaft Hütte/Biwak (unbewirtschaftet) Berggipfel Bergkette Kirche, Kloster Denkmal Weg Fußweg Steig Weg (Variante) Fußweg (Variante) Steig (Variante) Gehrichtung Gehrichtung (Variante) 201/201 Wegnummern Eisenbahn, S-Bahn Hauptstraße Nebenstraße Bach, Fluss Brücke Seilbahn/Gondel/Materialseilbahn Bedeutender Punkt Bahnhof, S-Bahn-Haltestelle Parkplatz Bushaltestelle Krankenhaus Touristeninformation 112 140 Euro-Notruf Österr. Bergrettung ÜBERSICHT DER WANDERTOUREN Sylvenstein-Stausee Fall Juifen 17 1988 Isar 10 11 Schafreiter Achenkirch 2101 4 Krün 18 Mondscheinspitze 2106 7 12 Hinterriß Achensee Mittenwald Rißbach 17 12 Mahnkopf Pertisau 2094 16 Eng Pleisenspitze 2569 Birkkar- spitze 9 Scharnitz 3 6 2 2749 16 Jenbach Stans Großer Bettelwurf Schwaz 13 2726 Seefeld Erlspitze 2405 18 14 Großer Solstein 5 1 2541 Absam Reith bei 15 8 Seefeld Rum Hall in Tirol Hochzirl Innsbruck Zirl Kranebitten 3 INHALTSVERZEICHNIS Kartenlegende und Notrufnummern (Umschlagklappe vorne) Übersicht der Wandertouren 2 Vorwort 4 Einleitung 5 Tourenplanung 8 Tipps für Ihre Sicherheit 9 Verhaltenstipps 12 EINTAGESTOUREN 1 Durch die Schlossbachklamm (Sanfte Tour) 14 2 Vom Großen Ahornboden zur Binsalm (Sanfte Tour) 16 3 Rund um die Karwendelschlucht (Sanfte Tour) 18 4 Zur Moosenalm am Achensee (Sanfte Tour) 20 5 Geschichte und Natur im wilden Halltal 22 6 Auf den Gipfel der Pleisenspitze 24 7 Zur Seekarspitze hoch überm Achensee 26 8 Grandiose Tiefblicke -

PRIORITY CONSERVATION AREA TYROLEAN KARWENDEL MOUNTAINS the Significance and Diversity of Its Landscape and Ecosystems
PRIORITY CONSERVATION AREA TYROLEAN KARWENDEL MOUNTAINS The Significance and Diversity of its Landscape and Ecosystems A general assessment and ecological analysis Armin Landmann PRIORITY CONSERVATION AREA TYROLEAN KARWENDEL MOUNTAINS The Significance and Diversity of its Landscape and Ecosystems A general assessment and ecological analysis Armin Landmann editor: WWF Austria as per Februar 2015 author: Univ.- Doz. Mag. Dr. Armin Landmann, Karl Kapfererstr.3, A-6020 Innsbruck, Austria (mail: [email protected]) citation: Landmann, A. (2015): Priority conservation area Tyrolean Karwendel Mountains: The Significance and Diversity of its Landscape and Ecosystems. WWF Österreich coordination: Karin Enzenhofer design: Andreas Zednicek CONTENTS Preface 6 1. The Tyrolean Karwendel Mountains: Geographical position, boundaries and size 8 2. PCA Karwendel Mountains: General natural characteristics and landscape settings 10 3. Aquatic and terrestrial ecosystems: an overview and balance 17 3.1 Freshwater systems 17 3.2 Terrestrial ecosystems and habitats 21 4. Biodiversity and conservation value of habitats, plant and animal communities 28 4.1 Aquatic and riverine habitats and organisms 28 4.2 Protected and endangered terrestrial habitats and plant communities 29 4.3 Endemism, biodiversity and specificity of terrestrial organisms 32 4.3.1 Endemism 32 4.3.2 Biodiversity and value of vascular plants, fungi, mosses and lichens 34 4.3.3 Biodiversity and value of animals: selected Invertebrates and Vertebrates 37 5. Dimension and significance of human impact; cultural and scientific values 43 5.1 Cultural history and values; dimension and degree of human impact 43 5.2 Scientific value; research 49 6. Conservation and threats 50 6.1 Dimension and significance of conservation reserves 50 6.2 Threats and Management 52 6.3 Proposed actions 54 7. -
Broschüre Allgemeine Informationen Zur Sicherheit Im Gebirge, Zum Naturpark Karwendel, Zur Mobilität in Der Region Und Zur Stadt Innsbruck
Von Hütte zu Hütte Karwendel Höhenweg 2 Inhalt Das Karwendelgebirge � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 Bergwandern im größten Naturpark Österreichs Die Arbeitsgemeinschaft Karwendel Höhenweg Anreise � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6-7 Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Pkw Fahrzeiten der Bergbahnen Der Karwendel Höhenweg – Ein Überblick � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8-9 Höhenprofil Gut zu wissen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 Gut vorbereitet unterwegs Notfälle im Gebirge � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 Notrufnummern Rucksack-Apotheke Alpines Notsignal Grundregel beim Packen des Rucksacks Schwierigkeitsangaben � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12-13 Im Gebirge unterwegs � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14-16 Unterwegs in hochalpinem Gelände Das Wetter im Gebirge Vorsicht Altschnee! Tücken des Untergrundes Ausrüstung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

Im Karwendel Eckzähne Über Dem Inntal
DAV Panorama 4/2012 Im Karwendel Eckzähne über dem Inntal Der Autor am fel- sigen Eckzahn ober- halb des Reither Jochs, mit Sicht auf mehrere Karwen- delketten und bis nach Mittenwald. 28 DAV Panorama 4/2012 Karwendel | Unterwegs Im Karwendel Eckzähne über dem Inntal Inntalkette, Nordkette oder „Erste Karwendelkette“. Die Berge über Innsbruck haben viele Namen – und einen 2000-Meter-Tiefblick ins Tal! Zudem bieten die Karwendel-Eckpfeiler Reither Spitze und Bettelwurf Weitblicke vom Feinsten. Dazwischen liegt eine abwechslungsreiche Mehrtagestour zwischen Leise und Laut, zwischen urigem Bergerlebnis und urbaner Nähe. Und beides ist oft nur weniger als einen Steinwurf voneinander entfernt! Text und Fotos von Heinz Zak 29 DAV Panorama 4/2012 er sonnige Tag sorgt bereits stockender Kolonnenverkehr, aber bei in der Standseilbahn hi der Aussicht und den wenigen Hö nauf zur Rosshütte für gute henmetern alles kein Stress. Stimmung. Bei der Weiter fahrt mit der Gondelbahn Richtung Härmeler wird es stiller – Geselliger Auftakt über Seefeld Ddie Bahn schwebt etwa zweihundert Biergartenatmosphäre auf dem Gip Meter hoch über eine Schlucht, so fel der Reither Spitze. Witze, Sprüche, dass mancher etwas beklommen in gute Laune. Ein Durcheinander von die Tiefe starrt. Nach dem Aussteigen Dialekten und Sprachen. Dicht ge wenden sich die meis ten Richtung drängt wie in einer Vogelkolonie sit Berg, andere haben die Wiese knapp zen zwei Dutzend Besucher auf dem unterhalb der Bahn als wunderbaren Aussichts Ziel – einen perfekten gipfel, der jedem einen Startplatz für Paragleiter. Schier endlos reicht exzellenten Logenplatz Die steile Bergwiese ist die Aussicht auf das bietet für den sehens vollgepflastert mit bun Seefelder Plateau und werten Panoramarund ten Schirmen. -

Hüttenwanderung Auf Dem Karwendel-Höhenweg Geführte Tour 26.07
Hüttenwanderung auf dem Karwendel-Höhenweg Geführte Tour 26.07.2020 bis 31.07.2020 Das Karwendel ist ein Gebirgsmassiv voller Gegensätze. Von tiefen Tälern mit klaren Bächen über grüne Almwiesen und schroffes Blockgelände bis hinauf zu steilen Felswänden werden wir während unserer Wanderung viel von der Schönheit des größten Naturparks Österreichs sehen und die herrlichen Ausblicke des Höhenweges genießen. Unsere Tour führt auf markierten Wegen und Steigen durch alpines Gelände und ihr liegen weitgehend moderate Gehzeiten zugrunde. 26.07.20 Anreise nach Scharnitz (Bezirk Innsbruck Land), Übernachtung individuell buchen 27.07.20 Durch das Hinterautal hinauf, vorbei am Quellgebiet der Isar und einer Einkehr auf der Kastenalm zum Hallerangerhaus (1786 m) - Aufstieg 900 Hm Abstieg 80 Hm 19 Km Gehzeit 5 Std. 28.07.20 Aufstieg zum Lafatscher Joch (2081 m) und weiter auf dem Wilde-Bande-Steig zum Stempeljoch (2215 m). Über einen breiten Grat auf die Stempelspitze (2543 m) und nach einer Gipfelrast Abstieg zur Pfeishütte (1922 m) - Aufstieg 900 Hm Abstieg 750 Hm 9,5 Km Gehzeit 5 Std. 29.07.20 Aufstieg zur Mannlscharte (2314 m) und auf dem Goetheweg zur Hafelekarspitze. Nach einer Pause im Berghotel Seegrube überschreiten wir die Nordkette beim Frau Hitt-Sattel (2235 m), steigen steil in das Kar ab und danach geht es noch einmal hinauf zum Solsteinhaus (1805 m) Aufstieg 1200 Hm Abstieg 1300 Hm 16,5 Km 8 Std. 30.07.20 Über die Eppzirler Scharte (2102 m) und den Breiten Sattel (1794 m) zur Nördlinger Hütte (2239 m). “Wegen der exponierten Lage am Grat unterhalb der Reither Spitze sind wir der per-fekte Stützpunkt für einzigartige Sonnenuntergänge und traumhafte Ausblicke in die Tiroler Alpenwelt“ (aus Homepage der Hütte) - Aufstieg 800 Hm Abstieg 350 Hm 7 Km Gehzeit 4 Std. -

Field Trip 8 Innsbruck´S Geology in a Nutshell
Geo.Alp, Vol. 13 2016 215 - 228 Field trip 8 Innsbruck´s geology in a nutshell: from the Hafelekar to the Hötting Breccia Karl Krainer1 and Michael Meyer1 1 Institute of Geology, University of Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck 1 Introduction Alpen, southwest of Innsbruck Stubaier Alpen and north of Innsbruck Karwendel as part of the Hafelekar Spitze provides an excellent panora- Northern Calcareous Alps. mic overview of the main geologic units around The excursion starts at the cable railway station Innsbruck. The city of Innsbruck is located on an Hungerburgbahn next to the Innsbruck Congress alluvial fan which was formed by the Sill river at Centre (Fig. 1). The Hungerburgbahn will bring us its confluence with the Inn river. The mountain onto the Hungerburg terrace (868 m), from there group southeast of Innsbruck is termed Tuxer we continue with a cablecar (Seegrubenbahn ) to Fig. 1: Map showing excursion route to Hafelekar Spitze (Wetterstein Reef Complex) and Hungerburg – Alpenzoo (Hötting Breccia). 215 Figure 1 Seegrube (1905 m) and ascend Hafelekar (2260 m) composed of the famous Höttinger Breccie (see . via a second cablecar. From the top station of the excursion route part 2 – the Hötting Breccia) Hafelekarbahn the excursion route follows the The Valley which extends from Innsbruck to the trail to Hafelekar Spitze and continues East where Brennerpass in the south (Silltal-Wipptal) repre- the trail meets the Goetheweg, one of the most sents a big west-dipping normal fault (Brenner spectacular panoramic trails around Innsbruck. Abschiebung) which formed as a result of N-S- Following the Goetheweg we come back to the compression and E-W-extension of the Eastern cablecar station at Hafelekar. -

Die Top 10 Im Karwendel
Die Top 10 im Karwendel Schutzhütte, Gehrichtung Berggasthof (Variante) Von A wie Ahornboden bis W wie Wolfsklamm Hotel, Gasthof, 201/201 Wegnummern Restaurant Jausenstation, 1 GROSSER AHORNBODEN 500 Kühe grasen auf der größten Eisenbahn, S-Bahn Alm des Karwendels zwischen 2000 uralten Ahornbäumen, Almwirtschaft eingerahmt von den Felswänden des Hauptkamms. Hütte/Biwak Hauptstraße → Touren 2, 11, 18, 19 (unbewirtschaftet) 2 GLEIRSCHKLAMM Wie ein offenes Buch der Geologie muten Berggipfel Nebenstraße die Gesteinsschichten an, die durch die Klamm offengelegt wurden. Neben Fossilien findet man in der ursprünglichen Bergkette Bach, Fluss Gleirschklamm auch Orchideen. 3 HAFELEKAR Kontrastreicher Gipfelgrat zwischen der Lan- Kirche, Kloster Brücke des-hauptstadt Innsbruck und den fast endlosen Weiten des Seilbahn/Gondel/ Denkmal Naturparks Karwendel. → Tour 10 Materialseilbahn 4 HALLTAL Leicht vom Inntal erreichbar und doch wildroman- Weg Bedeutsamer Punkt tisch und abgelegen – das Halltal bietet nicht nur zauber- hafte Natur, sondern auch reichlich Geschichte zum Salz- Bahnhof, Fußweg bergbau. → Touren 6, 15, 20 S-Bahn-Haltestelle 5 HINTERRISS Die einzige Dauersiedlung im Karwendel ist Steig Parkplatz nicht nur romantisch abgeschieden, sondern auch reich an lokaler Geschichte. → Touren 13, 14, 19 Weg (Variante) Bushaltestelle WANDERN IM 6 HOCHPLATTE Über dem Achensee bietet die Hochplatte Fußweg (Variante) Krankenhaus blühende Wiesenhänge, Steinböcke, Gämsen, Murmeltiere, NATURPARK KARWENDEL Adler und einen Weitblick, der seinesgleichen sucht. Touristen- Steig (Variante) → Touren 4, 12 MIT ÖFFENTLICHER ANREISE information 7 ISARURSPRUNG Wo die Isar noch eine Tirolerin isch – Gehrichtung zwischen Moosbänken entspringt der grüne Fluss im Herzen des Karwendels. → Tour 20 8 LALIDERERWÄNDE Die wohl spektakulärsten Felswände der Nordalpen. → Touren 11, 18 9 MONDSCHEINSPITZE Den einmaligen Ausblick vom zerklüf- teten Gipfel genießen hier auch Steinböcke.