Vollständige Ausgabe 6 / 1998 Öffnen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SUB 1998 Zemaiciu Bk.Pdf
Giedrius Subaçius Ûemaiçi¨ bendrin∂s kalbos id∂jos KALBOS UGDYMO PROGRAMA Giedrius Subaçius Ûemaiçi¨ bendrin∂s kalbos id∂jos XIX amΩiaus pradΩia MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJË LEIDYBOS INSTITUTAS VILNIUS 1998 2 ÛEMAIÇIË BK IDÎJOS 3 ÈVADAS UDK 808.82–087 Su-02 Recenzavo Turinys prof. habil. dr. Lietuvos MA narys korespondentas Aleksas Girdenis, prof. habil. dr. Lietuvos MA narys Zigmas Zinkeviçius Pratarm∂...... 12 1. Èvadas...... 14 1. 1. Ûemaiçiai...... 14 Subaçius, Giedrius 1. 2. Europos kontekstas ir bendrin∂s kalbos pob∆dis...... 17 Su-02 Ûemaiçi¨ bendrin∂s kalbos id∂jos/Giedrius Subaçius. – Vil- 1. 3. Bendrin∂ kalba...... 20 nius: Mokslo ir enciklopedij¨ leidybos inst., 1998. – 490 p: 1. 4. Såmoningos intencijos norminti...... 23 iliustr. Santr. Angl. – Bibliogr., p. 464–479 ir ißnaßose. – Asmen¨ 1. 5. Måstymo apie bendrin´ kalbå kategorijos...... 27 r-kl∂: p: 481. 1. 6. Klasifikacijos ir apraßymo principai...... 30 ISBN 5–420–01427–0 1. 7. Ûemaitißk¨ ypatybi¨ pastebimumas Ωemaiçiams...... 32 Ûemaiçiai XIX a. pirmojoje pus∂je pretendavo perimti pagrindinio etnoso funkcijas, ir j¨ raßtai ∂m∂ 1. 8. 1737 met¨ Universitas Lingvarum Litvaniae raßybos tradicija...... 39 stelbti aukßtaitißkuosius. Íioje knygoje pagrindinis d∂mesys ir skiriamas trij¨ XIX a. deßimtmeçi¨ pastan- goms kurti bendrin´ kalbå Ωemaiçi¨ tarmi¨ pagrindu. Taigi ßi knyga – pastang¨ norminti kalbå istorijos analiz∂, sociolingvistin∂ istorijos studija. 2. XVIII amΩiaus Ωemaiçi¨ raßtai...... 44 2. 1. 1759 met¨ Ûyvatas Pono ir Dievo m∆s¨ J∂zuso Christuso...... 44 UDK 808.82–087 2. 1. 1. Ûemaiçi¨ tarm∂s pasirinkimas...... 44 2. 1. 2. Raßybos tradicija ir naujov∂s...... 50 2. 1. 3. Nebendrin∂ raßomoji Ωemaiçi¨ kalba...... 57 2. -
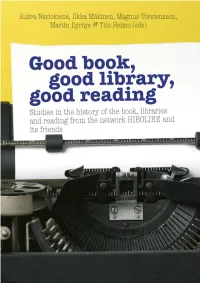
978-951-44-9143-6.Pdf
GOOD BOOK, GOOD LIBRARY, GOOD READING Aušra Navickienė Ilkka Mäkinen Magnus Torstensson Martin Dyrbye Tiiu Reimo (eds) GOOD BOOK GOOD LIBRARY GOOD READING Studies in the History of the Book, Libraries and Reading from the Network HIBOLIRE and Its Friends Contents Preface .................................................................................. 7 Magnus Torstensson Introduction ......................................................................... 9 Good Book Elisabeth S. Eide The Nobleman, the Vicar and a Farmer Audience Norwegian Book History around 1800 ................................ 29 Lis Byberg What Were Considered to be Good Books in the Time of Popular Enlightenment? The View of Philanthropists Compared to the View of a Farmer ....................................... 52 Aušra Navickienė The Development of the Lithuanian Book in the First Half © 2013 Tampere University Press and Authors of the Nineteenth Century – A Real Development? .............. 76 Aile Möldre Page Design Maaret Kihlakaski Good Books at a Reasonable Cost – Mission of a Good Publisher: Cover Mikko Reinikka the Case of Eesti Päevaleht Book Series ................................ 108 ISBN 978-951-44-9142-9 ISBN 978.951-44-9143-6 (pdf) Good Library Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print Stefania Júliusdóttir Tampere 2013 Reading Societies in Iceland. Their foundation, Role, Finland and the Destiny of Their Book Collections ........................... 125 Contents Preface ................................................................................. -

Plik Z Zawartością Zeszytu
P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T B A D A Ń L I T E R A C K I C H CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ ROCZNIK CIV, ZESZYT 2 1-4.indd 1 2013-06-17 13:20:04 Z A Ł O Ż O N Y W R O K U 1 9 0 2 P R Z E Z T O W A R Z Y S T W O L I T E R A C K I E I M I E N I A A D A M A M I C K I E W I C Z A Komitet redakcyjny: GRAŻYNA BORKOWSKA (redaktor naczelny), MICHAŁ GŁOWIŃSKI (zastępca redaktora naczelnego), TERESA KOSTKIEWICZOWA (zastęp- ca redaktora naczelnego), ADAM DZIADEK, WOJCIECH GŁOWALA, LUIGI MARINELLI, ANDRZEJ SKRENDO, LUDWIKA ŚLĘKOWA, krzysztof trybuś Sekretarz redakcji: ZOfIA SMOLSKA Projekt okładki: JOANNA MUCHO Opracowanie redakcyjne i korekta: AGNIESZKA MA- GREL, JOANNA nowak, ZOfia Smolska, dorota UCHEREK Tłumaczenie streszczeń: TOMASZ P. GÓRSKI Opracowanie typograficzne i łamanie: Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Literatury i Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego © Copyright by fundacja Akademia Humanistyczna and Instytut Badań Literackich PAN, Wrocław–Warszawa 2013 Objętość: ark. wyd. 21,75; ark. druk. 17 Nakład: 600 egz. 1-4.indd 2 2013-06-17 13:20:04 TREŚĆ ZESZYTU Str. I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY 1. B e a t a U t k o w s k a, Sporny wzorzec rusofobii. -

Žemaičių Krikšto Kelio Vadovas
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO KELIO VADOVAS Parengė: mons. Rimantas Gudlinkis Telšiai 2013 1 Įvadas Prieš 600 metų, 1413 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Aleksandras ir Lenkijos karalius Jogaila Vladislovas, lydimi kunigų, sėdo Kaune į laivą, plaukdami Nemunu ir Dubysa, pasiekė Žemaitiją ir pradėjo žemaičių krikštą. Su šiuo mons. Rimanto Gudlinkio parengtu kelionių vadovu kviečiu šiais, Jubiliejiniais Žemaičių krikšto metais, keliauti Vytauto ir Jogailos keliais, raginu tapti piligrimais, kad geriau pažintume save, Bažnyčią ir savo gimtąjį kraštą, kad sutiktume gyvąjį Dievą ir įtikėtume, kaip kadaise į Jį įtikėjo mūsų protėviai, įtikėjo ir tuo tikėjimu gyveno, jį liudijo taip, kad svečių šalių keliautojai Žemaitiją pavadino šventa. Šis mons. Rimanto Gudlinkio parengtas kelionių aprašymas prasideda nuo Kauno arkikatedros bazilikos ir baigiasi svarbiausia Telšių vyskupijos piligrimine vieta Žemaičių Kalvarija. Piligrimas, perskaitęs šį kelionių aprašymą, gali susidaryti savo kelionių maršrutą, priklausomai nuo interesų ir turimo laiko. Norėčiau išskirti svarbesnius kelionės punktus: Kaunas, Veliuona, Ariogala, Gėluvos piliakalnis (Birutkalnis), Šiluva, Tytuvėnai, Šatrijos piliakalnis, Luokė, Varniai, Telšiai, Alsėdžiai, Žemaičių Kalvarija. Tegu šis trumpas kelionių vadovas Žemaitijos krikšto keliais paskatina šiais jubiliejiniais metais žemaičius, lietuvius ir svečius keliauti ir atrasti savo šventąją Žemaitiją. Istorikė Janina Bucevičė 2 Turinys Pratarmė.........................................................................................................................2 -

Archivum Lithuanicum 4 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS
I S S N 1 3 9 2 7 3 7 X I S B N 3 4 4 7 0 9 2 7 0 X Archivum Lithuanicum 4 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS ÐIAULIØ UNIVERSITETAS VILNIAUS UNIVERSITETAS VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS ARCHIVUM Lithuanicum 4 HARRASSOWITZ VERLAG WIESBADEN 2002 Redaktoriø kolegija / Editorial Board: HABIL. DR. Giedrius Subaèius (filologija / philology), (vyriausiasis redaktorius / editor), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO DR. Ona Aleknavièienë (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Roma Bonèkutë (filologija / philology), KLAIPËDOS UNIVERSITETAS PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics), UNIVERSITÀ DI PISA DR. Jolanta Gelumbeckaitë (filologija / philology), HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK, WOLFENBÜTTEL LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Birutë Kabaðinskaitë (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS DOC. DR. Rûta Marcinkevièienë (filologija / philology), VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS DR. Bronius Maskuliûnas (filologija / philology), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS MGR. Jurgis Pakerys (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS PROF. HABIL. DR. Jochen D. Range (kalbotyra / linguistics), ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics), MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics), PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY DOC. DR. Janina Ðvambarytë (filologija / philology), ÐIAULIØ -

Metraštis XLII
427 Lietuvių kataLikų moksLo akademija METRAšTIS XLII VILNIUS ● 2019 1 issN 1392-0502 Lietuvių kataLikų moksLo akademija Lietuvių kataLikų moksLo akademijos METRAšTIS XLII VILNIUS, 2019 2 Projekto kodas: Nr. 09.3.3-esFa-v-711-01-0004 Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas Lkma metRaŠtis, t. XLii / LCas aNNuaLs, vol. XLii seRija a / seRies a RedakCiNĖ koLeGija Lkma akad. doc. dr. arūnas streikus (vilniaus universitetas, istorija) – redakcinės kolegijos pirmininkas doc. dr. Povilas aleksandravičius (mykolo Romerio universitetas, filosofija) Lkma akad. prof. habil. dr. danutė Gailienė (vilniaus universitetas, psichologija) Lkma akad. doc. dr. kęstutis Girnius (vilniaus universitetas, filosofija) Lkma akad. doc. dr. Liudas jovaiša (vilniaus universitetas, istorija) vysk. dr. algirdas jurevičius (vytauto didžiojo universitetas, teologija) dr. katarzyna korzeniewska-Wolek (nepriklausoma tyrėja ir vertėja, krokuva, Lenkija, sociologija) Prof. dr. kun. tadeusz krahel (Wyższe seminarium duchowne w Białymstoku, Lenkija, istorija) dr. Rasa mažeika (archives of Canada, toronto, kanada, istorija) Lkma akad. prof. habil. dr. irena Regina merkienė (Lietuvos istorijos institutas, etnologija) Lkma akad. prof. habil. dr. Guido michelini (università degli studi di Parma, italija, filologija) Prof. dr. algis Norvilas (saint Xavier universitetas, Chicago, JAV, psichologija) Lkma akad. doc. dr. kun. arvydas Ramonas (klaipėdos universitetas, teologija) Lkma akad. prof. dr. Paulius v. subačius (vilniaus universitetas, literatūrologija) Prof. dr. mindaugas stankūnas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Griffith university,a ustralija, biomedicina) Prof. dr. andrius valevičius (L’université de sherbrooke, kanada, filosofija) Prof. habil. dr. Rafał Witkowski (uniwersytet im. adama mickiewicza w Poznaniu, Lenkija, istorija) dr. mikas vaicekauskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, literatūrologija) – vyriausiasis redaktorius © Lkma, 2019 issN 1392-0502 Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2019, t. -
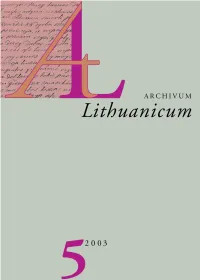
Alt 5 2003.Pdf
I S S N 1 3 9 2 - 7 3 7 X I S B N 3-447-09312-9 Archivum Lithuanicum 5 1 2 Archivum Lithuanicum 5 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS ÐIAULIØ UNIVERSITETAS VILNIAUS UNIVERSITETAS VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS ARCHIVUM Lithuanicum 5 HARRASSOWITZ VERLAG WIESBADEN 2003 3 Redaktoriø kolegija / Editorial Board: HABIL. DR. Giedrius Subaèius (filologija / philology), (vyriausiasis redaktorius / editor), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO DR. Ona Aleknavièienë (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Roma Bonèkutë (filologija / philology), KLAIPËDOS UNIVERSITETAS PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics), UNIVERSITÀ DI PISA DR. Jolanta Gelumbeckaitë (filologija / philology), HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK, WOLFENBÜTTEL LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Birutë Kabaðinskaitë (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS HABIL. DR. DOC. Rûta Marcinkevièienë (filologija / philology), VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS DR. Bronius Maskuliûnas (filologija / philology), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS MGR. Jurgis Pakerys (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS PROF. HABIL. DR. Jochen D. Range (kalbotyra / linguistics), ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics), MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG, FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics), PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY DOC. DR. Janina Ðvambarytë (filologija / philology), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS © Lietuviø kalbos institutas 4 Archivum Lithuanicum 5 Archivum Lithuanicum 5 This year (2003) the second Archivum Lithuanicum scholarship was awarded to Ðiauliai University doctoral student Robertas Gedrimas. This scholarship was es- tablished in 2002 by Mr. Robin Neumann of Chicago. It is awarded to a graduate student, either a masters or a doctoral student, engaged in research on the external history of some language. -

Alt 4 2002.Pdf
I S S N 1 3 9 2 7 3 7 X I S B N 3 4 4 7 0 9 2 7 0 X Archivum Lithuanicum 4 16 Archivum Lithuanicum 4 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS ÐIAULIØ UNIVERSITETAS VILNIAUS UNIVERSITETAS VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS ARCHIVUM Lithuanicum 4 HARRASSOWITZ VERLAG WIESBADEN 2002 Redaktoriø kolegija / Editorial Board: HABIL. DR. Giedrius Subaèius (filologija / philology), (vyriausiasis redaktorius / editor), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO DR. Ona Aleknavièienë (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Roma Bonèkutë (filologija / philology), KLAIPËDOS UNIVERSITETAS PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics), UNIVERSITÀ DI PISA DR. Jolanta Gelumbeckaitë (filologija / philology), HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK, WOLFENBÜTTEL LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Birutë Kabaðinskaitë (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS DOC. DR. Rûta Marcinkevièienë (filologija / philology), VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS DR. Bronius Maskuliûnas (filologija / philology), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS MGR. Jurgis Pakerys (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS PROF. HABIL. DR. Jochen D. Range (kalbotyra / linguistics), ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics), MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics), PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY DOC. DR. Janina Ðvambarytë (filologija -

XVIII–XIX Amžiaus Lietuviškų Tekstų Grafemos
Archivum Lithuanicum 5, 2003 ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09312-9 Giedrius Subaèius Lietuviø kalbos institutas, Vilnius University of Illinois at Chicago XVIIIXIX amþiaus lietuviðkø tekstø grafemos <I>, <J> Ðiame straipsnyje analizuoju Didþiosios Lietuvos XVIII amþiaus spaudiniø ir XIX amþiaus rankraðèiø tekstø didþiøjø raidþiø (grafemø) <I> ir <J> vartosenà. Keliamas uþdavinys nustatyti: 1) <I> ir <J> distribucijà XVIII amþiaus spaudiniuo- se ir perëjimo laikà prie modernios sistemos, kur <I> vartojama garsui [i], o <J> garsui [j] þymëti; 2) <I> ir <J> distribucijà XIX amþiaus rankraðèiuose ir perëjimo prie modernios sistemos laikà; 3) atotrûká tarp spaudiniø ir rankraðèiø vartosenos bei jo prieþastis. Ankstesniø amþiø raidþiø <I> ir <J> vartojimas ðiame ALt tome ðiek tiek aptariamas Jolantos Gelumbeckaitës (Pirmas lietuviðkas pamokslø rin- kinys Wolfenbüttelio postilë [1573]. Rankraðèio kritinio komentuoto leidimo prin- cipai ir tyrimo strategija, p. 8182; rec.: Friedrich Scholz [Hrsg.], Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes Bretke, 2003, p. 302303). 1. XVIII AMÞIAUS LDK SPAUDINIAI. Maþdaug iki XVIII amþiaus pra- dþios LDK lietuviðkuose raðtuose vyravo gotikiniø formø spausdinti tekstai, o gotikiniai ðriftai visai neskyrë didþiosios <I> nuo didþiosios <J>, buvo spausdina- ma viena raidë, tinkanti atstovauti abiem garsams [i] ir [j], panaði á <J>. Taèiau XVIII amþiuje LDK jau imta plaèiai pereidinëti prie lotyniðkosios antikvos raidþiø formos, tada jos lietuviø spaudoje galutinai ásigalëjo ir iðstûmë gotikines raides (skirtingai nuo Maþosios Lietuvos tekstø, kur dar ir XX amþiuje daþniausiai var- totas gotikinis raidynas). Pereidinëdami prie antikvinio ðrifto, pagal buvusià gotikinæ tradicijà spaustuvi- ninkai neretai dar neskyrë grafemø <I> ir <J>, tiek garsui [i], tiek [j] þymëti vartojo tà paèià grafemà: arba <I>, arba <J>.