1992, 18. Jahrgang (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Morina on Forner, 'German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal: Culture and Politics After 1945'
H-German Morina on Forner, 'German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal: Culture and Politics after 1945' Review published on Monday, April 18, 2016 Sean A. Forner. German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal: Culture and Politics after 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. xii +383 pp. $125.00 (cloth), ISBN 978-1-107-04957-4. Reviewed by Christina Morina (Friedrich-Schiller Universität Jena) Published on H-German (April, 2016) Commissioned by Nathan N. Orgill Envisioning Democracy: German Intellectuals and the Quest for Democratic Renewal in Postwar German As historians of twentieth-century Germany continue to explore the causes and consequences of National Socialism, Sean Forner’s book on a group of unlikely affiliates within the intellectual elite of postwar Germany offers a timely and original insight into the history of the prolonged “zero hour.” Tracing the connections and discussions amongst about two dozen opponents of Nazism, Forner explores the contours of a vibrant debate on the democratization, (self-) representation, and reeducation of Germans as envisioned by a handful of restless, self-perceived champions of the “other Germany.” He calls this loosely connected intellectual group a network of “engaged democrats,” a concept which aims to capture the broad “left” political spectrum they represented--from Catholic socialism to Leninist communism--as well as the relative openness and contingent nature of the intellectual exchange over the political “renewal” of Germany during a time when fixed “East” and “West” ideological fault lines were not quite yet in place. Forner enriches the already burgeoning historiography on postwar German democratization and the role of intellectuals with a profoundly integrative analysis of Eastern and Western perspectives. -

Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933) Kester, Bernadette
www.ssoar.info Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933) Kester, Bernadette Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Kester, B. (2002). Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933). (Film Culture in Transition). Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-317059 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de * pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. -

Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1
* pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. These films shed light on the way Ger- many chose to remember its recent past. A body of twenty-five films is analysed. For insight into the understanding and reception of these films at the time, hundreds of film reviews, censorship re- ports and some popular history books are discussed. This is the first rigorous study of these hitherto unacknowledged war films. The chapters are ordered themati- cally: war documentaries, films on the causes of the war, the front life, the war at sea and the home front. Bernadette Kester is a researcher at the Institute of Military History (RNLA) in the Netherlands and teaches at the International School for Humanities and Social Sciences at the University of Am- sterdam. She received her PhD in History FilmFilm FrontFront of Society at the Erasmus University of Rotterdam. She has regular publications on subjects concerning historical representation. WeimarWeimar Representations of the First World War ISBN 90-5356-597-3 -

Bekanntmachung Der Neufassung Des Staatsvertrages Über Den Rundfunk Im Vereinten Deutschland Und Des Staatsvertrages Über Mediendienste Vom 9
RStV Bekanntmachung der Neufassung des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland und des Staatsvertrages über Mediendienste Vom 9. Januar 2001 Aufgrund des Artikels 8 Abs. 4 des Fünften Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 6. Juli bis 7. August 2000 (SächsGVBl. S. 529, 532) wird nachstehend der Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages, des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und des Mediendienste-Staatsvertrages in der vom 1. Januar 2001 an geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung berücksichtigt: 1. den Ersten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Erster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 1. März 1994 (SächsGVBl. S. 1016), 2. den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 22. Juni 1995 (SächsGVBl. S. 384), 3. den Dritten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dritter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 11. September 1996 (SächsGVBl. S. 506), 4. den Staatsvertrag über Mediendienste (Mediendienste-Staatsvertrag) vom 12. Februar 1997 (SächsGVBl. S. 502), 5. den Vierten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Vierter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 16. Juli bis 31. August 1999 (SächsGVBl. 2000, S. 93), 6. die Artikel 1 bis 9 des eingangs genannten Staatsvertrages. Dresden, den -

Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism By
Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism by Nicholas Walter Baer A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Film and Media and the Designated Emphasis in Critical Theory in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Anton Kaes, Chair Professor Martin Jay Professor Linda Williams Fall 2015 Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism © 2015 by Nicholas Walter Baer Abstract Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism by Nicholas Walter Baer Doctor of Philosophy in Film and Media Designated Emphasis in Critical Theory University of California, Berkeley Professor Anton Kaes, Chair This dissertation intervenes in the extensive literature within Cinema and Media Studies on the relationship between film and history. Challenging apparatus theory of the 1970s, which had presumed a basic uniformity and historical continuity in cinematic style and spectatorship, the ‘historical turn’ of recent decades has prompted greater attention to transformations in technology and modes of sensory perception and experience. In my view, while film scholarship has subsequently emphasized the historicity of moving images, from their conditions of production to their contexts of reception, it has all too often left the very concept of history underexamined and insufficiently historicized. In my project, I propose a more reflexive model of historiography—one that acknowledges shifts in conceptions of time and history—as well as an approach to studying film in conjunction with historical-philosophical concerns. My project stages this intervention through a close examination of the ‘crisis of historicism,’ which was widely diagnosed by German-speaking intellectuals in the interwar period. -

Constantin August Axel Eggebrecht Geboren: 10. Januar 1899 Geburtsort: Leipzig Gestorben: 14
Constantin August Axel Eggebrecht Geboren: 10. Januar 1899 Geburtsort: Leipzig Gestorben: 14. Juli 1991 Todesort: Hamburg Kurzbiographie Axel Eggebrecht ist ein bedeutender Journalist und Schriftsteller der Nachkriegszeit. Zunächst als Leiter des Ressorts Innenpolitik in der Abteilung Wort beim Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) und später als freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) sowie als Leiter des NDR-Nachwuchsstudios prägte er den Rundfunk in der Bundesrepublik entscheidend mit. Gemeinsam mit Peter von Zahn war Axel Eggebrecht von 1946 bis 1947 Herausgeber der „Nordwestdeutschen Hefte“. In seiner umfassenden Berichterstattung vom Lüneburger Bergen-Belsen-Prozess (Herbst 1945) sowie vom Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) versuchte der 1933 selbst in einem Konzentrationslager inhaftierte Eggebrecht, die deutsche Bevölkerung zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu bewegen. Neben seiner journalistischen Tätigkeit veröffentlichte Axel Eggebrecht Gedichte und Essays und war Autor zahlreicher Hörspiele und Drehbücher. Eggebrecht erhielt für sein Schaffen verschiedene Auszeichnungen und Ehrungen, darunter auch die Bürgermeister-Stolten-Medaille der Stadt Hamburg. 1976 wurde er außerdem zum Ehrensenator der Universität Hamburg ernannt. Als Sohn des Mediziners Konstantin Ernst Eggebrecht und dessen Ehefrau Amalie Elisabeth Pauline Eggebrecht wuchs Axel Eggebrecht im bürgerlichen Milieu auf. Ab 1912 besuchte er das Städtische Gymnasium zu Leipzig. Im Ersten Weltkrieg wurde Eggebrecht schwer verwundet. Nach seiner Entlassung aus dem Heeresdienst begann er Anfang 1919 ein Studium der Germanistik, Philosophie und Psychologie an der Universität Leipzig, das er nach einer Unterbrechung in Kiel fortsetzte. Im Sommer 1920 brach Axel Eggebrecht das Studium jedoch ab und zog nach Berlin, wo er zunächst als Bücherpacker und Bote beim kommunistisch ausgerichteten Malik-Verlag arbeitete. Dort kam er in Kontakt mit Intellektuellen wie Oskar Maria Graf, Erwin Piscator und Raoul Hausmann. -

Revolutionary Literature Hunter Bivens
Revisiting German Proletarian- Revolutionary Literature Hunter Bivens The proletarian-revolutionary literature of Germany’s Weimar Republic has had an ambivalent literary historical reception.1 Rüdiger Safranski and Walter Fähnders entry for “proletarian- revolutionary literature” in the influentialHanser’s Social History of German Literature series (1995, p. 174) recognizes the signi- ficance of the movement’s theoretical debates and its opening up of the proletarian milieu to the literary public sphere, but flatly dismisses the literature itself as one that “did not justify such out- lays of reflection and organization.” In the new left movements of the old Federal Republic, the proletarian-revolutionary culture of the Weimar Republic played a complex role as a heritage to be taken up and critiqued. However, the most influential, if not most substantial, West German account of this literature, Michael Rohrwasser’s (1975, p. 10) Saubere Mädel-Starke Genossen [Clean Girls-Strong Comrades], sharply criticizes the corpus and describes the proletarian mass novel as hopelessly masculinist and productivist, a narrative spectacle of the “disavowal of one’s own alienation.” In the former GDR, on the other hand, after having been largely passed over in the 1950s, proletarian-revolutionary literature, rediscovered in the 1960s, was often described as the heroic preparatory works of a socialist national literature that would develop only later in the worker-and-peasants’ state itself, still bearing the infantile disorders of ultra-leftism and proletkult (Klein, 1972).2 This paper offers a revisionist reading of the pro- letarian-revolutionary literature of Germany’s Weimar Republic. How to cite this book chapter: Bivens, H. -
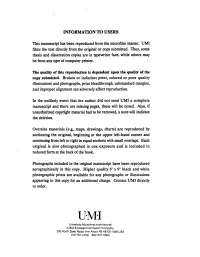
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Z eeb Road. Ann Arbor. Ml 48 1 0 6 -1 3 4 6 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 0201757 German writers and the Intermediate-range Nuclear Forces debate in the 1980s Stokes, Anne Marie, Ph.D. -

Gemeinde Burgrieden Landkreis Biberach Satzung Über Eine
Gemeinde Burgrieden Landkreis Biberach Satzung über eine Gemeinschaftsantennenanlage für den Fernseh- und Hörfunkempfang vom 18.01.1993 geändert durch Satzung vom 10.12.2001 (Gemeindeblatt Nr. 44/01) Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBL S. 578) und den § 2, 9 und 10 des Kommunalabgabengesetzes von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Januar 1993 folgende Satzung beschlossen: § 1 Gemeinschaftsantennenanlage (1) Die Gemeinde betreibt für − das Fernsehangebot der Programme ARD (SWF/SDR regional), ARD (Bayern regional), ZDF, Südwest 3, Bayern 3, West 3, Nord 3, SAT 1, RTL, ARD 1 Plus, 3 sat, PRO 7, DSF, Kabelkanal, Arte, ORF 1, ORF 2, DRS, TSR (franz.), TSI (ital.), Eurosport, Sport-kanal, SUPER CHANNEL, MTV, Lifestyle, TV 5 Europa, Premiere (verschlüsselt) und − das Hörfunkangebot der ortsüblichen UKW-Programme sowie weiterer 16 digitaler Rundfunkprogramme, eine Gemeinschaftsantennenanlage als öffentliche Einrichtung. Die Antennenanlage ist auf den Bereich der Baugebiete “Am Nonnenberg“ beschränkt. (2) Die Leistung der Gemeinde erstreckt sich auf die Gesamtantennenanlage bis zum Hausübergabepunkt und auf die Behebung von Störungen an der Anlage. (3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Betrieb der Anlage überhaupt oder in einer bestimmten Weise besteht nicht. (4) Für die Antennenanlage werden keine Gewinne erzielt. § 2 Anschluss und Benutzung (1) Die Eigentümer und Erbbauberechtigten eines bebauten Grundstücks im Geltungsbereich dieser Satzung sind berechtigt, -

Hungary Replies to Questionnaire on 3Rd PR
Strasbourg, 19 April 2006 MIN-LANG/PR (2005) 6 Addendum 3 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter HUNGARY Replies to the Comments/questions submitted to the Government of Hungary regarding its Third Periodical Report Responses to be given to the package of questions of the Expert Committee of the European Charter of Regional and Minority Languages 1. For the number of local minority self-governments: See Appendix 1 (Contents of the table: name of settlement, county, number of population based on Home Ministry figures, number of national minority people of the previous figure, number of those deeply attached to traditions of the previous figure, number of those declaring to have a minority language as native tongue of the previous figure, number of those using a minority language of the previous figure, ratio of minority people to whole population, ratio of those observing traditions to whole population, ratio of native speakers of a minority language to whole population, ratio of language speakers to whole population.) 2. Researchers have sent indications about the phenomenon, but as the process is slow, and today is in a rudimentary stage, there are limits to observation, no overview survey has been made in this regard yet. The Central Statistical Office has provided data regarding settlements studied by the Office for National and Ethnic Minorities (NEKH), where the minority self-governments were transformed, and where the minorities constitute a significant portion of the population. The two tables are attached (the extra contents of Appendices 2 and 3 œ apart from those listed in Appendix 1 œ are the number of those who had moved in from the country of the language based on the figures of the Central Statistical Office) 3. -
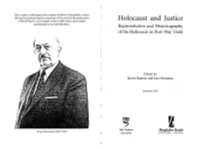
Holocaust and Justice Contributing to Its Materialization
This volume is dedicated to the memory of Sirnon Wiesenthal, a major driving force preserving the awareness of the need for the prosecution ofWorld War II war criminals in the world's mind, and actually Holocaust and Justice contributing to its materialization. Representation and Historiography of the Holocaust in Post-War.,., Trials Edited by David Bankier and Dan Michman '' Jerusalem 2010 \ ~ Yad Vashem Sirnon Wiesenthai (1908-2005) Berghahn Books Jerusalem NEW YORK • OXFORD '·' Copyright© 20 l 0 by Yad Vashem, Jerusalem Published in association with Berghahn Books The responsibility for the views expressed in this publication rests solely with the authors. Contents All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced in any form or any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher Yad Vashem The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority. Introduction . 7 This publication and the conference on which it is based The Nurernberg Trialsand Their Long-Range Impact were made possible through the generous support of the Gertner Center for International Holocaust Conferences The Didactic Trial: Fittering History and Memory into the endowed by the late Danek D. and Jadzia B. Gertner Courtroom . 11 and The Gutwirth Family Fund Lawrence Douglas Prosecuting the Past in the Postwar Decade: Political Strategy and National Myth-Making . 23 Language Editor: Heather Rockman Donald Bloxham Typesetting: Judith Sternberg Printing: Printiv, Jerusalem The Holocaust, Nurernberg and the Birth of Modem International Law . 45 Michael J. Bazyler The Role ofthe Genocide ofEuropean Jewry in the Preparations for the Nurernberg Trials . -

Nahostvideos 2
Nahostarchiv Heidelberg (NOAH) DVD-Archiv Enthält Sendungen, Beiträge und Filme von etwa 1990 bis 2017. Der Text ist nicht endlektoriert, d.h. er enthält minimale Schreibfehler. 1. Nahostkonflikt (NOK) / Israelisch-Palästinensischer Konflikt 1.1 NOK allgemein 1.2 NOK / Geschichte 1.3 NOK / Kriege 1.4 NOK / Israelische Politiker 1.5 NOK / Israelische Friedensbewegung / Dialog 1.6 NOK / Daniel Barenboim 1.7 NOK / Verschiedenes 1.8 NOK / Medien 1.9 NOK / Rolle Israels 1.10 NOK / Olympia-Attentat 1972 1.11 NOK / Friedensinitiativen / Friedenslösungen 1.12 NOK / Militär / Aufrüstung 1.13 NOK / Intifada 1.14 NOK / Religionsaspekte (Vatikan) 1.15 NOK / Geheimdienste 1.16 NOK / Jerusalem 1.17 NOK / Aktuelle Entwicklung 1.18 NOK / Politik der USA 1.19 NOK / Palästina-Solidarität (auch BDS-Kampagne) 1.20 NOK / Israelische Siedlungen / Siedler 1.21 NOK / Archäologie 1.22 NOK / Westjordanland / Besetzte Gebiete allgemein 1.23 NOK / Gaza-Streifen 2. Israel 2.1 Kultur in Israel 2.2 Musik in Israel 3. Palästina / Palästinenser / Geschichte Palästinas (bis zum Konfliktbeginn) 3.1 Palästinensische Kultur (Literatur, Musik) 4. Einzelne arabische Länder (auch Afghanistan und Iran) 4.1 Afghanistan 4.2 Ägypten 4.3 Das alte Ägypten 4.4 Algerien (auch: Sahara) 4.5 Irak 4.6 Iran 4.7 Jemen 4.8 Jordanien 4.9 Libanon 4.10 Libyen 4.11 Marokko (auch Westsaharakonflikt) 4.12 Oman 4.13 Saudi-Arabien 4.14 Syrien (Palmyra) 4.15 Tunesien 4.16 VAE 4.17 Bahrain / Kuwait / Katar 5. Islam Allgemein / Verschiedenes 5.1 Islam in Deutschland (auch Islamdebatten in Dtl.) 1 6. Islamismus (auch Al-Qaida, Guantanamo, Antiterrorkampf) 7.