13. Wissenschaftsbericht Der Stadt Wien 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lesen Sie Weiter Auf Der Seite 44 ¾
Ausg. Nr. 128 • 27. Feber 2014 Unparteiisches, unabhängiges Monats- magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at Lesen Sie weiter auf der Seite 44 ¾ Sie sehen hier die Variante A4 mit 72 dpi und geringer Qualität von Bildern und Grafiken ÖSTERREICH JOURNAL NR. 128 / 27. 02. 2014 2 Die Seite 2 Liebe Leserinnen und Leser, die Verlagerung unseres Magazininhalts auf die Rubrik »Östereich, Europa und die Welt«, dem wir diesmal wieder mehr als 50 Seiten gewidmet haben, stößt erfreulicherweise auf Ihre Zustimmung. Informationen über das aktuelle innenpolitische Geschehen holen Sie sich, wie wir vielfach bestätigt bekamen, ohnehin von tagesaktuellen Internetseiten (auch unsere sind dabei, danke dafür). Wir möchten mit dieser Schwerpunktsetzung gerne möglichst viel Interessantes transportieren, worauf wir gemeinsam stolz sein können. Wenn Sie Serie »1914 – 2014« S 30 dazu beitragen möchten, es steht ausreichend Raum für Berichte über Ihre vielfältigen Tätigkeiten zur Verfügung… Michael Mössmer Der Inhalt der Ausgabe 128 Teil 3 der Serie: Europawahl 2014: Ein Künstlerdorf erobert Brüssel 70 Diesmal geht's um mehr! 3 Land fördert Kurzzeitpflege 73 Wählerevidenz bzw. Europa- Neue Gründerinnenoffensive im Wählerevidenz 8 Südburgenland gestartet 73 12. Februar 1934 S 63 Wahl-Informationen für Innovationspreis an Geodatenstelle AuslandsösterreicherInnen 9 des Landes 75 Stimmungslage vor der EU-Wahl 10 »Kultour für alle Sinne« 77 Verantwortung in der Welt 13 ---------- Teufelskreis des Menschenhandels 100 Jahre Silvius Magnago 78 durchbrechen 14 EU: Herausforderung Korruption 79 Prammer trifft afghanischen Amtskollegen Ibrahimi 15 Verhaltenes Wirtschaftswachstum… 81 25. Mai als Termin für die Konjunkturerholung mit geringem Europawahl fixiert 16 Tempo. -
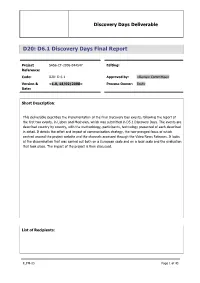
D20: D6.1 Discovery Days Final Report
Discovery Days Deliverable D20: D6.1 Discovery Days Final Report Project SAS6-CT-2006-044547 Editing: Reference: Code: D20: D 6.1 Approved by: <Review Committee> Version & <1.0, 14/02/2008> Process Owner: Ecsite Date: Short Description: This deliverable describes the implementation of the final Discovery Day events, following the report of the first two events, in Lisbon and Mechelen, which was submitted in D5.1 Discovery Days. The events are described country by country, with the methodology, participants, technology presented of each described in detail. It details the effort and impact of communication strategy, the two-pronged focus of which centred around the project website and the channels accessed through the Video News Releases. It looks at the dissemination that was carried out both on a European scale and on a local scale and the evaluation that took place. The impact of the project is then discussed. List of Recipients: F_PM-03 Page 1 of 43 D20: D6.1 Discovery Days Final Report Contents 1. Executive Summary ............................................................................................4 2. Implementation of Austrian events ....................................................................5 2.1 Achievements and Results of Project towards Objectives...............................................5 2.2 Graz event “Discover IT”, 24-27 May 2007 ...................................................................6 2.2.1 Main activities and tools produced of Graz event ...................................................7 -

First Announcement
Ecsite Annual Conference Graz, Austria, 9 –11 June 2016 First Announcement The European conference for science engagement The European conference for science engagement 27th edition shaping science engagement since 1989 More than days 1,000 attendees 3 2 days of conference from 50 countries of pre-conference workshops 60 main exhibitors 3 Countless social events networking opportunities 80 sessions #Ecsite2016 Open to everyone involved in public engagement with science WHY YOU NEED TO BE IN GRAZ NEXT JUNE Ecsite Annual Conference Graz, Austria, 9 –11 June 2016 1 Michiel Buchel Catherine Franche Ecsite President Ecsite Executive Director CEO of NEMO, Amsterdam, Netherlands Brussels, Belgium We are proud to invite you to the 27th Ecsite Annual Conference, co-organised by Ecsite and a trio of local hosts in Graz, Austria, on 9-11 June. The largest of its kind in Europe, the Ecsite conference is open to everyone interested in public engagement with science. Ecsite members and conference regulars will be particularly pleased to welcome first timers from countries where science engagement is booming, in particular Eastern Europe – note Graz’s central position on the European map. We also want to share our debates and exchanges with new communities, as our special partnership with the Hands On! International Association of Children in Museums shows. Join this very special event and its unique balance of large crowds and friendly family atmosphere, broad thematic scope and focussed state of the art sessions, international perspectives and European touch, spotless organisation and room for surprises, peer colla- boration and friendly criticism. Get a solid basis if you’re entering the field and be challenged to advanced strategic thinking if it’s future perspectives you’re after. -

General Assembly UNEDITED VERSION
United Nations A/HRC/31/12 General Assembly Distr.: General 20 November 2015 Original: English UNEDITED VERSION Human Rights Council Thirty first session Agenda item 6 Universal Periodic Review Report of the Working Group on the Universal Periodic Review* Austria * The annex to the present report is circulated as received GE. A/HRC/31/12 Contents Paragraphs Page Introduction.............................................................................................................. 1–4 3 I Summary of the proceedings of the review process................................................. 5–137 3 A. Presentation by the State under review............................................................ 5–20 3 B. Interactive dialogue and responses by the State under review ........................ 21–137 5 II. Conclusions and/or recommendations ..................................................................... 139–142 14 Annex Composition of the delegation .......................................................................................................... 28 2 A/HRC/31/12 Introduction 1. The Working Group on the Universal Periodic Review (UPR), established in accordance with Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, held its twenty- third session from 2 to 13 November 2015. The review of Austria was held at the 11th meeting on 9 November 2015. The delegation of Austria was headed by the Federal Minister of Justice, Mr. Wolfgang Brandstetter. At its 17th meeting held on 12 November 2015, the Working Group adopted the report -

Prof. Alexander Van Der Bellen Ist Unser Neuer Bundespräsident Prof
Ausg. Nr. 160 • 22. Dezember 2016 Unparteiisches, unabhängiges Monats - magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at Prof.Prof. AlexanderAlexander VanVan derder BellenBellen istist unserunser neuerneuer BundespräsidentBundespräsident Lesen Sie weiter auf der Seite 37 Foto: Wolfgang Zajc Sie sehen hier die Variante US-Letter mit 72 dpi und geringer Qualität von Bildern und Grafiken ÖSTERREICH JOURNAL NR. 160 / 22. 12. 2016 2 Die Seite 2 Liebe Leserinnen und Leser, diesmal können wir Ihnen – mit Sicherheit – unseren neuen Bundespräsidenten präsentieren, denn die Einspruchsfrist gegen das Ergebnis der Stichwahl vom 4. Dezember ist abgelaufen. Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen wird also am 26. Jänner im Historischen Sitzungssaal im Parlament als zwölftes Staatsoberhaupt seit 1918 angelobt werden. Wir berichten dann ausführlich über den Festakt und das Amtsverständnis unseres neuen Bundespräsidenten in der Ausgabe 161, die am Abend des 31. Jänner 2017 erscheinen wird. Außenminister übernimmt OSZE-Vorsitz S 3 Inzwischen wünsche wir Ihnen und den Ihren frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das Neue Jahr! Liebe Grüße aus Wien Michael Mössmer Der Inhalt der Ausgabe 160 Kurz übernimmt OSZE-Vorsitz Das Burgenland knackt für Österreich 3 die 3 Millionen Nächtigungsmarke 56 Auslandseinsätze von Bundesheer Eisenstädter Stadtbus fährt los 57 und Exekutive 6 Liebeserklärung an den Pakt für ein soziales Europa 10 Wir haben einen Bundespräsidenten -

Europaforum Wachau 2016 Europaforum Wachau 2016
Ausg. Nr. 155 • 30. Juni 2016 Unparteiisches, unabhängiges Monats- magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at EuropaforumEuropaforum WachauWachau 20162016 Europa – in Wohlstand geeint, in Krisen gespalten? Seite 9 Foto: Erich Marschik Sie sehen hier die Variante US-Letter mit 300 dpi und hoher Qualität von Bildern und Grafiken ÖSTERREICH JOURNAL NR. 155 / 30. 06. 2016 2 Die Seite 2 Liebe Leserinnen und Leser, nach dem äußerst knappen Ergebnis des zweiten Wahlgangs zur Bundespräsidentenwahl zwischen Prof. Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer vom 22. Mai hat die FPÖ die Wahl beim Verfassungs- gerichtshof (VfGH) angefochten. Der Vorwurf: Unregelmäßigkeiten und Fehlverhalten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. VfGH- Präsident Gerhart Holzinger kündigte heute, am 30. Juni, an, am 1. Juli um 12 Uhr MEZ (Sommerzeit) das Urteil über die Anfechtung zu veröffentlichen. Wir werden in unserer Ausgabe 156 (erscheint Zu Ehren des Bundespräsidenten S 54 am 28. Juli) natürlich ausführlich darüber berichten! Liebe Grüße aus Wien Michael Mössmer Der Inhalt der Ausgabe 155 Bundespräsident Fischer auf Große Anerkennung für Abschiedsreise 3 Landeshauptmann Hans Niessl 65 Brexit und die Folgen 6 Senioren-Delegation aus Bayreuth UN-Programm startet in Wien 8 im Landhaus in Eisenstadt 66 Hirscher vor Papst und Fischer S 81 21. Europaforum Wachau 9 Auszeichnung für Verdienste um »Wir sind nicht besser als Australien« das Land Burgenland vergeben 67 S. Kurz – OÖNachrichten-Interview 14 Kino für Eisenstadt 68 Maßnahmenpaket zur Integration Kurzmeldungen aus Burgenland 69 von Flüchtlingen 15 Nationalparkzug Neusiedler See 72 Netto-Zuwanderung steigt 2015 16 Güssing: Der nackte Wahnsinn 73 Flüchtlinge am Arbeitsmarkt 17 ------------------- NÖ ist »Europäische Unternehmer- Aus Südtirol 74 region 2017« 18 EU: Gemeinsame Erklärung 75 Intern. -
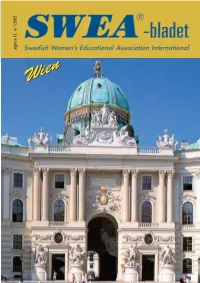
SWEA-Bladet-2005-01
utgåva 11, nr 1/2005 WWienien SWEA ® SWEA -bladet Swedish Women’s Educational Association International Redaktörens utgåva 11, nr 1/2005 Wien rader IMPRESSUM Kära Wien-Sweor, ett nytt SWEA-år har börjat, och jag hoppas att det blir för Ansvarig utgivare: alla ett år fyllt av glädje och goda kontakter. Vi har ny ord- Ingela Kindås-Mügge förande, styrelse och de nya medlemmar vi kan välkomm- Oberwiedenstrasse 19 1170 Wien na, kommer förhoppningsvis också att få del av SWEAs Tel.: +43 1 48 62 425 unika kontaktnät. Vid värlsdmötet i början av april i New Fax: +43 1 48 48 206 Orleans kunde visserligen ingen från Wien deltaga, men E-post:[email protected] tack vare modern kommunikation blev vi snabbt delaktiga av informationen. Aktuellt hann emellertid endast medde- Redaktör och annonsansvarig: landet om årets svenska kvinna och SWEAs nya stipendia- Elise Haidenthaller, ter komma in i tidningen, så resten får ni läsa om på hem- Tel: +43 1 8767 956-21; Fax: +43 1 8767 956-20 sidan. Vår regionordförande Maud Larsson refererar om ISDN: +43 1 879 56 31 sista regionmötet. Visst skulle det vara roligt om vi kunde E-post: [email protected] bilda en stor grupp från Wien som kan åka till nästa Lektorat: regionmöte i oktober i Aten. För att stärka samhörigheten Karin von Stetten inom regionen organiserade vi besöket för Warszawa- Åsa Larsson Sweorna. Det blev ett par korta intensiva dagara med nya trevliga Sweor. Vad ett möte betyder om man har det rätta Sweabladet Wien utkommer två gånger om året örat och det blir ett samtal som går till hjärtat vet Kristina Nästa manusstopp: 1. -

Die Bundesregierung
POLITIKNAVI – WEGWEISER DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE POLITIK DIE BUNDESREGIERUNG die hinter ihr steht. Deshalb ist die Umsetzung des Regierungspro- BUNDESKANZLER SEIT 1918 gramms im Parlament zentraler Dr. Karl Renner (SDAPÖ, 1918–1920) Bestandteil von Regierungsver- Dr. Michael Mayr (CS, 1920–1921) handlungen. Grundsätzlich wäre Dr. Johann Schober (Beamter, 1921–1922) es möglich, im Zuge einer Regie- Dr. Walter Breisky (CS, 1922) rungsbildung zwischen den Regie- Dr. Johann Schober (Beamter, 1922) rungsparteien bestimmte Berei- Dr. Ignaz Seipel (CS, 1922–1924) che der freien Mehrheitsbildung zu Dr. Rudolf Ramek (CS, 1924–1926) vereinbaren. Allerdings ist davon Dr. Ignaz Seipel (CS, 1926–1929) auszugehen, dass das Vertrauen in Dr. Ernst Streeruwitz (CS, 1929) einen Koalitionspartner sehr da- Dr. Johann Schober (CS, 1929–1930) Die Bundesregierung: (hinten, v. l. n. r.) Andrä Rupprechter (ÖVP), Sebastian Kurz (ÖVP), Gerald runter leidet, wenn dieser auch Carl Vaugoin (CS, 1930) Klug (SPÖ), Alois Stöger (SPÖ), Josef Ostermayer (SPÖ), Wolfgang Brandstetter (ÖVP), Jochen mit der Opposition gemeinsame Dr. Otto Ender (CS, 1930) Danninger (ÖVP); (vorne, v. l. n. r.) Rudolf Hundstorfer (SPÖ), Sophie Karmasin (ÖVP), Gabriele Sache machen „darf“. Auch wenn Dr. Karl Buresch (CS, 1930–1931) Heinisch-Hosek (SPÖ), Michael Spindelegger (ÖVP), Werner Faymann (SPÖ), Doris Bures (SPÖ), Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Sonja Steßl (SPÖ), Reinhold Mitterlehner (ÖVP) es sich schwierig verhält, undenk- Dr. Engelbert Dollfuß (CS/VF, 1932–1934) bar ist eine derartige Vorgehens- Dr. Kurt Schuschnigg (VF, 1934–1938) weise allerdings nicht. Dr. Arthur Seyß-Inquart (NSDAP, 1938) Dr. Karl Renner (SPÖ, 1945–1949) Die Bundesregierung trifft sich Dipl.-Ing. Leopold Figl (ÖVP, 1949–1953) DIE BUNDESREGIERUNG üblicherweise jeden Dienstagvor- Ing. -

66Th Lindau Nobel Laureate Meeting Annual Report 2016
66th Lindau Nobel Laureate Meeting Annual Report 2016 1 66th Lindau Nobel Laureate Meeting Annual Report 2016 Contents » 66th Lindau Nobel Laureate Meeting » Outreach Projects & Mission Education » The Council & the Foundation Overcoming Barriers with Science 4 SCIENTIFIC ProGrammE The Mediatheque 70 TH NCE COU IL 98 Greeting by Countess Bettina Bernadotte and Jürgen Kluge Quantum Technology – A Revolution in the Making 16 Educational Outreach 72 A Platform for Communication and Understanding Interview with Scientific Co-Chairman Rainer Blatt THE FOUNDATION 99 Speech by German Federal Minister of Education and 8 Teaching Spirit and School Visit 74 Research Johanna Wanka What a Time to be Alive in Physics! 18 Founders Assembly 100 Interview with Scientific Co-Chairman Lars Bergström Nature Video Lindau Collection 2016 75 Prospects and Reflections 10 Honorary Senate 102 Statements from the Opening Ceremony Gravitational Waves – a Whole new Window on the Universe! 20 Alumni of the Lindau Meetings 78 Q&A with George Smoot from Nature Outlook In Loving Memory 103 Opening Ceremony 12 A Fellowship for European Innovation 80 The Future of Education in Sciences 38 Guardians of the Future 104 Report on the closing day panel discussion Nobel Heroes 82 Farewell speech by Wolfgang Schürer PARTICIPANTS, PARTNERS, SupporTERS Wim Wenders on the new portrait book by Peter Badge Poster Session 40 Participants 22 Sketches of Science 84 ORGANIsaTION Recollections of the Manhattan Project 42 Young Scientists 23 Roy Glauber’s historic perspective AAAS Annual -

Margit Fischer Im Interview Über Ihre Gesundheitsstrategien, Ihr Mag
gesundesMAGAZIN FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND PRÄVENTION österreich IM GESPRÄCH „ Jeder hat ein Recht auf Gesundheit. MARGIT FISCHER, “ VORSITZENDE DES ÖSTERREICHISCHEN FRAUENRATES Thema FGÖ-Initiative Praxis Gemeinsam für Gute Kontakte zwischen Wie eine Region gesundheitliche Nachbarn fördern das Gesundheit P.b.b. 03Z034913 M – Verlagspostamt 1020 M 03Z034913 – Verlagspostamt P.b.b. Chancengerechtigkeit Wohlbefinden lernt 14. JAHRGANG NR. 4 | DEZEMBER 2012 IMPRESSUM Offenlegung gemäß § 25 MedG 04/12 Medieninhaber: Gesundheit Österreich INHALT GmbH, Stubenring 6, 1010 Wien, FN 281909y, Handelsgericht Wien COVERSTORY Herausgeber/in: 10 Margit Fischer im Interview über ihre Gesundheitsstrategien, ihr Mag. Georg Ziniel, MSc, Geschäftsführer GÖG, soziales Engagement und weshalb mehr Verteilungsgerechtigkeit und Mag.a Christa Peinhaupt, MBA, auch bessere Bildungs- und Gesundheitschancen für die sozial Geschäftsbereichsleiterin Fonds Gesundes Schwächsten bedeuten würde. Österreich Redaktionsadresse und Abonnement-Verwaltung: Fonds Gesundes Österreich, Aspernbrückengasse 2, 1020 Wien, Tel.: 01/895 04 00-0, [email protected] Redaktionsbüro: Mag. Dietmar Schobel, Hietzinger Hauptstr. 136/3, 1130 Wien, www.teamword.at, [email protected], Tel.: 01/971 26 55 Redaktion: Mag.a Gudrun Braunegger-Kallinger, Dr. Rainer Christ, Sabine Fisch, Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher, Ing.in Petra Gajar, Mag.a Rita Kichler, Foto: Klaus Pichler/FGÖ Helga Klee, Dr. in Anita Kreilhuber, Mag. Harald Leitner, 1 Frage an 3 Expert/in- Manuela Brandstetter a MENSCHEN & Mag. Hermine Mandl, MEINUNGEN nen: „Gesundheit – im Interview: Arm und Mag. Markus Mikl, Eigenverantwortung krank am Land Mag.a Gerlinde Rohrauer-Näf, MPH, oder Aufgabe der 22 Mag. Dr. Klaus Ropin, Drei Porträts: Viktor Gesellschaft?“ Mag. Dietmar Schobel (Leitung), Omelko, Barbara Haider- Mag.a Gabriele Vasak, Novak, Franz Wutte 14 Wie Gesundheits- Dr. -

Pdf Wienbladet 2 2016 Lyssna
Prästens ord "Men så har vi alltid gjort!" En replik som man får höra lite nu och då när man jobbar i kyrkans värld. Alternativt med variationen "Men så har vi aldrig gjort!" Oftast sagt med emfas och den underförstådda uppmaningen att absolut inte ändra på något, för så har det aldrig gjorts förut och vi har ju alltid gjort så här! Traditioner är viktiga och skall bevaras. Samtidigt får vi aldrig fastna i det gamla och förgångna. En god organisation vaggar som en anka genom livet. Med ena foten i traditionerna. I det som varit. Den andra foten söker nya vägar. Prövar nya sätt att leva och verka. Ligger tyngden på endast det ena, förloras tillslut helheten och innehållet. Varje söndag kl 11:00 firar vi högmässa på Gentzgasse 10. Delar av högmässans ordning kan spåra sina rötter tillbaka till urkyrkans tid. En tradition som bestått i snart 2000 år. Vid samma gudstjänst sjunger vi kanske en sång skriven i år. Så blandas det gamla och det nya, tradition och förnyelse, och bildar en ny, levande enhet. Svenska kyrkan i Wien är en underbar blandning av tradition och förnyelse. Av stolt historia och kreativt nyskapande. En levande församling där vi vilar i det gamla och nyfiket hittar nya vägar. Ibland är processen smärtsam. Inte allt är värt att bevaras bara för att det varit så. Inte allt som är nytt är alltid bra. Men med respekt och lyhördhet för varandra får vi tillsammans söka vägen framåt. En kyrka är så mycket mer än bara byggnaden vi samlas i. Faktum är att kyrko- byggnaden är mer en praktisk lösning för skydd mot väder och vind. -

The Messenger
Progress on the VLT deformable secondary mirror The Messenger Commissioning of KMOS Ultra-faint dwarf galaxies The VIPERS redshift survey No. 151 – March 2013 March – 151 No. Telescopes and Instrumentation Upgrading VIMOS — Part II Peter Hammersley1 Figure 1. VIMOS on the Nasmyth Ronald Brast1 platform of VLT UT3. Paul Bristow1 Pierre Bourget1 Roberto Castillo1 Hans Dekker1 Michael Hilker1 Jean-Louis Lizon1 Christian Lucuix1 Vincenzo Mainieri1 Steffen Mieske1 Dan Popovic1 Claudio Reinero1 Marina Rejkuba1 Chester Rojas1 Ruben Sanchez-Jannsen1 Fernando Selman1 Alain Smette1 Josefina Urrutia Del Rio1 Javier Valenzuela1 Burkhard Wolff1 1 ESO VIMOS is the powerful visible (360– – integral field unit (IFU) spectroscopy and operational procedures; and opera- 1000 nm) imager and multi-object/inte- with three fields of view: 13 by 13, tional efficiency. gral field spectrometer mounted on 27 by 27, and 54 by 54 arcseconds the VLT Unit Telescope 3, Melipal. Its depending on the specific mode This article discusses the results of this high multiplex advantage makes it ideal requested. second phase. More technical details for undertaking large-scale spectro- on the overall upgrade programme can scopic surveys of faint sources. In order VIMOS and its commissioning on the VLT be found in Hammersley et al. (2012). to extend the life of the instrument, im - in 2002 were described in Le Fevre et al. prove its performance and prepare for (2002) and in operation by D’Odorico et possible large-scale surveys, in 2009 it al. (2003). After eight years of operation it Improving image quality was decided to upgrade VIMOS. The became necessary to upgrade the instru- first phase of the upgrade, which in - ment in order to address various issues Following the change of the detector, it cluded replacing the detectors and the and to extend its useful life.