Hans Coppi/Winfried Meyer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

German History Reflected
The Detlev Rohwedder Building German history reflected GFE = 1/2 Formathöhe The Detlev Rohwedder Building German history reflected Contents 3 Introduction 44 Reunification and Change 46 The euphoria of unity 4 The Reich Aviation Ministry 48 A tainted place 50 The Treuhandanstalt 6 Inception 53 The architecture of reunification 10 The nerve centre of power 56 In conversation with 14 Courage to resist: the Rote Kapelle Hans-Michael Meyer-Sebastian 18 Architecture under the Nazis 58 The Federal Ministry of Finance 22 The House of Ministries 60 A living place today 24 The changing face of a colossus 64 Experiencing and creating history 28 The government clashes with the people 66 How do you feel about working in this building? 32 Socialist aspirations meet social reality 69 A stroll along Wilhelmstrasse 34 Isolation and separation 36 Escape from the state 38 New paths and a dead-end 72 Chronicle of the Detlev Rohwedder Building 40 Architecture after the war – 77 Further reading a building is transformed 79 Imprint 42 In conversation with Jürgen Dröse 2 Contents Introduction The Detlev Rohwedder Building, home to Germany’s the House of Ministries, foreshadowing the country- Federal Ministry of Finance since 1999, bears wide uprising on 17 June. Eight years later, the Berlin witness to the upheavals of recent German history Wall began to cast its shadow just a few steps away. like almost no other structure. After reunification, the Treuhandanstalt, the body Constructed as the Reich Aviation Ministry, the charged with the GDR’s financial liquidation, moved vast site was the nerve centre of power under into the building. -

Kommunikation Und Zivilcourage – Orte Der ‚Roten Kapelle' In
Kommunikation + Zivilcourage Orte der Roten Kapelle in Brandenburg Eine Projektdokumentation herausgegeben vom Liebenberger Freundeskreis e. V. und Zeitpfeil e. V. Die Beschäftigung mit dem Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime ist ein immer währender Prozess der Annäherung an die Geschichte und an die Handlungsmög Die »Rote Kapelle« gehörte zu den größten Widerstandsgruppierungen in den ersten Kriegs lich keiten von Menschen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik schärft den Blick für jahren. Durch persönliche Kontakte bildete sich 1940/41 ein loses Netzwerk von sieben Ber eigene Entscheidungen, aber auch für Rechtsextremismus und seine Ursachen, den Trä liner Freundes und Widerstandskreisen heraus, in deren Mittelpunkt Harro SchulzeBoy gern und den Erscheinungsformen von Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus. His sen und Arvid Harnack standen. Diesem Netzwerk gehörten mehr als 150 Regimegegner, to rische Zusammenhänge vermitteln Wissen und emotionale Zugänge zu gelebter Zivil Frauen und Männer unterschiedlicher sozialer Herkunft und weltanschaulicher Auf assun courage, die heute und morgen benötigt wird. gen an. Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, Intellektuelle, Künstler, Ärzte, Soldaten und Verschiedene Orte in Brandenburg waren Orte der Kommunikation und des informellen Offiziere, Marxisten und Christen diskutierten politische und künstlerische Fragen, halfen Austausches von Mitgliedern des Widerstandes in Berlin. Durch ihre Abgeschiedenheit, politisch und jüdisch Verfolgten sowie Zwangsarbeitern, dokumentierten NSGewalt Landschaften und Kulturorte boten sie kommunikative Freiräume für Verständigung und verbrechen und riefen in Flugschriften und Zettelklebeaktionen zum Widerstand auf. Es verbotene kulturelle Praxis. Die Idee des Projektes »Kommunikation + Zivilcourage. Orte be standen Kontakte zu Widerstandsgruppen in Berlin und Hamburg, zu französischen der ›Roten Kapelle‹ in Brandenburg« war es, die Beschäftigung mit historischem Wider Zwangs arbeitern und Vertretern der amerikanischen und sowjetischen Botschaft. -

May 2020 24 Soviet Intelligence on the Eve of the Great Patriotic
Volume 3, Issue 1: May 2020 Soviet Intelligence on the Eve of the Great Patriotic War Gaël-Georges Moullec (Rennes School of Business and Sorbonne Paris Nord University) Studying Soviet intelligence has long been a problem. On the one hand, academics, should it be by ideology or conformity, have historically avoided the question, refusing to see the originality of these services and their central place in the power system set up by the Bolsheviks. On the other hand, journalists and former Western services personnel repeatedly stressed the omnipotence of the “Organs” and their essential role in the alleged communist “world plot.” This was done without explaining why this supposed power system proved so ineffectual during the German lightning attack of June 1941 or, again, at the time of the collapse of the USSR in 1991.1 Today, the debate has been revived. Russian archives were opened at the end of the twentieth century, some partially or temporary, and many previously secret documents were published—often at the instigation of the new Russian intelligence services. One of the things that has clearly emerged from the archives is that probably the most significant event that impacted the Soviet intelligence services was the physical consequences of the 1937–1939 purges within the Soviet intelligence services, which resulted in the disappearance of the most experienced personnel. After the purges, the Soviet services had lost a sturdy portion of its workforce but retained access to a significant flow of information. The inability of the services to provide the country’s leadership with a clear analysis of the political and military situation in Germany and the imminence of the June 22, 1941, attack was therefore linked to new work practices resulting from this “purification.” In what follows, we discuss these developments at length. -

Libertas Schulze-Boysen Und Die Rote Kapelle Libertas Schulze-Boysen Und Die Rote Kapelle
Libertas Schulze-Boysen und die Rote Kapelle Libertas Schulze-Boysen und die Rote Kapelle Der Großvater, Fürst Philipp Eulenburg zu Hertefeld, Familie genießt als Jugendfreund des Kaisers lange Zeit des- sen Vertrauen und gilt am Hofe als sehr einflussreich. und Nach öffentlichen Anwürfen wegen angeblicher Kindheit homosexueller Neigungen lebt der Fürst seit 1908 zurückgezogen in Liebenberg. Aus der Ehe mit der schwedischen Gräfin Auguste von Sandeln gehen sechs Kinder hervor. 1909 heiratet die jüngste Tochter Victoria den Modegestalter Otto Haas-Heye, einen Mann mit großer Ausstrahlung. Die Familie Haas- Heye lebt zunächst in Garmisch, dann in London und seit 1911 in Paris. Nach Ottora und Johannes kommt Libertas am 20. November 1913 in Paris zur Welt. Ihr Vorname ist dem „Märchen von der Freiheit“ entnom- men, das Philipp Eulenburg zu Hertefeld geschrieben hat. Die Mutter wohnt in den Kriegsjahren mit den Kindern in Liebenberg. 1921 stirbt der Großvater, und die Eltern lassen sich scheiden. Nach Privatunterricht in Liebenberg besucht Libertas seit 1922 eine Schule in Berlin. Ihr Vater leitet die Modeabteilung des Staatlichen Kunstgewerbemu- seums in der Prinz-Albrecht-Straße 8. Auf den weiten Fluren spielen die Kinder. 1933 wird dieses Gebäude Sitz der Gestapozentrale. Die Zeichenlehrerin Valerie Wolffenstein, eine Mitarbeiterin des Vaters, nimmt sich der Kinder an und verbringt mit ihnen den Sommer 1924 in der Schweiz. 4 Geburtstagsgedicht Es ist der Vorabend zum Geburtstag des Fürsten. Libertas erscheint in meinem Zimmer. Sie will ihr Kästchen für den Opapa fertig kleben[...] „Libertas, wie würde sich der Opapa freuen, wenn Du ein Gedicht in das Kästchen legen würdest!“ Sie jubelt, ergreift den Federhalter, nimmt das Ende zwischen die Lippen und läutet mit den Beinen. -

Iraqis 2003 Afghans 2001 Iraqis 1991 Serbs 1993–1999 Sales List No.1
USA¤ Iraqis 2003 Afghans 2001 Iraqis 1991 Serbs 1993–1999 Propaganda Leaflets for the Enemy in War at Fixed Prices Sales List No.1 The Leaflet Collector Sales List No. 1 15 2003 USA ¤Iraqis Notes: President George W. Bush announced the opening of the second Persian Gulf War at 10:15 pm on 19 March 2003, just 90 minutes after the deadline for President Saddam Hussein to exile himself and his sons from Iraq. On 20 March the U.S. First Marine Division crossed the border at 9 pm and advanced. On 2 May 2004 President Bush declared on the U.S. aircraft carrier Abraham Lincoln “Mission Accomplished”. But “mission” was not yet accomplished and the war and dropping of leaflets continued. The leaflets offered for sale here are arranged in alphabetical and numerical order of code printed on the leaflets. #S1-1.......020-01Df¤ Coloured – 15x7 cm – 2 – preservation: 1 – 2003 – illustration of title page – description: anti- aircraft gun is firing at US-airplane, airplane is firing a rocket at gun position, gun und soldiers are destroyed – Translation: [If!, Then, You decide!]. Euro 10 8 #S1-2.......IZD 006 15x7 cm – preservation: 1 – 2003 – description: US aircraft is firing at the same time at Iraqi radar site and anti-aircraft rocket – Translation: [Iraqis beware! Do not track or fire on Coalition aircraft! /Attention Iraqi air defense!... No tracking or firing on Coalition aircraft will be tolerated! You could be next.]. Euro 10 #S1-3.......IZD¤ 009 Coloured – 15x7 cm – 2 – preservation: 1 – 11.2002 – illustration of title page – description: a bomb has been dropped, airplanes are leaving the scene – Translation: [Military fiber optic cable /For your safety. -
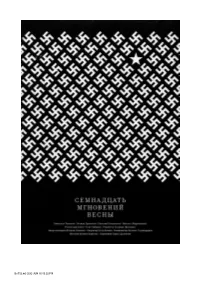
Botsl#5 2013 Jun 10 12:30 PM Mike Sperlinger: Seventeen Types of Ambiguity
BoTSL#5 2013 JUN 10 12:30 PM Mike Sperlinger: SEVENTEEN TYPES OF AMBIGUITY This bulletin would like to grow up to be a New Yorker article. It was researched in complete ignorance of the Russian language, and relied on the generosity of a number of people including Sergei Kostin, Alexander Ostrogorsky, Olga Semyonova, Sergei Stafeev, and, in particular, Sophio Medoidze. All photographs of Julian Semyonov are courtesy of his daughter, Olga Semyonova. With apologies to William Empson Cover image: poster design for Seventeen Moments of Spring by Alexander Zhuravskiy. Reproduced with kind permission BoTSL#5 2013 JUN 10 12:30 PM 2 Mike Sperlinger: SEVENTEEN TYPES OF AMBIGUITY The Gestapo intercepted an encrypted message which read: “Justas, you asshole. Alex.” Only Stirlitz could figure out that he had been conferred the rank of the Hero of the Soviet Union. On February 8, 2003, Vladimir Putin awarded the Order for Merit to the Fatherland, Class III, to the actor Vyacheslav Tikhonov. It was Tikhonov’s 75th birthday. Tikhonov had enjoyed a long career on stage and in film, but no one was under any illusions for what role he was receiving this honor — the same one, in fact, for which he had received a medal as a Hero of Socialist Labor from the Soviet premier Leonid Brezhnev in 1982, which was already nine years after the fact. Tikhonov was synonymous with the role of Max Otto von Stirlitz — a.k.a.“Justas,” a.k.a. Maxim Maximovich Isaev, secret agent of Moscow Center — in the television series Seventeen Moments of Spring. -

Widerstandsgruppe Schulze-Boysen/Harnack
Widerstandsgruppe Schulze-Boysen/Harnack Bearbeitet von Klaus Lehmann Herausgegeben von der zentralen Forschungsstelle der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN Berliner Verlag GmbH, Berlin 1948, 88 Seiten Faksimileausgabe der Seiten 3 bis 27 und 86 bis 88 Die Schulze-Boysen/Harnack-Gruppe wurde 1942 von der Gestapo un- ter dem Begriff Rote Kapelle entdeckt und ausgeschaltet. Diese erste ausführliche Veröffentlichung erschien in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone und wurde von der VVN, einer von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) gelenkten Organisation, herausge- geben. Während die Widerstandsarbeit der Schulze-Boysen/Harnack-Gruppe mit Flugblättern, Zeitschriften, Klebeaktionen, Hilfe für politisch verfolg- te bis hin zur Beschaffung von Waffen beschrieben wird, wird ihre Spi- onagetätigkeit für die Sowjetunion bewusst verschwiegen. Die Spionagesender, die vom sowjetischen Nachrichtendienst zur Ver- fügung gestellt worden waren, werden hier stattdessen in Geräte um- gedeutet, die "mit ihren Sendungen das deutsche Volk" aufklären soll- ten (S.15). Dies zeigt, dass man sich zur Spionage für Stalin nicht be- kennen wollte, weil diese mit den damals gängigen moralischen Maß- stäben nicht in Einklang zu bringen war. Dies wandelte sich erst Ende der 1960-er Jahre, als die Sowjetunion einigen Mitgliedern der Roten Kapelle postum Militärorden verlieh und die DDR sie fortan als "Kundschafter" und Paradebeispiel für kommu- nistischen geführten Widerstand feierte. Auf den Seiten 28 bis 85 werden 55 Mitglieder -

Flyer RK 2013 Schulen.Indd 1 29.12.12 13:40
Mildred-Harnack-Oberschule Berlin-Lichtenberg, Cato Bontjes van Beek-Gymnasium Achim, Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule Berlin-Karlshorst, Libertasschule Löwenberg, Gedenkstätte Deutscher Widerstand laden ein: Widerstand und Zivilcourage – Auf den Spuren der Roten Kapelle 2012/2013 jährt sich die Verfolgung von über 120 Gegnern des Naziregimes zum 70. Mal. Aus diesem Anlass erinnern Jugendliche an Widerstandskämpfer/-innen, deren Namen ihre Schulen tragen. Mittwoch, 16. Januar 2013 Ab 16 Uhr: Ausstellungen, Informationen der beteiligten Schulen 17.00 Uhr: Gedenkveranstaltung mit Beiträgen der Schulen Anschließend: Kleiner Empfang Aula der Mildred Harnack-Schule Schulze-Boysen-Straße 12 10365 Berlin-Lichtenberg U5 Magdalenenstraße S Frankfurter Allee #ATO"ONTJES VAN"EEK Gedenkstätte 'YMNASIUM Deutscher Widerstand Mildred Harnack Schule flyer RK 2013 schulen.indd 1 29.12.12 13:40 )CHWILL NUREINS )CHWILLNUR SEIN UND EINSSEIN DASISTEIN -ENSCH UNDDASIST EIN-ENSCH Widerstand und Zivilcourage – Auf den Spuren der Roten Kapelle Arbeiter, Angestellte, Intellektuelle, Künstler, Soldaten, Offiziere, Marxisten, Christen – Frauen und Männer unterschiedlicher sozialer Herkunft mit verschiedenen weltanschaulichen Ansich- ten fanden in ihrer Ablehnung des NS-Regimes zusammen. Neben der Diskussion politischer, philosophischer und künst- lerischer Fragen halfen sie Verfolgten, dokumentierten NS- Gewaltverbrechen, riefen in Flugschriften zu aktivem und passivem Widerstand auf und verbreiteten Flugblätter gegen die Propagandaausstellung „Das Sowjetparadies“. Es bestanden Kontakte zu Widerstandsgruppen in Berlin und Hamburg und zu Zwangsarbeitern und Vertretern der US-amerikanischen und sowjetischen Botschaft in Berlin. Im Herbst 1942 nahm die Gestapo über 120 Regimegegner fest und ordnete sie dem Ermittlungs-und Verfolgungskomplex „Rote Kapelle“ zu. 92 wurden vor dem Reichskriegsgericht und dem „Volksgerichtshof“ angeklagt. 49 von ihnen, darunter 19 Frauen, wurden in Plötzensee und Halle ermordet oder starben in der Haft. -

Widerstand Und Zivilcourage – Auf Den Spuren Der Roten Kapelle
Mildred-Harnack-Oberschule Berlin-Lichtenberg, Cato Bontjes van Beek-Gymnasium Achim, Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule Berlin- Karlshorst, Libertasschule Löwenberg, Gedenkstätte Deutscher Widerstand laden ein: Widerstand und Zivilcourage – Auf den Spuren der Roten Kapelle 2012/2013 jährt sich die Verfolgung von über 120 Gegnern des Naziregimes zum 70. Mal. Aus diesem Anlass erinnern Jugendliche an Widerstandskämpfer/-innen, deren Namen ihre Schulen tragen. Mittwoch, 16. Januar 2013 Ab 16 Uhr: Ausstellungen, Informationen der beteiligten Schule 17.00 Uhr: Gedenkveranstaltung mit Beiträgen der Schulen Anschließend: Kleiner Empfang Aula der Mildred Harnack-Schule Schulze-Boysen-Straße 12 10365 Berlin-Lichtenberg U5 Magdalenenstraße S Frankfurter Allee Widerstand und Zivilcourage – Auf den Spuren der Roten Kapelle Arbeiter, Angestellte, Intellektuelle, Künstler, Soldaten, Offiziere, Marxisten, Christen – Frauen und Männer unterschiedlicher sozialer Herkunft mit verschiedenen weltanschaulichen Ansichten fanden in ihrer Ablehnung des NS-Regimes zusammen. Neben der Diskussion politischer, philosophischer und künstlerischer Fragen halfen sie Verfolgten, dokumentierten NS-Gewaltverbrechen, riefen in Flugschriften zu aktivem und passivem Widerstand auf und verbreiteten Flugblätter gegen die Propagandaausstellung „Das Sowjetparadies“. Es bestanden Kontakte zu Widerstandsgruppen in Berlin und Hamburg und zu Zwangsarbeitern und Vertretern der US-amerikanischen und sowjetischen Botschaft in Berlin. Im Herbst 1942 nahm die Gestapo über 120 Regimegegner fest und ordnete sie dem Ermittlungs-und Verfolgungskomplex „Rote Kapelle“ zu. 92 wurden vor dem Reichskriegsgericht und dem „Volksgerichtshof“ angeklagt. 49 von ihnen, darunter 19 Frauen, wurden in Plötzensee und Halle ermordet oder starben in der Haft. Cato Bontjes van Beek (1921-1943), Keramikerin Hilde Coppi (1909-1943), Angestellte Hans Coppi (1916-1942), Dreher Dr. Mildred Harnack (1902-1943), Literaturwissenschaftlerin Libertas Schulze-Boysen (1913-1942), Filmkritikerin . -

The Fédération Internationale Des Résistants (FIR) Its Activities During the Breakdown of the Soviet Bloc1
S: I. M. O. N. SHOAH: I NTERVENTION. M ETHODS. DOCUMENTATION. Maximilian Becker The Fédération Internationale des Résistants (FIR) Its activities during the Breakdown of the Soviet Bloc1 Abstract This paper offers an analysis of the activities of the communist-dominated Fédération Inter- nationale des Résistants (International Federation of Resistance Movements, FIR), the inter- national umbrella organisation of associations of victims of Nazi persecution from both Eastern and Western Europe between the late 1980s and early 1990s. During this time, the collapse of the Soviet Bloc led to a deep crisis for the Eastern European organisations like the Polish Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (Union of Fighters for Freedom and Democracy) representing the former anti-fascist resistance fighters and political prisoners of Nazi concentration camps, which had been part of the communist power apparatus, and therefore of FIR. The organisation, which had been mired in growing financial difficulties for at least two decades, then lost much of its influence and of its potential to spread its mes- sage among the public. Nevertheless, FIR tried to maintain its activities with a special focus on dealing with right-wing extremism, the preservation of the rights and pensions of former resistance fighters, a commitment to peace and disarmament, as well as to the politics of memory. In June 1991, the Fédération Internationale des Résistants (International Federa- tion of Resistance Movements, hereafter FIR) held its Eleventh Ordinary Congress Moscow. -

WIDERSTAND Gegen Den Nationalsozialismus in Berlin Widerstand Gegen Den Nationalsozialismus War Schwierig, Aber Möglich
WIDERSTAND gegen den Nationalsozialismus in Berlin Widerstand gegen den Nationalsozialismus war schwierig, aber möglich. Er endete für die han- delnden Akteure oftmals mit Verhaftung, Folter, Verurteilung und Tod. Dennoch sind manche Menschen mutig diesen Weg gegangen. Herausgeber: Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Die Berliner Geschichtswerkstatt ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1981 besteht. Im Zent- rum unserer Arbeit stehen Alltagsgeschichte und die Geschichte „von unten“, wobei wir die Erinnerungsarbeit nicht als Selbstzweck verstehen. Wir wollen anhand des Schicksals der NachbarInnen am Wohnort Zeitgeschichte und die eigene Verstrickung darin nachvollzieh- bar machen. Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Tel: 030/215 44 50 [email protected] www.berliner-geschichtswerkstatt.de Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Berlin Herausgeber: Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Mit Beiträgen von: Geertje Andresen Madeleine Bernstorff Dörte Döhl Eckard Holler Thomas Irmer Jürgen Karwelat Ulrike Kersting Annette Maurer-Kartal Annette Neumann Cord Pagenstecher Kurt Schilde Bärbel Schindler-Saefkow Dokumentation zur Veranstaltungsreihe der Berliner Geschichtswerkstatt e. V. „Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Berlin“ Januar bis Juni 2014 Eigenverlag der Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Goltzstraße 49, 10781 Berlin, 2014 Druck: Rotabene Medienhaus, Schneider Druck GmbH, Rothenburg ob der Tauber Satz, Layout und Umschlaggestaltung: Irmgard Ariallah, Atelier Juch © für die Texte bei den Autorinnen und Autoren -

Heldenkinder Verräterkinder
Eva Madelung Joachim Scholtyseck Heldenkinder Verräterkinder Wenn die Eltern im Widerstand waren unter Mitwirkung von Christine Blumenberg-Lampe und Petra Schneiderheinze Verlag C H. Beck Mit 26 Abbildungen © Verlag C. H. Beck oHG, München 2007 Gesetzt aus der Adobe Garamond Pro und der Frutiger bei Fotosatz Amann, Aichstetten Druck und Bindung: Ebner & Spiegel, Ulm Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany ISBN 978 3 406 56319 5 Eingelesen mit ABBYY Fine Reader www.beck.de Inhalt Einleitung von Eva Madelung Zur Entstehung des Buches und des Autorenteams 7 Familientherapeutische, entwicklungspsychologische und anthropologische Erkenntnisse als Verständnishintergrund 9 Methodische Betrachtungen eines Historikers von Joachim Scholtyseck 21 Die Befragung von Zeitzeugen durch Zeitzeugen 34 Interviews Alfred von Hofacker (Caesar von Hofacker) 35 Petra Schneiderheinze (Friedrich August Schneiderheinze) 59 Heinz Hermann Niemöller (Martin Niemöller) 70 Christine Blumenberg-Lampe (Adolf Lampe) 88 Michael Hahn (Kurt Hahn) 102 Mechthild von Kleist (Ewald von Kleist-Schmenzin) 119 Herzeleide Stökl (Fabian von Schlabrendorff) 135 Wibke Bruhns (Hans Georg Klamroth) 148 Saskia von Brockdorff (Erika von Brockdorff) 166 Gabriele von Bülow (Hans Jürgen von Bülow) 181 Katharina Christiansen (Julius Leber) 193 Monika Popitz-Kuenzer (Richard Kuenzer) 209 Doris Asmussen (Hans Christian Asmussen) 219 Regine Sarstedt (Hannelore Thiel) 234 Uta Maass (Hermann Maass) 248 Schlusswort von Eva Madelung Lernen wir aus der Geschichte? 271 Dank 272 Anhang Anmerkungen 275 Bildnachweis 288 Glossar 289 Personenregister 304 Einleitung von Eva Madelung Zur Entstehung des Buches und des Autorenteams Es gibt viele Veröffentlichungen, die sich mit den Nachfahren der Opfer und Täter und auch der Mitläufer des NS-Regimes befassen.