Blick Nach Süden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
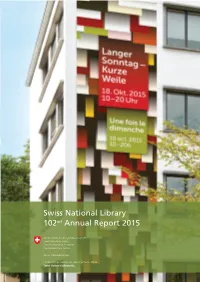
Swiss National Library. 102Nd Annual Report 2015
Swiss National Library 102nd Annual Report 2015 Interactive artists‘ books: three-dimensional projections that visitors can manipulate using gestures, e.g. Dario Robbiani’s Design your cake and eat it too (1996). Architectural guided tour of the NL. The Gugelmann Galaxy: Mathias Bernhard drew on the Gugelmann Collection to create a heavenly galaxy that visitors can move around using a smartphone. Table of Contents Key Figures 2 Libraries are helping to shape the digital future 3 Main Events – a Selection 6 Notable Acquisitions 9 Monographs 9 Prints and Drawings Department 10 Swiss Literary Archives 11 Collection 13 “Viva” project 13 Acquisitions 13 Catalogues 13 Preservation and conservation 14 Digital Collection 14 User Services 15 Circulation 15 Information Retrieval 15 Outreach 15 Prints and Drawings Department 17 Artists’ books 17 Collection 17 User Services 17 Swiss Literary Archives 18 Collection 18 User Services 18 Centre Dürrenmatt Neuchâtel 19 Finances 20 Budget and Expenditures 2014/2015 20 Funding Requirement by Product 2013-2015 20 Commission and Management Board 21 Swiss National Library Commission 21 Management Board 21 Organization chart Swiss National Library 22 Thanks 24 Further tables with additional figures and information regarding this annual report can be found at http://www.nb.admin.ch/annual_report. 1 Key Figures 2014 2015 +/-% Swiss literary output Books published in Switzerland 12 711 12 208 -4.0% Non-commercial publications 6 034 5 550 -8.0% Collection Collections holdings: publications (in million units) 4.44 -

Maurizio Basili Ultimissimo
Le tesi Portaparole © Portaparole 00178 Roma Via Tropea, 35 Tel 06 90286666 www.portaparole.it [email protected] isbn 978-88-97539-32-2 1a edizione gennaio 2014 Stampa Ebod / Milano 2 Maurizio Basili La Letteratura Svizzera dal 1945 ai giorni nostri 3 Ringrazio la Professoressa Elisabetta Sibilio per aver sempre seguito e incoraggiato la mia ricerca, per i consigli e le osservazioni indispensabili alla stesura del presente lavoro. Ringrazio Anna Fattori per la gratificante stima accordatami e per il costante sostegno intellettuale e morale senza il quale non sarei mai riuscito a portare a termine questo mio lavoro. Ringrazio Rosella Tinaburri, Micaela Latini e gli altri studiosi per tutti i consigli su aspetti particolari della ricerca. Ringrazio infine tutti coloro che, pur non avendo a che fare direttamente con il libro, hanno attraversato la vita dell’autore infondendo coraggio. 4 INDICE CAPITOLO PRIMO SULL’ESISTENZA DI UNA LETTERATURA SVIZZERA 11 1.1 Contro una letteratura svizzera 13 1.2 Per una letteratura svizzera 23 1.3 Sull’esistenza di un “canone elvetico” 35 1.4 Quattro lingue, una nazione 45 1.4.1 Caratteristiche dello Schweizerdeutsch 46 1.4.2 Il francese parlato in Svizzera 50 1.4.3 L’italiano del Ticino e dei Grigioni 55 1.4.4 Il romancio: lingua o dialetto? 59 1.4.5 La traduzione all’interno della Svizzera 61 - La traduzione in Romandia 62 - La traduzione nella Svizzera tedesca 67 - Traduzione e Svizzera italiana 69 - Iniziative a favore della traduzione 71 CAPITOLO SECONDO IL RAPPORTO TRA PATRIA E INTELLETTUALI 77 2.1 Gli intellettuali e la madrepatria 79 2.2 La ristrettezza elvetica e le sue conseguenze 83 2.3 Personaggi in fuga: 2.3.1 L’interiorità 102 2.3.2 L’altrove 111 2.4 Scrittori all’estero: 2.4.1 Il viaggio a Roma 120 2.4.2 Parigi e gli intellettuali svizzeri 129 2.4.3 La Berlino degli elvetici 137 2.5 Letteratura di viaggio. -

Kirchemusik in Der Liturgie
1 KIRCHEMUSIK IN DER LITURGIE Oktober 2002 - September 2003 OKTOBER 1. Dienstag 17.15 Uhr Vorabendgottesdienst: Orgelwerke von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und Antonio Vivaldi (1678-1741), Astrid Ender, Orgel 2. Mittwoch 08.30 Uhr Stiftsamt: Gregorianischer Choral mit Peter Sigrist, Patro- Kantor, Astrid Ender, Orgel zinium 09.45 Uhr Festgottesdienst mit Festpredigt von Prof. Dr. Dietrich Wiederkehr, OFMCap, Luzern, Joseph Haydn (1732- 1809): Missa Cellensis, genannt Mariazeller Messe (1782 komponiert), Cornelia Stäb, Sopran, Stifts-Chor St. Leo- degar, Luzerner Sinfonieorchester LSO, Astrid Ender, Orgel, Ludwig Wicki, Leitung, anschliessend Apéro - Imbiss auf dem Kirchplatz 11.30 Uhr Kein Gottesdienst 18.00 Uhr Siehe am 1. Oktober 2002 um 17.15 Uhr 6. 27. So.i.Jk. 11.30 Uhr "Romantisches Frankreich", Astrid Ender, Orgel 13. 28. So.i.Jk. 11.30 Uhr Orgelwerke von Alexandre Guilmant (1837-1911), Marco Enrico Bossi (1861-1925) und Eugène Gigout (1844- 1925), Wolfgang Broedel, Orgel 19. Samstag 10.30 Uhr 75 Jahre Indien-Mission St. Anna: Gottesdienst mit Festpredigt von Diözesanbischof Kurt Koch, Otto Lustenberger (1924*): Messgesänge zur Ehre der Hl. Mutter Anna für Frauenchor, Gemeinde und Orgel (2000) Schwestern-Chor der Schwesterngemeinschaft St. Anna Luzern, Otto Lustenberger, Orgel, Ursi Burkart, Leitung 20. 29. So.i.Jk. 11.30 Uhr Musik zu: "...In der Orgel beginnt die Welt selbst zu Weltmission singen, Holz und Metall gewinnen Stimmen..." (Fritz Usinger), Wolfgang Sieber, Orgel 21. Montag & 10.30 Uhr & Musikvermittlung für Luzerner Volksschulen: Peer 22. Dienstag 14.00 Uhr Gynt und die Grosse Hoforgel, Geheimnisvolles mit Franz Xaver Nager, Texte, Wolfgang Sieber, Orgel (Veranstalter: MHS Luzern) 27. -

LYONEL FEININGER Cover of the Manifesto
LYONEL FEININGER Cover of the manifesto »The01 ultimate aim of all creative Feininger’s Expressionist cathedral has three towers with star-topped spires, from which beams activity is the building,« states of light go out in various directions. The three spires stand for architecture, the arts, and the Walter Gropius’ Bauhaus manifesto. crafts. Naturally, architecture was represented by the central and tallest spire. The primacy He saw building as a social, intel- of architecture was unquestioned, and the study of architecture was to stand at the center of lectual,and symbolic activity, a education. The other arts and crafts were ancillary to it. union of genres and vocations, the But, as so often, there was a world of difference between the vision and the reality, for leveling of differences in status. The though Feininger’s visionary woodcut makes a clear affirmation, the training of architects Gothic cathedral epitomized this. played virtually no part in the early years of the Weimar Bauhaus. In 1923, Gropius was able to mount the International Architectural Exhibition, which he had put together in the context of the Bauhaus exhibition—the first presentation of modern architecture in the 1920s—but the setting up of the study of architecture as a Bauhaus training program did not take place until the Bauhaus moved to Dessau. Two versions: one goal Even before Lyonel Feininger became the first teacher to be appointed by Walter Gropius, in the spring of 1919, and to begin his activity at the newly founded Bauhaus, he was given the 1871 Born in New York on July 17 task of supplying a programmatic illustration for the Bauhaus manifesto. -

Press Release
NEWS FROM THE GETTY news.getty.edu | [email protected] DATE: March 20, 2019 MEDIA CONTACT: FOR IMMEDIATE RELEASE Amy Hood Getty Communications (310) 440-6427 [email protected] GETTY RESEARCH INSTITUTE PRESENTS BAUHAUS BEGINNINGS Marking the 100th anniversary of the founding of the Bauhaus school, the exhibition explores the art, architecture, design, and philosophy of the school’s early years. Accompanied by the online exhibition Bauhaus: Building the New Artist At the Getty Research Institute, Getty Center Los Angeles June 11 – October 13, 2019 Los Angeles – The Bauhaus is widely regarded as the most influential school of art and design of the 20th century. Marking the 100th anniversary of the school’s opening, Bauhaus Beginnings on view at the Getty Research Institute from June 11 through October 13, 2019 examines the founding principles of the landmark institution. “For a century the Bauhaus has widely inspired modern design, architecture and art as well as the ways these disciplines are taught,” said Mary Miller, director of the Getty Research Institute. “However, the Joost Schmidt (German, 1893–1948), Form and Color Study, ca. 1929–1930, watercolor over graphite story of Bauhaus is not just the story of its on paper. Los Angeles, Getty Research Institute, 860972 teachers or most famous students. At the Getty Research Institute our archives are rich in rare prints, drawings, photographs, and other materials from some of the most famous artists to work at Bauhaus as well as students whose work, while lesser known, is extremely compelling and sometimes astonishing. Because of the breadth of our special collections we are able to offer a never-before-seen side of the Bauhaus along with more familiar images.” The J. -

Exhibition Documentation
Dagmar Heppner – Fiction 26th January – 2nd March 2013 Opening reception 25th January, 6 – 8 pm Colour and the perception thereof is a unique experience for all of us. When a child is taught what colour the grass is, or the sun, it is given the key to a mutual understanding, which makes up our social paradigm. By stimulating the senses and allowing them to communicate in a harmonious and equal manner, we can begin to build a basis for ex- pressing what seems so obvious, but remains utterly vague. At an early age, we blindly agree with what we are told, but then spend adulthood discovering our own truths. We are obliged to accept some, or find out that others may distort when viewed from a dif- ferent angle, but colour is a subject one never seems to doubt. It is exactly this discrep- ancy, between what we take for granted and what we actually see (that is: what might as well be true), that fascinates Dagmar Heppner and leads her to explore the possibilities for experiencing and understanding the social construct that may be linked to it. What one person’s mind may perceive as true can be a falsity to the other. For her first solo exhibition at BolteLang, Dagmar Heppner explores these personal truths. She invites us to follow a site-specific trail of fabric, letting the viewer interact with an assemblage of hand-dyed fabrics, sewn together using techniques otherwise applied for garments and interior design/textile decoration – foldings remind of skirts and dresses, or the shirring of curtains. -
B Au H Au S Im a G Inis Ta E X H Ib Itio N G U Ide Bauhaus Imaginista
bauhaus imaginista bauhaus imaginista Exhibition Guide Corresponding p. 13 With C4 C1 C2 A D1 B5 B4 B2 112 C3 D3 B4 119 D4 D2 B1 B3 B D5 A C Walter Gropius, The Bauhaus (1919–1933) Bauhaus Manifesto, 1919 p. 24 p. 16 D B Kala Bhavan Shin Kenchiku Kōgei Gakuin p. 29 (School of New Architecture and Design), Tokyo, 1932–1939 p. 19 Learning p. 35 From M3 N M2 A N M3 B1 B2 M2 M1 E2 E3 L C E1 D1 C1 K2 K K L1 D3 F C2 D4 K5 K1 G D1 K5 G D2 D2 K3 G1 K4 G1 D5 I K5 H J G1 D6 A H Paul Klee, Maria Martinez: Ceramics Teppich, 1927 p. 57 p. 38 I B Navajo Film Themselves The Bauhaus p. 58 and the Premodern p. 41 J Paulo Tavares, Des-Habitat / C Revista Habitat (1950–1954) Anni and Josef Albers p. 59 in the Americas p. 43 K Lina Bo Bardi D and Pedagogy Fiber Art p. 60 p. 45 L E Ivan Serpa From Moscow to Mexico City: and Grupo Frente Lena Bergner p. 65 and Hannes Meyer p. 50 M Decolonizing Culture: F The Casablanca School Reading p. 66 Sibyl Moholy-Nagy p. 53 N Kader Attia G The Body’s Legacies: Marguerite Wildenhain The Objects and Pond Farm p. 54 Colonial Melancholia p. 70 Moving p. 71 Away H G H F1 I B J C F A E D2 D1 D4 D3 D3 A F Marcel Breuer, Alice Creischer, ein bauhaus-film. -
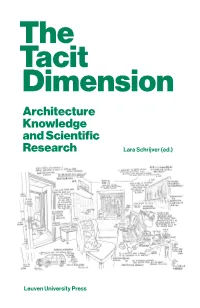
The Tacit Dimension Architecture Knowledge and Scientific Research Lara Schrijver (Ed.)
The Tacit Dimension Architecture Knowledge and Scientific Research Lara Schrijver (ed.) Leuven University Press The Tacit Dimension This publication was made possible by funding from the Netherlands Organisation for Scientific Research (IGW, 2014–2016, project no. 236–57-001), from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (Marie Skłodowska-Curie grant agreement no. 860413), and KU Leuven Fund for Fair Open Access. Published in 2021 by Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain / Universitaire Pers Leuven. Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium). © Selection and editorial matter: Lara Schrijver, 2021 © Individual chapters: the respective authors, 2021 This book is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Non- Derivative 4.0 Licence. Further details about Creative Commons licences are availa- ble at http://creativecommons.org/licenses/ Attribution should include the following information: Lara Schrijver (ed.), The Tacit Dimension: Architecture Knowledge and Scientific Research. Leuven, Leuven University Press. (CC BY-NC-ND 4.0) ISBN 978 94 6270 271 4 (Paperback) ISBN 978 94 6166 380 1 (ePDF) ISBN 978 94 6166 381 8 (ePUB) https://doi.org/10.11116/9789461663801 D/2021/1869/12 NUR: 648 Layout & cover design: DOGMA Cover illustration: ‘Uber taxi driver in Shenzhen’ 2015. Ink on paper 50 × 65 cm, Jan Rothuizen, from a series for the Shenzhen Bi-city Biennale of Urbanism/ Architecture 2015. Contents Introduction: Tacit Knowledge, Architecture and its Underpinnings 7 Lara -

Erinnerungen an Sturm Und Bauhaus Lothar Schreyer
ERINNERUNGEN AN STURM UND BAUHAUS LOTHAR SCHREYER 1956 LOTHAR SCHREYER ERINNERUNGEN AN STURM UND BAUHAUS WAS IST DES MENSCHEN BILD? ALBERT LANGEN-GEORG MÜLLER MÜNCHEN (,(^54) r*-\ UNIVERSITATS BIBLIOTHEK HEIDELBERG \_—-——-y / G2 59 INHALT WAS IST DER STURM? - Herwarth Waiden . 7 UNBEGREIFLICHES GESCHENK. 18 LASST DICKE MÄNNER UM MICH SEIN! - Theodor Däubler 54 STURM-FAHRT IN DIE NACHT - ClaireWaldoff .. .. 55 DER GETREUE ZEUGE - Rudolf Blümner . 78 DlE WORTKUNST DES STURM. 88 DER MANN MIT DER NELKE - Oskar Kokoschka . 95 DER VATER DER SPIELER - William Wauer .102 DER LUMPENSAMMLER - KurtSchwitters .114 DAS MENSCHENHAUS- Walter Gropius.124 GELMERODA * Lyonei Feininger.151 WER WAR MAX BERG?.141 DAS TOTENHAUS - Lothar Schreyer.158 IN DER ZAUBERKÜCHE - Paul Klee.164 DlE KUNSTFIGUR - Oskar Schlemmer .174 BAUHÄUSLER IN WEIMAR .185 UTOPIA - Maria Marc.200 IM SPIEL DER FRAUEN - AlmaMahler-Gropius.211 DlE IKONE * WassilyKandinsky .225 DlE MASCHINERIE DER WELT - LaszloMoholy-Nagy . 257 DAS GLEICHGEWICHT - Johannes Itten.245 IN DER ERNTEZEIT - Georg Muche.258 FRUCHT UND NEUE SAAT .265 WER HEBT DEN SCHATZ? - Otto Nebel.275 UNVERLIERBAR - Nell Waiden .281 DAS MENSCHENHAUS? Das Bauhaus - das Menschenhaus? Zweimal hat Walter Gropius in Deutschland seinen Plan des Bauhauses gestartet. Zweimal unterlag Gropius. Aber im Geistigen lebt das Bauhaus. Oder ist es eine Le- gende? Die Gegner des Bauhauses kolportieren gegen Gropius den bösen Satz: Im Staatlichen Bauhaus Weimar ver- kündete Gropius, daß er »die Kathedrale des Sozialismus« bauen werde. In dem Aufruf zum Bauhaus Dessau ver- kündete er: »die Wohnmaschine«. Was ist aus der Ka- thedrale des Sozialismus und der Wohnmaschine ge- worden? — Antwort: die Bauhaustapete! Immerhin — mit der Bauhaustapete sind viele bürger- liche Wohnungen tapeziert. -

Christoph Wagner »Ein Garten Für Orpheus« Zur Transformation Der
Christoph Wagner »Ein Garten für Orpheus« Zur Transformation der Landschaft bei Paul Klee im Jahre 1926 Betrachtet man die Illustrationen der kunsttheoretischen Schlüsselschrift Punkt und Linie zu Fläche von Wassily Kandinsky, die 1926 parallel mit der Einweihung des Dessauer Bauhauses erschien, stößt man auf Illustrationen, die bis dahin in kunsttheoretischen Publikationen nicht üblich waren: »Kristallskelette von Tri- chiten«,1 »Pflanzliche Schwimmbewegungen durch Geißeln«, »Blüte der Klema- tis« (Abb. 1) oder die »Linienbildung eines Blitzes« (Abb. i),1 »Sternhaufen im Herkules« oder »Nitritbildner looofach vergrößert«3 (Abb. 3). - Wohlgemerkt, es handelt sich um Illustrationen aus einer kunsttheoretischen Publikation. Solche Abbildungen aus Wissenschaft, Technik und Medizin waren beispielsweise im Almanach Der blaue Reiter, den Kandinsky 14 Jahre zuvor zusammen mit Franz Marc herausgegeben hatte,4 nicht zu finden. Dort hatte man ausschließlich Kunst- werke, wenn auch aus unterschiedlichsten kulturellen Bereichen, von der Kinder- kunst über außereuropäische Bildwerke bis hin zur damaligen Gegenwartskunst, reproduziert. Exemplarisch zeigen Kandinskys Illustrationen von 1926, wie sehr die Künstler des Bauhauses, darunter auch Paul Klee, in dieser Zeit von den neuen Dimensionen des Sichtbaren, die die technisch-optischen Geräte - vom Teleskop bis zur Röntgenkamera - zeigten, fasziniert waren. Diese wahrnehmungs- geschichtliche Konstellation wirft Fragen auf: Wie haben die Berührungs- und Reibungsflächen zwischen den künstlerischen Bildvorstellungen -

Passim 3 14.11.2008 17:35 Page 1
BN_passim_3 14.11.2008 17:35 Page 1 Passim 3|2008 Bollettino dell’Archivio svizzero di letteratura | Bulletin des Schweizerischen Literaturarchivs | Bulletin da l’Archiv svizzer da litteratura | Bulletin des Archives littéraires suisses Digital BN_passim_3 14.11.2008 17:35 Page 2 BN_passim_3 14.11.2008 17:35 Page 3 3 Editorial | Editoriale Archivalien sollen einerseits dem stets drohenden Zerfall trotzen und andererseits auch in Zukunft der Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Wie also Handschriften, Typoskripte, Fotografien, Ton- und Filmaufnahmen von und über Autorinnen und Autoren am besten aufbewahrt werden können, ist für Bibliotheken und Archive eine permanente Aufgabe. Auch die Schweizerische Nationalbibliothek macht sich dafür die multime- dialen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zu Nutze: So lassen sich per Mausklick in der noch im Aufbau befindlichen Archivdatenbank HelveticArchives, entwickelt von Rudolf Probst, neu auch die Bestände des Schweizerischen Literaturarchivs (SLA) abfragen. Seit dem 23. Mai 2008, dem 100. Geburtstag von Annemarie Schwarzenbach, sind grosse Teile der Fotosammlung der Autorin online zu sehen. Ferner werden im Projekt IMVOCS in Zusammenarbeit mit Memoriav audiovisuelle Dokumente digitalisiert, um sie auch für kommende Generationen sichtbar und hörbar zu erhalten (Beitrag von Felix Rauh). Protagonista di un commovente ricordo di Werner Morlang, è il poeta e scrittore Gerhard Meier (1917 – 2008); lo abbiamo voluto ospitare anche in copertina, dove con il suo poetico Inventar, accompagna il titolo -

Ökologische Wirkungskonzepte in Der Abstrakten Kunst, 1910-1960
Aus: Linn Burchert Das Bild als Lebensraum Ökologische Wirkungskonzepte in der abstrakten Kunst, 1910-1960 März 2019, 392 S., kart., zahlr. z.T. farb. Abb. 44,99 € (DE), 978-3-8376-4545-3 E-Book: PDF: 44,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4545-7 Schon um 1910 konzipierten zahlreiche Maler ihre Werke als Environments: In ihren Schriften legten sie dar, wie ihre abstrakten Bilder eine heilsame und vitalisierende Wirkung auf die Betrachtenden entfalten sollten, wobei Klima, Sonne, Luft und natür- liche Rhythmik als Vergleiche herangezogen wurden. Linn Burchert formuliert das Modell des Lebensraumes als wesentliche Bildauffas- sung so unterschiedlicher Künstler wie Wassily Kandinsky, Yves Klein, Max Burchartz und anderer. Dabei zeigt sich, dass ökologische Ideen schon vor den 1960er Jahren in die Kunst Einzug hielten und auf welche vielfältigen Quellen der Wissenschafts- und Ideengeschichte Künstler zur Begründung ihrer Ideen rekurrierten. Linn Burchert (Dr.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst- und Bild- geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. Zuvor war sie Doktorandin und wis- senschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Kunstgeschichte und Filmwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die Beziehungen zwischen Kunst-, Ideen- und Wissenschaftsgeschichte in der Moderne sowie Naturkonzepte und Naturzugänge in der Kunst von 1750 an bis in die Gegenwart. Weiteren Informationen und Bestellung unter: www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4545-3 © 2019 transcript Verlag, Bielefeld Inhalt 1. Einleitung: Abstrakte Malerei und Ökologie | 9 1.1 Das Bild als Lebensraum: Revision des Organismusmodells | 11 1.2 Kunst und Biologie nach 1900: Biozentrik, Bioromantik, Biomorphismus | 15 1.3 Historische und neue Konzepte der Bildmacht | 19 1.4 Methodik, Künstlerauswahl, Begriffe | 30 2.