Gertrud Grunow Biografie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
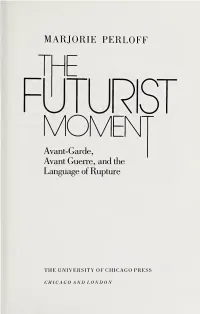
The Futurist Moment : Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture
MARJORIE PERLOFF Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS CHICAGO AND LONDON FUTURIST Marjorie Perloff is professor of English and comparative literature at Stanford University. She is the author of many articles and books, including The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition and The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage. Published with the assistance of the J. Paul Getty Trust Permission to quote from the following sources is gratefully acknowledged: Ezra Pound, Personae. Copyright 1926 by Ezra Pound. Used by permission of New Directions Publishing Corp. Ezra Pound, Collected Early Poems. Copyright 1976 by the Trustees of the Ezra Pound Literary Property Trust. All rights reserved. Used by permission of New Directions Publishing Corp. Ezra Pound, The Cantos of Ezra Pound. Copyright 1934, 1948, 1956 by Ezra Pound. Used by permission of New Directions Publishing Corp. Blaise Cendrars, Selected Writings. Copyright 1962, 1966 by Walter Albert. Used by permission of New Directions Publishing Corp. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 1986 by The University of Chicago All rights reserved. Published 1986 Printed in the United States of America 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 54321 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Perloff, Marjorie. The futurist moment. Bibliography: p. Includes index. 1. Futurism. 2. Arts, Modern—20th century. I. Title. NX600.F8P46 1986 700'. 94 86-3147 ISBN 0-226-65731-0 For DAVID ANTIN CONTENTS List of Illustrations ix Abbreviations xiii Preface xvii 1. -

1 1 December 2009 DRAFT Jonathan Petropoulos Bridges from the Reich: the Importance of Émigré Art Dealers As Reflecte
Working Paper--Draft 1 December 2009 DRAFT Jonathan Petropoulos Bridges from the Reich: The Importance of Émigré Art Dealers as Reflected in the Case Studies Of Curt Valentin and Otto Kallir-Nirenstein Please permit me to begin with some reflections on my own work on art plunderers in the Third Reich. Back in 1995, I wrote an article about Kajetan Mühlmann titled, “The Importance of the Second Rank.” 1 In this article, I argued that while earlier scholars had completed the pioneering work on the major Nazi leaders, it was now the particular task of our generation to examine the careers of the figures who implemented the regime’s criminal policies. I detailed how in the realm of art plundering, many of the Handlanger had evaded meaningful justice, and how Datenschutz and archival laws in Europe and the United States had prevented historians from reaching a true understanding of these second-rank figures: their roles in the looting bureaucracy, their precise operational strategies, and perhaps most interestingly, their complex motivations. While we have made significant progress with this project in the past decade (and the Austrians, in particular deserve great credit for the research and restitution work accomplished since the 1998 Austrian Restitution Law), there is still much that we do not know. Many American museums still keep their curatorial files closed—despite protestations from researchers (myself included)—and there are records in European archives that are still not accessible.2 In light of the recent international conference on Holocaust-era cultural property in Prague and the resulting Terezin Declaration, as well as the Obama Administration’s appointment of Stuart Eizenstat as the point person regarding these issues, I am cautiously optimistic. -

Alexander Calder James Johnson Sweeney
Alexander Calder James Johnson Sweeney Author Sweeney, James Johnson, 1900-1986 Date 1943 Publisher The Museum of Modern Art Exhibition URL www.moma.org/calendar/exhibitions/2870 The Museum of Modern Art's exhibition history— from our founding in 1929 to the present—is available online. It includes exhibition catalogues, primary documents, installation views, and an index of participating artists. MoMA © 2017 The Museum of Modern Art THE MUSEUM OF RN ART, NEW YORK LIBRARY! THE MUSEUM OF MODERN ART Received: 11/2- JAMES JOHNSON SWEENEY ALEXANDER CALDER THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK t/o ^ 2^-2 f \ ) TRUSTEESOF THE MUSEUM OF MODERN ART Stephen C. Clark, Chairman of the Board; McAlpin*, William S. Paley, Mrs. John Park Mrs. John D. Rockefeller, Jr., ist Vice-Chair inson, Jr., Mrs. Charles S. Payson, Beardsley man; Samuel A. Lewisohn, 2nd Vice-Chair Ruml, Carleton Sprague Smith, James Thrall man; John Hay Whitney*, President; John E. Soby, Edward M. M. Warburg*. Abbott, Vice-President; Alfred H. Barr, Jr., Vice-President; Mrs. David M. Levy, Treas HONORARY TRUSTEES urer; Mrs. Robert Woods Bliss, Mrs. W. Mur ray Crane, Marshall Field, Philip L. Goodwin, Frederic Clay Bartlett, Frank Crowninshield, A. Conger Goodyear, Mrs. Simon Guggenheim, Duncan Phillips, Paul J. Sachs, Mrs. John S. Henry R. Luce, Archibald MacLeish, David H. Sheppard. * On duty with the Armed Forces. Copyright 1943 by The Museum of Modern Art, 11 West 53 Street, New York Printed in the United States of America 4 CONTENTS LENDERS TO THE EXHIBITION Black Dots, 1941 Photo Herbert Matter Frontispiece Mrs. Whitney Allen, Rochester, New York; Collection Mrs. -

The Bauhaus 1 / 70
GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS 1 / 70 The Bauhaus 1 Art and Technology, A New Unity 3 2 The Bauhaus Workshops 13 3 Origins 26 4 Weimar 45 5 Dessau 57 6 Berlin 68 © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS 2 / 70 © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE ARTS & CRAFTS MOVEMENT 3 / 70 1919–1933 Art and Technology, A New Unity A German design school where ideas from all advanced art and design movements were explored, combined, and applied to the problems of functional design and machine production. © Kevin Woodland, 2020 Joost Schmidt, Exhibition Poster, 1923 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS / Art and TechnoLogy, A New Unity 4 / 70 1919–1933 The Bauhaus Twentieth-century furniture, architecture, product design, and graphics were shaped by the work of its faculty and students, and a modern design aesthetic emerged. MEGGS © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS / Art and TechnoLogy, A New Unity 5 / 70 1919–1933 The Bauhaus Ideas from all advanced art and design movements were explored, combined, and applied to the problems of functional design and machine production. MEGGS • The Arts & Crafts: Applied arts, craftsmanship, workshops, apprenticeship • Art Nouveau: Removal of ornament, application of form • Futurism: Typographic freedom • Dadaism: Wit, spontaneity, theoretical exploration • Constructivism: Design for the greater good • De Stijl: Reduction, simplification, refinement © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS / Art and TechnoLogy, A New Unity 6 / 70 1919–1933 -

Human, Spa Human, Space, Machine Experiments at the Bauhaus Pace
PRESSRELEASE SOUTHKOREANovember25th,2014 MediaContact:SydYi Totalpages:7(includedthispage) Tel.+82-2-2188-6232 [email protected] Human,Space,Machine-Stage ExperimentsattheBauhaus NationalMuseumofModernandContemporaryArt,Korea 313Gwangmyeong-roGwacheon-siGyeonggi-do427-701SouthKorea PRESSRELEASE ◇ A 3- year collaborative project with Bauhaus Dessau Foundation since 2012 - Displaying materials related to various stage experimental art and performance, dating back from the founding of Bauhaus in 1919 to its closure in 1933 - Also exhibiting works by 6 Korean contemporary artists whose works have been both directly and indirectly influenced by Bauhaus ◇ Held at National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, from Wednesday, Nov 12th, 2014 to Friday, Feb 27th, 2015 National Museum of Modern and Contemporary Art (acting director Nam-sun Yoon) is pleased to announce Human, Space, Machine- Stage Experiments at the Bauhaus, co-organized with Bauhaus Dessau Foundation, Germany (Director Dr. Claudia Perren), from November 12th, 2014 to February 22nd, 2015 at the National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul. Human, Space, Machine – Stage Experiments at the Bauhaus opened at the Dessau Bauhaus in Germany in December 2013, and was shown at the Henie Onstad Art Center in Norway in May 2014 before being presented in MMCA Seoul this November. While Bauhaus is considered a major art movement of 20th Century, it’s mainly regarded in Korea as a school which affected the architecture and design field. MMCA co-organized this exhibition with Bauhaus Dessau Foundation since 2012, in order to examine the Bauhaus thought on the human mind and body. Founded by Walter Gropius in 1919, Bauhaus (1919-1933) as an art & design educational institution had a great influence on the development of the 20th century art, architecture, textile, graphic, industrial design and typography. -

Dossiê Kandinsky Kandinsky Beyond Painting: New Perspectives
dossiê kandinsky kandinsky beyond painting: new perspectives Lissa Tyler Renaud Guest Editor DOI: https://doi.org/10.26512/dramaturgias.v0i9.24910 issn: 2525-9105 introduction This Special Issue on Kandinsky is dedicated to exchanges between Theatre and Music, artists and researchers, practitioners and close observers. The Contents were also selected to interest and surprise the general public’s multitudes of Kandinsky aficionados. Since Dr. Marcus Mota’s invitation in 2017, I have been gathering scholarly, professional, and other thoughtful writings, to make of the issue a lively, expansive, and challenging inquiry into Kandinsky’s works, activities, and thinking — especially those beyond painting. “Especially those beyond painting.” Indeed, the conceit of this issue, Kandinsky Beyond Painting, is that there is more than enough of Kandinsky’s life in art for discussion in the fields of Theatre, Poetry, Music, Dance and Architecture, without even broaching the field he is best known for working in. You will find a wide-ranging collection of essays and articles organized under these headings. Over the years, Kandinsky studies have thrived under the care of a tight- knit group of intrepid scholars who publish and confer. But Kandinsky seems to me to be everywhere. In my reading, for example, his name appears unexpectedly in books on a wide range of topics: philosophy, popular science, physics, neuroscience, history, Asian studies, in personal memoirs of people in far-flung places, and more. Then, too, I know more than a few people who are not currently scholars or publishing authors evoking Kandinsky’s name, but who nevertheless have important Further Perspectives, being among the most interesting thinkers on Kandinsky, having dedicated much rumination to the deeper meanings of his life and work. -

Getty Research Institute | June 11 – October 13, 2019
Getty Research Institute | June 11 – October 13, 2019 OBJECT LIST Founding the Bauhaus Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar (Program of the State Bauhaus in Weimar) 1919 Walter Gropius (German, 1883–1969), author Lyonel Feininger (American, 1871–1956), illustrator Letterpress and woodcut on paper 850513 Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar (Idea and structure of the State Bauhaus Weimar) Munich: Bauhausverlag, 1923 Walter Gropius (German, 1883–1969), author Letterpress on paper 850513 Bauhaus Seal 1919 Peter Röhl (German, 1890–1975) Relief print From Walter Gropius, Satzungen Staatliches Bauhaus in Weimar (Weimar, January 1921) 850513 Bauhaus Seal Oskar Schlemmer (German, 1888–1943) Lithograph From Walter Gropius, Satzungen Staatliches Bauhaus in Weimar (Weimar, July 1922) 850513 Diagram of the Bauhaus Curriculum Walter Gropius (German, 1883–1969) Lithograph From Walter Gropius, Satzungen Staatliches Bauhaus in Weimar (Weimar, July 1922) 850513 1 The Getty Research Institute 1200 Getty Center Drive, Suite 1100, Los Angeles, CA 90049 www.getty.edu German Expressionism and the Bauhaus Brochure for Arbeitsrat für Kunst Berlin (Workers’ Council for Art Berlin) 1919 Max Pechstein (German, 1881–1955) Woodcut 840131 Sketch of Majolica Cathedral 1920 Hans Poelzig (German, 1869–1936) Colored pencil and crayon on tracing paper 870640 Frühlicht Fall 1921 Bruno Taut (German, 1880–1938), editor Letterpress 84-S222.no1 Hochhaus (Skyscraper) Ludwig Mies van der Rohe (German, 1886–1969) Offset lithograph From Frühlicht, no. 4 (Summer 1922): pp. 122–23 84-S222.no4 Ausstellungsbau in Glas mit Tageslichtkino (Exhibition building in glass with daylight cinema) Bruno Taut (German, 1880–1938) Offset lithographs From Frühlicht, no. 4 (Summer 1922): pp. -

Nachlass Herbert Behrens-Hangeler (1898 - 1981)
Nachlass Herbert Behrens-Hangeler (1898 - 1981) Vorläufiges Findbuch Gliederung 1. Personalia 1.1 Fotos 1.2 Gedichte, Texte 1.3 Kleine Zeichnungen, Aquarelle 2. Schriftwechsel 3. Ausstellungen 3.1 Einzelausstellungen 3.2 Beteiligung an Ausstellungen 3.3 Einzelausstellungen anderer Künstler 3.4 Gemeinschaftsausstellungen anderer Künstler 4. Künstlergemeinschaften / Vereinigungen 4.1 Der Wurf 4.2 Die Kugel 4.3 Novembergruppe 4.4 Der Sturm 4.5 Zenit 4.6 Verschiedene 5. Zeitschriften 6. Franz Richard Behrens 7. Dorothea Behrens 1. Personalia 1.1 Fotos SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 001 Porträt von Herbert Behrens-Hangeler vor Stilleben ["Musikant"]. Im Berliner Atelier. o.J. [20er Jahre] SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 002 Porträt. 1947 Enthält auch: Aufnahme: Rempor-Studio Berlin-Tempelhof SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 003 Porträt. 1947 Enthält auch: Aufnahme: Rempor-Studio Berlin-Tempelhof SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 004 Porträt. o.J. [1951] Enthält auch: Aufnahme von Edmund Kesting SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 005 Porträt. 1962 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 006 Porträt. 1963 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 007 Porträt. 1963 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 008 Hand. 1963 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 009 Porträt. 1965 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 010 Porträt. 1965 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 011 Porträt. 1965 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 012 Porträt. 1965 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 013 Hände am Klavier. 1965/1966 SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 014 Porträt. o.J. [Ende der 60er Jahre] SMB, ZA, IV/NL Behrens-Hangeler 015 Porträt. -
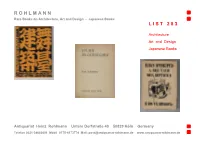
R O H L M a N N L I S T 2
R O H L M A N N Rare Books on Architecture, Art and Design - Japanese Books L I S T 2 8 3 Architecture Art and Design Japanese Books Antiquariat Heinz Rohlmann Untere Dorfstraße 49 50829 Köln Germany Telefon 0221-34666601 Mobil 0175-4173774 Mail: [email protected] www.antiquariat-rohlmann.de 1 ERENBURG (or EHRENBURG), Ilya (Grigorevich). A vse-taki ona vertitsja. [And yet the world goes round]. Moscow and Berlin, Gelikon (1922). 139, (3)pp. and Moscow and 16 photogravures on plates, and line illustrations by F. Léger, and others. 22,5 x 16,5 cm. Original illustrated wrappers (F. Leger). EUR 2400 This rare treatise on contemporary avant-garde art by Ehrenburg (1891-1967) is not only noteworthy for its typographical experiementation, but it defends Contructivism in early art ("Oblozhka raboty Fernanda Lezhe") and includes also a penetrating analysis of the "new architecture" which Vladimir E. Tatlin and his work are seen to have generated. Among the artists the Russian critic considers are Léger, Lipchitz, Lissitzky, Picasso, Rodchenko, Van Doesburg and even from a Charlie Chaplin film. Very fine uncut copy. 2 Kandinsky, Wassily. Kanjinsukî no geijutsuron (カンヂンスキーの芸術論). [Über das Geistige in der Kunst ]. Tokyo, Idea Shoin 1924. 170 leaves: = 110 leaves with printed text; 60 leaves of glossy paper with plates, printed title in Japanese and Western characters on glossy paper, monochrome photographic portrait of Kandinsky. 25,5 x 19,5 cm. Original publisher´s cloth with gilt, original card slipcase. EUR 800 A very scarce edition of Kandinsky's „Uber das Geistige in der Kunst“ published in Japan in 1924. -

Art of Tomorrow : Fifth Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection
A K SOLOMON R. GUGGENHEIM COLLECTION OF y . \ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Solomon R. Guggenheim Museum Library and Archives http://www.archive.org/details/artoftomorrowfif1939gugg ' The theme center of the New York World's Fair owes its inspiration to this creation of Rudolf Bauer, "The Holy One," painted in 1936, exhibited and published in 1937 in the United States of America. ART OF TOMORROW RUDOLF BAUER FIFTH CATALOGUE OF THE SOLOMON R. GUGGENHEIM COLLECTION OF NON-OBJECTIVE PAINTINGS PART OF WHICH IS TEMPORARILY EXHIBITED AT 24 EAST 54 th STREET, NEW YORK CITY st 1 OPENING JUNE , 1939 SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION NEW YORK RUDOLF BAUER, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, "TETRAPTYCHON" Symphony in four movements. THE POWER OF SPIRITUAL RHYTHM A great epoch in art is started by genius who has the power to improve former accom- plishments and the prophecy to state the new ideal. Genius is a special gift of God to the elite of a nation. Great art is always advanced to the understanding of masses. Yet masses indirectly are benefited through the fame for culture which the advance guard of elite brings to them in the increase of their importance as a nation. There are thousands of people interested towards creating the importance of their century. When addressed to them, art is certain of response. In the coming millennium masses will profit by the prophetic cultural achievements of these thousands as courageous, honest, far-seeing creators influence the style of the earth of tomorrow. A highly developed taste, the most refined cultural expression of art can be acquired by anyone who is able to feel beauty. -

LYONEL FEININGER Cover of the Manifesto
LYONEL FEININGER Cover of the manifesto »The01 ultimate aim of all creative Feininger’s Expressionist cathedral has three towers with star-topped spires, from which beams activity is the building,« states of light go out in various directions. The three spires stand for architecture, the arts, and the Walter Gropius’ Bauhaus manifesto. crafts. Naturally, architecture was represented by the central and tallest spire. The primacy He saw building as a social, intel- of architecture was unquestioned, and the study of architecture was to stand at the center of lectual,and symbolic activity, a education. The other arts and crafts were ancillary to it. union of genres and vocations, the But, as so often, there was a world of difference between the vision and the reality, for leveling of differences in status. The though Feininger’s visionary woodcut makes a clear affirmation, the training of architects Gothic cathedral epitomized this. played virtually no part in the early years of the Weimar Bauhaus. In 1923, Gropius was able to mount the International Architectural Exhibition, which he had put together in the context of the Bauhaus exhibition—the first presentation of modern architecture in the 1920s—but the setting up of the study of architecture as a Bauhaus training program did not take place until the Bauhaus moved to Dessau. Two versions: one goal Even before Lyonel Feininger became the first teacher to be appointed by Walter Gropius, in the spring of 1919, and to begin his activity at the newly founded Bauhaus, he was given the 1871 Born in New York on July 17 task of supplying a programmatic illustration for the Bauhaus manifesto. -

Press Release
NEWS FROM THE GETTY news.getty.edu | [email protected] DATE: March 20, 2019 MEDIA CONTACT: FOR IMMEDIATE RELEASE Amy Hood Getty Communications (310) 440-6427 [email protected] GETTY RESEARCH INSTITUTE PRESENTS BAUHAUS BEGINNINGS Marking the 100th anniversary of the founding of the Bauhaus school, the exhibition explores the art, architecture, design, and philosophy of the school’s early years. Accompanied by the online exhibition Bauhaus: Building the New Artist At the Getty Research Institute, Getty Center Los Angeles June 11 – October 13, 2019 Los Angeles – The Bauhaus is widely regarded as the most influential school of art and design of the 20th century. Marking the 100th anniversary of the school’s opening, Bauhaus Beginnings on view at the Getty Research Institute from June 11 through October 13, 2019 examines the founding principles of the landmark institution. “For a century the Bauhaus has widely inspired modern design, architecture and art as well as the ways these disciplines are taught,” said Mary Miller, director of the Getty Research Institute. “However, the Joost Schmidt (German, 1893–1948), Form and Color Study, ca. 1929–1930, watercolor over graphite story of Bauhaus is not just the story of its on paper. Los Angeles, Getty Research Institute, 860972 teachers or most famous students. At the Getty Research Institute our archives are rich in rare prints, drawings, photographs, and other materials from some of the most famous artists to work at Bauhaus as well as students whose work, while lesser known, is extremely compelling and sometimes astonishing. Because of the breadth of our special collections we are able to offer a never-before-seen side of the Bauhaus along with more familiar images.” The J.