AUSSTELLUNGSFÜHRER Saalplan Einleitung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
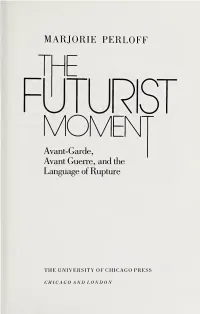
The Futurist Moment : Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture
MARJORIE PERLOFF Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS CHICAGO AND LONDON FUTURIST Marjorie Perloff is professor of English and comparative literature at Stanford University. She is the author of many articles and books, including The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition and The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage. Published with the assistance of the J. Paul Getty Trust Permission to quote from the following sources is gratefully acknowledged: Ezra Pound, Personae. Copyright 1926 by Ezra Pound. Used by permission of New Directions Publishing Corp. Ezra Pound, Collected Early Poems. Copyright 1976 by the Trustees of the Ezra Pound Literary Property Trust. All rights reserved. Used by permission of New Directions Publishing Corp. Ezra Pound, The Cantos of Ezra Pound. Copyright 1934, 1948, 1956 by Ezra Pound. Used by permission of New Directions Publishing Corp. Blaise Cendrars, Selected Writings. Copyright 1962, 1966 by Walter Albert. Used by permission of New Directions Publishing Corp. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 1986 by The University of Chicago All rights reserved. Published 1986 Printed in the United States of America 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 54321 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Perloff, Marjorie. The futurist moment. Bibliography: p. Includes index. 1. Futurism. 2. Arts, Modern—20th century. I. Title. NX600.F8P46 1986 700'. 94 86-3147 ISBN 0-226-65731-0 For DAVID ANTIN CONTENTS List of Illustrations ix Abbreviations xiii Preface xvii 1. -

1 1 December 2009 DRAFT Jonathan Petropoulos Bridges from the Reich: the Importance of Émigré Art Dealers As Reflecte
Working Paper--Draft 1 December 2009 DRAFT Jonathan Petropoulos Bridges from the Reich: The Importance of Émigré Art Dealers as Reflected in the Case Studies Of Curt Valentin and Otto Kallir-Nirenstein Please permit me to begin with some reflections on my own work on art plunderers in the Third Reich. Back in 1995, I wrote an article about Kajetan Mühlmann titled, “The Importance of the Second Rank.” 1 In this article, I argued that while earlier scholars had completed the pioneering work on the major Nazi leaders, it was now the particular task of our generation to examine the careers of the figures who implemented the regime’s criminal policies. I detailed how in the realm of art plundering, many of the Handlanger had evaded meaningful justice, and how Datenschutz and archival laws in Europe and the United States had prevented historians from reaching a true understanding of these second-rank figures: their roles in the looting bureaucracy, their precise operational strategies, and perhaps most interestingly, their complex motivations. While we have made significant progress with this project in the past decade (and the Austrians, in particular deserve great credit for the research and restitution work accomplished since the 1998 Austrian Restitution Law), there is still much that we do not know. Many American museums still keep their curatorial files closed—despite protestations from researchers (myself included)—and there are records in European archives that are still not accessible.2 In light of the recent international conference on Holocaust-era cultural property in Prague and the resulting Terezin Declaration, as well as the Obama Administration’s appointment of Stuart Eizenstat as the point person regarding these issues, I am cautiously optimistic. -
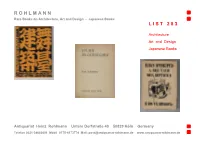
R O H L M a N N L I S T 2
R O H L M A N N Rare Books on Architecture, Art and Design - Japanese Books L I S T 2 8 3 Architecture Art and Design Japanese Books Antiquariat Heinz Rohlmann Untere Dorfstraße 49 50829 Köln Germany Telefon 0221-34666601 Mobil 0175-4173774 Mail: [email protected] www.antiquariat-rohlmann.de 1 ERENBURG (or EHRENBURG), Ilya (Grigorevich). A vse-taki ona vertitsja. [And yet the world goes round]. Moscow and Berlin, Gelikon (1922). 139, (3)pp. and Moscow and 16 photogravures on plates, and line illustrations by F. Léger, and others. 22,5 x 16,5 cm. Original illustrated wrappers (F. Leger). EUR 2400 This rare treatise on contemporary avant-garde art by Ehrenburg (1891-1967) is not only noteworthy for its typographical experiementation, but it defends Contructivism in early art ("Oblozhka raboty Fernanda Lezhe") and includes also a penetrating analysis of the "new architecture" which Vladimir E. Tatlin and his work are seen to have generated. Among the artists the Russian critic considers are Léger, Lipchitz, Lissitzky, Picasso, Rodchenko, Van Doesburg and even from a Charlie Chaplin film. Very fine uncut copy. 2 Kandinsky, Wassily. Kanjinsukî no geijutsuron (カンヂンスキーの芸術論). [Über das Geistige in der Kunst ]. Tokyo, Idea Shoin 1924. 170 leaves: = 110 leaves with printed text; 60 leaves of glossy paper with plates, printed title in Japanese and Western characters on glossy paper, monochrome photographic portrait of Kandinsky. 25,5 x 19,5 cm. Original publisher´s cloth with gilt, original card slipcase. EUR 800 A very scarce edition of Kandinsky's „Uber das Geistige in der Kunst“ published in Japan in 1924. -

Art of Tomorrow : Fifth Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection
A K SOLOMON R. GUGGENHEIM COLLECTION OF y . \ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Solomon R. Guggenheim Museum Library and Archives http://www.archive.org/details/artoftomorrowfif1939gugg ' The theme center of the New York World's Fair owes its inspiration to this creation of Rudolf Bauer, "The Holy One," painted in 1936, exhibited and published in 1937 in the United States of America. ART OF TOMORROW RUDOLF BAUER FIFTH CATALOGUE OF THE SOLOMON R. GUGGENHEIM COLLECTION OF NON-OBJECTIVE PAINTINGS PART OF WHICH IS TEMPORARILY EXHIBITED AT 24 EAST 54 th STREET, NEW YORK CITY st 1 OPENING JUNE , 1939 SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION NEW YORK RUDOLF BAUER, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, "TETRAPTYCHON" Symphony in four movements. THE POWER OF SPIRITUAL RHYTHM A great epoch in art is started by genius who has the power to improve former accom- plishments and the prophecy to state the new ideal. Genius is a special gift of God to the elite of a nation. Great art is always advanced to the understanding of masses. Yet masses indirectly are benefited through the fame for culture which the advance guard of elite brings to them in the increase of their importance as a nation. There are thousands of people interested towards creating the importance of their century. When addressed to them, art is certain of response. In the coming millennium masses will profit by the prophetic cultural achievements of these thousands as courageous, honest, far-seeing creators influence the style of the earth of tomorrow. A highly developed taste, the most refined cultural expression of art can be acquired by anyone who is able to feel beauty. -
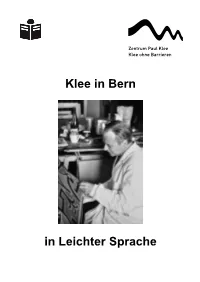
Klee in Bern in Leichter Sprache
Zentrum Paul Klee Klee ohne Barrieren Klee in Bern in Leichter Sprache 2 Um was geht es? Die Stadt Bern hat eine wichtige Rolle im Leben von Paul Klee gespielt. Die Ausstellung „Klee in Bern“ zeigt das auf. Paul Klee ist in Bern aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er hat als junger Künstler in München gelebt. Er hat aber immer wieder Ferien bei seinen Eltern in Bern verbracht. Er hat auch den Kontakt zu seinen Berner Freunden behalten und gepflegt. Kunstsammler in Bern haben von Paul Klee Werke gekauft. Die Ausstellung stellt diese Sammler vor. Paul Klee konnte in Bern auch seine Kunst ausstellen. Paul Klee hat ab 1934 bis zu seinem Tod 1940 wieder in Bern gewohnt. In der Ausstellung kann man sein Atelier besichtigen. Es wurde für die Ausstellung nachgebaut. 3 In der Ausstellung sieht man Werke und Fotos von Paul Klee aus allen Lebensabschnitten: 1) Berner Ansichten 2) Die Familie Klee 3) Eberhard W. Kornfeld: Berner Galerist und Sammler 4) Der Sohn Felix Klee 5) Klees Atelier am Kistlerweg 6) Späte Werke Eingang 4 1 Berner Ansichten Paul Klee kann schon als Kind gut zeichnen. Das hat Paul Klee mit 10 Jahren gemalt. Als Jugendlicher zeichnet er in seine Schulbücher. Er zeichnet auch sein Zimmer. 5 Er zeichnet Landschaften von Kalendern ab. Er zeichnet aber auch in der Natur. Er besucht gerne den Dählhölzli-Wald und die Elfenau. Paul Klee hat diese Landschaft mit 16 Jahren 1895 gemalt. 6 In der Stadt Bern zeichnet er das Münster den Zytglogge-Turm die Altstadt vom Rosengarten aus das Matte-Quartier Er malt auch im Steinbruch von Ostermundigen. -

Acquisitions of the 1930'S and 1940'S : a Selection of Paintings, Watercolors, and Drawings in Tribute to Baroness Hilla
ACQUISITIONS OF THE 1930'S 1940'S THE SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from Solomon R. Guggenheim Museum Library and Archives http://www.archive.org/details/acquisitionsof1900reba A SELECTION OF PAINTINGS, WATERCOLORS AND DRAWINGS IN TRIBUTE TO BARONESS HILLA VON REBAY 1890-1967 ACQUISITIONS OFTHE1930'S AND 1940'S THE SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK Published by The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1 968, All Rights Reserved Library of Congress Card Catalogue Number: 68-25520 Printed in Holland TRUSTEES THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION Harry F. Guggenheim, President Albert E. Thiele, Vice President H. H. Arnason, Vice President, Art Administration Peter O. Lawson-Johnston, Vice President, Business Administration Eleanor, Countess Castle Stewart Henry Allen Moe A. Chauncey Newlin Mrs. Henry Obre Daniel Catton Rich Michael F. Wettach » Medley G. B. Whelpley Carl Zigrosser HILLA REBAY 1890-1967 Baroness Hilla Rebay von Ehrenwiesen was born in 1890 in Strassburg, Alsace, daughter of a German army officer. She studied painting at the Academy in Dusseldorf and in Paris and Munich. From 1914-1920 she exhibited with avant-garde groups in Germany; 1914-15 with the Seces- sion, Munich; 1914 Salon des Independants, Paris; 1915 Secession, Berlin; 1918 November Gruppe, Berlin; 1920 became a member of 'Krater'. In 1917 she exhibited at Der Sturm Gallery in Berlin. It is probable that it was through Herwarth Walden that she became acquainted with the other artists who exhibited in his gallery: Delaunay, Gleizes, Leger, Chagall, Kandinsky, Marc, Klee and Bauer — artists whose work she was later to acquire for the Foundation. -

In Memory of Wassily Kandinsky : the Solomon R
r Y !ClC"C" R. GUBGSHHKB M'!SEUM THE L'^ ; Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Solomon R. Guggenheim Museum Library and Archives http://www.archive.org/details/inmemoryofwassilOOreba WASSILY KANDINSKY MEMORIAL BLACK LINES 1913 IN MEMORY OF WASSILY KANDINSKY THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION PRESENTS A SURVEY OF THE ARTIST'S PAINTINGS AND WRITINGS ARRANGED AND EDITED BY HILLA REBAY, DIRECTOR OF THE MUSEUM OF NON-OBJECTIVE PAINTINGS, LOCATED TEMPORARILY AT 24 EAST 54TH STREET, LATER FIFTH AVENUE AND 89TH STREET, NEW YORK CITY THIS EXHIBITION WILL BE OPEN TO THE PUBLIC MARCH 15TH TO MAY 15TH, 1945 DAILY FROM 10 TO 6 EXCEPT MONDAYS SUNDAYS 12 TO 6 ENTRANCE FREE WASSILY KANDINSKY 1866-1944 . • .*. z I z o I uI— < j °s I 5 z S I— < z o uI— < CO < z O t-< to > O z O < > O LITTLE PLEASURES 1913 PICTURE WITH THREE SPOTS 1913 _LL 00 \ % NN. / 1? m « y Q_ X O 12 o x 13 ::"~:;:--:-;:::-^'.!tk&&.-: CARNIVAL 1914 14 SOUVENIR 1914 15 IMPROVISATION 1915 16 DEUX ROUGES 1916 17 K < 18 oo Z O > z < 19 1919 LYRICAL NO. 4 20 m^j 1920 RED WITH BLACK 1920 21 Z ULU X ' : ::: V-:&-: :-:*:!i : i:" 22 i^^^^m u u O u I- D_» 5 23 1922 BLUE CIRCLE 24 SOLIDITY 1922 25 CO CN O- Z o CO O Q- o u 26 o ' o 27 &•, 1923 CIRCLES IN CIRCLE 28 BEIGE GRAY 1924 29 LIGHT UNITY 1925 30 CALM 1926 31 / ^J^sSjP'-- r ' .-Jp\ J \ - jM t m No. -
Einladungsflyer Als
Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnung am Freitag, 18. Oktober 2019, um 19 Uhr Studioausstellung: Öffnungszeiten »Bekenntnis zum Gegenstand« Dienstag, Mittwoch, Freitag 14 –18 Uhr Linolschnitte von Karl Rössing Donnerstag 14 –20 Uhr und seinen Schülern Robert Samstag und Sonntag 11–18 Uhr Förch und Malte Sartorius 1. November, 26. Dezember sowie bis 16. Februar 2020 1. und 6. Januar jeweils 11–18 Uhr 24., 25. und 31. Dezember geschlossen Im historischen Gebäudeteil zeigt die Städtische Galerie aus der Eintritt frei! eigenen Sammlung Linolschnitte von drei herausragenden Öffentliche Führung: 3 € Druckgrafikern: Der Stuttgarter After-Work-Führung: 3 € Akademie-Professor Karl Rössing Führung mit Rezitation: 5 € (1897–1987) gab seine Leiden- Künstlergespräch: 5 € schaft für den Linolschnitt u.a. an Familien-Fun-Freitag: 5 € pro Familie Öffentliche Führungen Workshops für Kinder Robert Förch (*1931) und Malte Workshop: 5 € pro Tag Sonntag, 27. Oktober, 16.30 Uhr und Jugendliche Otto© Nebel-Stiftung,Bern · Fotos: MyriamBern Weber, Sartorius (1933 –2017) weiter. Die Gruppenführung: 55 € / 65 € Sonntag, 10. November, 11.30 Uhr im Sommer eröffnete Ausstellung Abstrakte Stoffcollagen Führungen für Gruppen und Sonntag, 24. November, 16.30 Uhr ist nun um weitere 25 Exponate Samstag, 19. Oktober Schulklassen (auch außerhalb der Sonntag, 15. Dezember, 11.30 Uhr und auf das zweite Geschoss 11–14 Uhr (6 –10 J.) Öffnungszeiten) nach telefonischer Dreikönigstag, 6. Januar, 16.30 Uhr erweitert – entdecken Sie einmal 14.30 –17.30 Uhr (8 –12 J.) Vereinbarung. Sonntag, 19. Januar, 11.30 Uhr mehr sowohl Ähnlichkeiten als Farben des Herbstes auch die jeweils ganz eigenstän- Führung für Lehrkräfte Katalog (Kunstmuseum Bern 2012) Herbstferienworkshop: dige Entwicklung dieser drei Montag, 21. -

1 Otto Nebel Einführung in Archiv Und Poetik Präsentation Literaturfest, 25
Otto Nebel Einführung in Archiv und Poetik Präsentation Literaturfest, 25. August 2010 BETTINA BRAUN 1. Sprache als Material Sehr geehrte Damen und Herren, in seinem Nachruf auf Otto Nebel schreibt Jörg Drews: „Als Dichter gehört Nebel mit Schwitters und den Dadaisten zu den grossen Ahnen der literarischen Avantgarde; die experimentelle Literatur [...] ist ohne ihn nicht denkbar [...].“ Was Nebel mit der Wiener Gruppe, der Konkreten Poesie und anderen literarischen Strömungen der 50er und 60er Jahre verbindet, und auch dazu geführt hat, dass sein Werk in dieser Zeit entdeckt wurde, ist die Auffassung der Sprache als Material. Ich möchte Ihnen Dokumente aus seinem Nachlass vorstellen, die zeigen, wie Nebel mit und an der Sprache gearbeitet hat und welche Auffassung von Literatur er mit dieser Spracharbeit verband. (Abb.) Sein literarisches Debüt, den Antikriegstext Zuginsfeld, – einen Auszug haben wir gehört – verfasste der 25-Jährige 1919 in der 14monatigen englischen Kriegsgefangenschaft. Bereits hier beschreibt Nebel weder die eigene Kriegserfahrung noch dachte er sich eine anklagende Handlung aus wie dies in so vielen Romanen der Zeit geschieht. Anstelle dessen baute er aus dem sprachlichen Material des attackierten Milieus, in erster Linie des wilhelminischen Militarismus, eine Collage zusammen. Die Befehle, Parolen, Redensarten Volkslieder und so weiter werden zitiert, auseinandergenommen, verballhornt und neu zusammengesetzt. Sein Verfahren ist dasjenige des entlarvenden Zitats. „Das inhumane Porträt einer Gesellschaft erschliesst sich durch das bewusste Vorzeigen ihrer Wörter“, schreibt Klaus Völker zum Zuginsfeld. (Abb.) Die 50 Illustrationen zum Text setzen dies auch bildlich um. Sie sehen hier einen weiteren Entwurf aus Nebels Tagebuch. (Abb. 3) Den Zuginsfeld trug Nebel in den 1920er Jahren zusammen mit Rudolf Blümner in Berlin und weiteren Städten Deutschlands vor grossem Publikum vor. -

Gertrud Grunow Biografie
Linn Burchert Gertrud Grunow (1870 –1944) Leben, Werk und Wirken am Bauhaus und darüber hinaus Impressum Autorin © Linn Burchert, 2018 Gestaltung Bodendörfer | Kellow Angaben zur Autorin Linn Burchert ist seit 2018 Mitarbeiterin am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität Berlin. Nach ihrem Studium der Kulturwissenschaft und Vergleichenden Literatur- und Kunstwissenschaft in Potsdam (2008–2014) assistierte sie am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (2014–1017). 2018 schloss sie ihre Dissertation „Das Bild als Lebensraum. Ökologische Wirkungskonzepte in der abstrakten Kunst, 1910–1960“ ab. Forschungsschwerpunkte sind: Beziehungen von Kunst-, Ideen- und Wissen- schaftsgeschichte sowie Naturkonzepte in der Kunst von 1750 bis in die Gegenwart. Gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei Linn Burchert Gertrud Grunow (1870 –1944) Leben, Werk und Wirken am Bauhaus und darüber hinaus Inhaltsverzeichnis Vorbemerkungen und Danksagungen ...............................8 Gertrud Grunow: Leben, Lehre, Forschung ....................11 Biographie ........................................................................................................... 14 Grunows Lehre kurz zusammengefasst ............................................................... 17 Lehrsystem und Übungspraxis ............................................................................ 19 Die drei Ordnungen des Kreises ......................................................................... 27 Grunow am Bauhaus, 1919 –1924 -

Guggenheim Museum Archives Reel-To-Reel Collection Five Letters from Rudolf Bauer to Hilla Rebay
Guggenheim Museum Archives Reel-to-Reel collection Five Letters from Rudolf Bauer to Hilla Rebay MRS. SCHOEKOPF [00:00] Dear Hilla. Of course, to be in time for the World’s Fair does not leave much time for such a building. But with the American know-how, one should be able to manage, provided I can plan as I please. As long as the [territoran?] is cut up like Rockefeller Center, we run into the greatest obstacle. In that case, one would have to design a whole new building plan, that can, of course, never be as good as one for the large site. Before a plan can be drawn here, one would have to know the exact dimensions of the building site. Till (inaudible) time, any design is pointless. As I told [Kiefler?], when he spoke to me about the Rockefeller project, I am totally against the idea of a skyscraper for a museum. They don’t even have to start something like that. The reasons were all given. One of the disturbing elements are the stairs. But that might be eliminated, even in a skyscraper, provided it is not too high, because otherwise [01:00] the building code won’t permit it, on account of the fire hazard, which one could eliminate from the beginning. In place of the staircase, I would propose a dumbwaiter type elevator, which will run continuously and will appear, upon entering it, like a small room, so that the viewer, when he enters this elevator from the last exhibition hall, automatically reaches the next floor. -

KLEE and Kandinsky
KLEE & KANDINSKY 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 1 15.05.15 09:01 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 2 15.05.15 09:01 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 3 15.05.15 09:01 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 4 15.05.15 09:01 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 5 15.05.15 09:01 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 6 15.05.15 09:01 KLEE & KANDINSKY NEIGHBORS FRIENDS RIVALS EDITED BY MICHAEL BAUMGARTNER ANNEGRET HOBERG CHRISTINE HOPFENGART WITH CONTRIBUTIONS BY VIVIAN ENDICOTT BARNETT, MICHAEL BAUMGARTNER, MONIKA BAYER-WERMUTH, KAI-INGA DOST, FABIENNE EGGELHÖFER, CHARLES WERNER HAXTHAUSEN, ANNEGRET HOBERG, CHRISTINE HOPFENGART, WOLFGANG THÖNER, PETER VERGO, ANGELIKA WEISSBACH LENBACHHAUS PRESTEL MÜNCHEN MUNICH | LONDON | NEW YORK 5479_5480_s001-360_klee_kand.indd 7 15.05.15 09:01 CONTENTS FOREWORD ESSAYS 10 PETER FISCHER, MATTHIAS MÜHLING 256 “TO MY DEAR FRIEND OF MANY YEARS”— KLEE AND KANDINSKY’S WORKS ON PAPER, 1911–1937 CHRONOLOGY VIVIAN ENDICOTT BARNETT 12 CHRISTINE HOPFENGART 268 PAUL KLEE’S NATURE COSMOLOGY— STRUCTURAL ANALYSIS AND INTRODUCTION IMAGINARY MORPHOLOGY 34 KLEE AND KANDINSKY— MICHAEL BAUMGARTNER GOOD NEIGHBORS CHRISTINE HOPFENGART 280 KANDINSKY—THE “NATURAL WORLD” AND A NEW “ARTIFICIAL WORLD” ANNEGRET HOBERG 292 KLEE, KANDINSKY, AND MUSIC CATALOGUE PETER VERGO 58 –255 WITH TEXTS BY VIVIAN ENDICOTT BARNETT, 302 “FORCES MOVING IN DIFFERENT MICHAEL BAUMGARTNER, DIRECTIONS” —PAUL KLEE AND MONIKA BAYER-WERMUTH, WASSILY KANDINSKY IN THE ENSEMBLE KAI-INGA DOST, ANNEGRET HOBERG, OF PAINTERS AT THE BAUHAUS CHRISTINE HOPFENGART WOLFGANG