Die Spinnenfauna Des Göttinger Waldes (Arachnida: Araneida)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
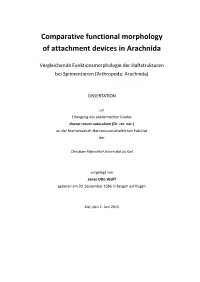
Comparative Functional Morphology of Attachment Devices in Arachnida
Comparative functional morphology of attachment devices in Arachnida Vergleichende Funktionsmorphologie der Haftstrukturen bei Spinnentieren (Arthropoda: Arachnida) DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Jonas Otto Wolff geboren am 20. September 1986 in Bergen auf Rügen Kiel, den 2. Juni 2015 Erster Gutachter: Prof. Stanislav N. Gorb _ Zweiter Gutachter: Dr. Dirk Brandis _ Tag der mündlichen Prüfung: 17. Juli 2015 _ Zum Druck genehmigt: 17. Juli 2015 _ gez. Prof. Dr. Wolfgang J. Duschl, Dekan Acknowledgements I owe Prof. Stanislav Gorb a great debt of gratitude. He taught me all skills to get a researcher and gave me all freedom to follow my ideas. I am very thankful for the opportunity to work in an active, fruitful and friendly research environment, with an interdisciplinary team and excellent laboratory equipment. I like to express my gratitude to Esther Appel, Joachim Oesert and Dr. Jan Michels for their kind and enthusiastic support on microscopy techniques. I thank Dr. Thomas Kleinteich and Dr. Jana Willkommen for their guidance on the µCt. For the fruitful discussions and numerous information on physical questions I like to thank Dr. Lars Heepe. I thank Dr. Clemens Schaber for his collaboration and great ideas on how to measure the adhesive forces of the tiny glue droplets of harvestmen. I thank Angela Veenendaal and Bettina Sattler for their kind help on administration issues. Especially I thank my students Ingo Grawe, Fabienne Frost, Marina Wirth and André Karstedt for their commitment and input of ideas. -

Hohestein – Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 2
Naturw.res.07-A4:Layout 1 09.11.2007 13:10 Uhr Seite 1 HESSEN Hessisches Ministerium für Umwelt, HESSEN ländlichen Raum und Verbraucherschutz Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz www.hmulv.hessen.de Naturwaldreservate in Hessen HOHESTEINHOHESTEIN ZOOLOGISCHEZOOLOGISCHE UNTERSUCHUNGENUNTERSUCHUNGEN Zoologische Untersuchungen – Naturwaldreservate in Hessen Naturwaldreservate Hohestein NO OO 7/2.2 NN 7/2.27/2.2 Naturwaldreservate in Hessen 7/2.2 Hohestein Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 2 Wolfgang H. O. Dorow Jens-Peter Kopelke mit Beiträgen von Andreas Malten & Theo Blick (Araneae) Pavel Lauterer (Psylloidea) Frank Köhler & Günter Flechtner (Coleoptera) Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 42 Impressum Herausgeber: Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Mainzer Str. 80 65189 Wiesbaden Landesbetrieb Hessen-Forst Bertha-von-Suttner-Str. 3 34131 Kassel Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Grätzelstr. 2 37079 Göttingen http://www.nw-fva.de Dieser Band wurde in wissenschaftlicher Kooperation mit dem Forschungsinstitut Senckenberg erstellt. – Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 42 – Titelfoto: Der Schnellkäfer Denticollis rubens wurde im Naturwaldreservat „Hohestein“ nur selten gefunden. Die stark gefährdete Art entwickelt sich in feuchtem, stärker verrottetem Buchenholz. (Foto: Frank Köhler) Layout: Eva Feltkamp, 60486 Frankfurt Druck: Elektra Reprographischer Betrieb GmbH, 65527 Niedernhausen Umschlaggestaltung: studio -

Distribution of Spiders in Coastal Grey Dunes
kaft_def 7/8/04 11:22 AM Pagina 1 SPATIAL PATTERNS AND EVOLUTIONARY D ISTRIBUTION OF SPIDERS IN COASTAL GREY DUNES Distribution of spiders in coastal grey dunes SPATIAL PATTERNS AND EVOLUTIONARY- ECOLOGICAL IMPORTANCE OF DISPERSAL - ECOLOGICAL IMPORTANCE OF DISPERSAL Dries Bonte Dispersal is crucial in structuring species distribution, population structure and species ranges at large geographical scales or within local patchily distributed populations. The knowledge of dispersal evolution, motivation, its effect on metapopulation dynamics and species distribution at multiple scales is poorly understood and many questions remain unsolved or require empirical verification. In this thesis we contribute to the knowledge of dispersal, by studying both ecological and evolutionary aspects of spider dispersal in fragmented grey dunes. Studies were performed at the individual, population and assemblage level and indicate that behavioural traits narrowly linked to dispersal, con- siderably show [adaptive] variation in function of habitat quality and geometry. Dispersal also determines spider distribution patterns and metapopulation dynamics. Consequently, our results stress the need to integrate knowledge on behavioural ecology within the study of ecological landscapes. / Promotor: Prof. Dr. Eckhart Kuijken [Ghent University & Institute of Nature Dries Bonte Conservation] Co-promotor: Prf. Dr. Jean-Pierre Maelfait [Ghent University & Institute of Nature Conservation] and Prof. Dr. Luc lens [Ghent University] Date of public defence: 6 February 2004 [Ghent University] Universiteit Gent Faculteit Wetenschappen Academiejaar 2003-2004 Distribution of spiders in coastal grey dunes: spatial patterns and evolutionary-ecological importance of dispersal Verspreiding van spinnen in grijze kustduinen: ruimtelijke patronen en evolutionair-ecologisch belang van dispersie door Dries Bonte Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor [Ph.D.] in Sciences Proefschrift voorgedragen tot het bekomen van de graad van Doctor in de Wetenschappen Promotor: Prof. -

Westring, 1871) (Schorsmuisspin) JANSSEN & CREVECOEUR (2008) Citeerden Deze Soort Voor Het Eerst in België
Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. (2009),24(1-3): 1 Jean-Pierre Maelfait 1 juni 1951 – 6 februari 2009 Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. (2009),24(1-3): 2 In memoriam JEAN-PIERRE MAELFAIT Kortrijk 01/06/1951 Gent 06/02/2009 Jean-Pierre Maelfait is ons ontvallen op 6 februari van dit jaar. We brengen hulde aan een man die veel gegeven heeft voor de arachnologie in het algemeen en meer specifiek voor onze vereniging. Jean-Pierre is altijd een belangrijke pion geweest in het bestaan van ARABEL. Hij was medestichter van de “Werkgroep ARABEL” in 1976 en op zijn aanraden werd gestart met het publiceren van de “Nieuwsbrief” in 1986, het jaar waarin ook ARABEL een officiële vzw werd. Hij is eindredacteur van de “Nieuwsbrief” geweest van 1990 tot en met 2002. Sinds het ontstaan van onze vereniging is Jean-Pierre achtereenvolgens penningmeester geweest van 1986 tot en met 1989, ondervoorzitter van 1990 tot en met 1995 om uiteindelijk voorzitter te worden van 1996 tot en met 1999. Pas in 2003 gaf hij zijn fakkel als bestuurslid over aan de “jeugd”. Dit afscheid is des te erger omdat Jean- Pierre er na 6 jaar afwezigheid terug een lap ging op geven, door opnieuw bestuurslid te worden in 2009 en aldus verkozen werd als Secretaris. Alle artikels in dit nummer opgenomen worden naar hem opgedragen. Jean-Pierre Maelfait nous a quitté le 6 février de cette année. Nous rendons hommage à un homme qui a beaucoup donné dans sa vie pour l’arachnologie en général et plus particulièrement pour Arabel. Jean-Pierre a toujours été un pion important dans la vie de notre Société. -

196 Arachnology (2019)18 (3), 196–212 a Revised Checklist of the Spiders of Great Britain Methods and Ireland Selection Criteria and Lists
196 Arachnology (2019)18 (3), 196–212 A revised checklist of the spiders of Great Britain Methods and Ireland Selection criteria and lists Alastair Lavery The checklist has two main sections; List A contains all Burach, Carnbo, species proved or suspected to be established and List B Kinross, KY13 0NX species recorded only in specific circumstances. email: [email protected] The criterion for inclusion in list A is evidence that self- sustaining populations of the species are established within Great Britain and Ireland. This is taken to include records Abstract from the same site over a number of years or from a number A revised checklist of spider species found in Great Britain and of sites. Species not recorded after 1919, one hundred years Ireland is presented together with their national distributions, before the publication of this list, are not included, though national and international conservation statuses and syn- this has not been applied strictly for Irish species because of onymies. The list allows users to access the sources most often substantially lower recording levels. used in studying spiders on the archipelago. The list does not differentiate between species naturally Keywords: Araneae • Europe occurring and those that have established with human assis- tance; in practice this can be very difficult to determine. Introduction List A: species established in natural or semi-natural A checklist can have multiple purposes. Its primary pur- habitats pose is to provide an up-to-date list of the species found in the geographical area and, as in this case, to major divisions The main species list, List A1, includes all species found within that area. -

Diversity of Common Garden and House Spider in Tinsukia District, Assam Has Been Undertaken
Journal of Entomology and Zoology Studies 2019; 7(4): 1432-1439 E-ISSN: 2320-7078 P-ISSN: 2349-6800 Diversity of common garden and house spider in JEZS 2019; 7(4): 1432-1439 © 2019 JEZS Tinsukia district Received: 01-05-2019 Accepted: 05-06-2019 Achal Kumari Pandit Achal Kumari Pandit Graduated from Department of Zoology Digboi College, Assam, Abstract India A study on the diversity of spider fauna inside the Garden and House in Tinsukia district, Assam. This was studied from September 2015 to July 2019. A total of 18 family, 52 genus and 80 species were recorded. Araneidae is the most dominant family among all followed by the silicide family. The main aim of this study is to bring to known the species which is generally observed by the humans in this area. Beside seasonal variation in species is higher in summer season as compared to winter. Also many species were observed each year in same season repeatedly during the study period, further maximum number of species is seen in vegetation type of habitat. Keywords: Spider, diversity, Tinsukia, seasonal, habitat 1. Introduction As one of the most widely recognized group of Arthropods, Spiders are widespread in distribution except for a few niches, such as Arctic and Antarctic. Almost every plant has its spider fauna, as do dead leaves, on the forest floor and on the trees. They may be found at varied locations, such as under bark, beneath stones, below the fallen logs, among foliage, [23] house dwellings, grass, leaves, underground, burrows etc. (Pai IK., 2018) . Their success is reflected by the fact that, on our planet, there are about 48,358 species recorded till now according to World Spider Catalog. -

Assessing Spider Species Richness and Composition in Mediterranean Cork Oak Forests
acta oecologica 33 (2008) 114–127 available at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/actoec Original article Assessing spider species richness and composition in Mediterranean cork oak forests Pedro Cardosoa,b,c,*, Clara Gasparc,d, Luis C. Pereirae, Israel Silvab, Se´rgio S. Henriquese, Ricardo R. da Silvae, Pedro Sousaf aNatural History Museum of Denmark, Zoological Museum and Centre for Macroecology, University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen, Denmark bCentre of Environmental Biology, Faculty of Sciences, University of Lisbon, Rua Ernesto de Vasconcelos Ed. C2, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal cAgricultural Sciences Department – CITA-A, University of Azores, Terra-Cha˜, 9701-851 Angra do Heroı´smo, Portugal dBiodiversity and Macroecology Group, Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, UK eDepartment of Biology, University of E´vora, Nu´cleo da Mitra, 7002-554 E´vora, Portugal fCIBIO, Research Centre on Biodiversity and Genetic Resources, University of Oporto, Campus Agra´rio de Vaira˜o, 4485-661 Vaira˜o, Portugal article info abstract Article history: Semi-quantitative sampling protocols have been proposed as the most cost-effective and Received 8 January 2007 comprehensive way of sampling spiders in many regions of the world. In the present study, Accepted 3 October 2007 a balanced sampling design with the same number of samples per day, time of day, collec- Published online 19 November 2007 tor and method, was used to assess the species richness and composition of a Quercus suber woodland in Central Portugal. A total of 475 samples, each corresponding to one hour of Keywords: effective fieldwork, were taken. -

Arachnologische Arachnology
Arachnologische Gesellschaft E u Arachnology 2015 o 24.-28.8.2015 Brno, p Czech Republic e www.european-arachnology.org a n Arachnologische Mitteilungen Arachnology Letters Heft / Volume 51 Karlsruhe, April 2016 ISSN 1018-4171 (Druck), 2199-7233 (Online) www.AraGes.de/aramit Arachnologische Mitteilungen veröffentlichen Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Taxonomie von Spinnentieren (außer Acari). Publi- ziert werden Artikel in Deutsch oder Englisch nach Begutachtung, online und gedruckt. Mitgliedschaft in der Arachnologischen Gesellschaft beinhaltet den Bezug der Hefte. Autoren zahlen keine Druckgebühren. Inhalte werden unter der freien internationalen Lizenz Creative Commons 4.0 veröffentlicht. Arachnology Logo: P. Jäger, K. Rehbinder Letters Publiziert von / Published by is a peer-reviewed, open-access, online and print, rapidly produced journal focusing on faunistics, ecology Arachnologische and taxonomy of Arachnida (excl. Acari). German and English manuscripts are equally welcome. Members Gesellschaft e.V. of Arachnologische Gesellschaft receive the printed issues. There are no page charges. URL: http://www.AraGes.de Arachnology Letters is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Autorenhinweise / Author guidelines www.AraGes.de/aramit/ Schriftleitung / Editors Theo Blick, Senckenberg Research Institute, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt/M. and Callistus, Gemeinschaft für Zoologische & Ökologische Untersuchungen, D-95503 Hummeltal; E-Mail: [email protected], [email protected] Sascha -
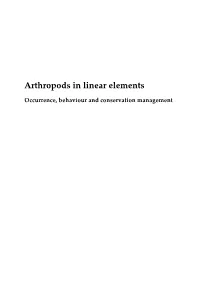
Arthropods in Linear Elements
Arthropods in linear elements Occurrence, behaviour and conservation management Thesis committee Thesis supervisor: Prof. dr. Karlè V. Sýkora Professor of Ecological Construction and Management of Infrastructure Nature Conservation and Plant Ecology Group Wageningen University Thesis co‐supervisor: Dr. ir. André P. Schaffers Scientific researcher Nature Conservation and Plant Ecology Group Wageningen University Other members: Prof. dr. Dries Bonte Ghent University, Belgium Prof. dr. Hans Van Dyck Université catholique de Louvain, Belgium Prof. dr. Paul F.M. Opdam Wageningen University Prof. dr. Menno Schilthuizen University of Groningen This research was conducted under the auspices of SENSE (School for the Socio‐Economic and Natural Sciences of the Environment) Arthropods in linear elements Occurrence, behaviour and conservation management Jinze Noordijk Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor at Wageningen University by the authority of the Rector Magnificus Prof. dr. M.J. Kropff, in the presence of the Thesis Committee appointed by the Doctorate Board to be defended in public on Tuesday 3 November 2009 at 1.30 PM in the Aula Noordijk J (2009) Arthropods in linear elements – occurrence, behaviour and conservation management Thesis, Wageningen University, Wageningen NL with references, with summaries in English and Dutch ISBN 978‐90‐8585‐492‐0 C’est une prairie au petit jour, quelque part sur la Terre. Caché sous cette prairie s’étend un monde démesuré, grand comme une planète. Les herbes folles s’y transforment en jungles impénétrables, les cailloux deviennent montagnes et le plus modeste trou d’eau prend les dimensions d’un océan. Nuridsany C & Pérennou M 1996. -

Goldbachs- Und Ziebachsrück – Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 1 Dorow, W
Natwres-11-2.1:Layout 1 13.11.08 15:18 Seite 1 HESSEN Hessisches Ministerium für Umwelt, HESSEN ländlichen Raum und Verbraucherschutz Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz www.hmulv.hessen.de Naturwaldreservate in Hessen GOLDBACHS-GOLDBACHS- UNDUND ZIEBACHSRÜCKZIEBACHSRÜCK ZOOLOGISCHEZOOLOGISCHE UNTERSUCHUNGENUNTERSUCHUNGEN Naturwaldreservate in Hessen Naturwaldreservate Goldbachs- und Ziebachsrück – Zoologische Untersuchungen NO OO 11/2.1 NN 11/2.111/2.1 Naturwaldreservate in Hessen 11/2.1 Goldbachs- und Ziebachsrück Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 1 Wolfgang H. O. Dorow Theo Blick Jens-Peter Kopelke mit Beiträgen von Beate Löb, Sabine Kiefer & Michael Hoffmann (Aves) Jörg Römbke (Lumbricidae) Petra M. T. Zub (Lepidoptera) Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 45 2009 Impressum Herausgeber: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Mainzer Str. 80 65189 Wiesbaden Landesbetrieb Hessen-Forst Bertha-von-Suttner-Str. 3 34131 Kassel Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Grätzelstr. 2 37079 Göttingen http://www.nw-fva.de Dieser Band wurde in wissenschaftlicher Kooperation mit dem Forschungsinstitut Senckenberg erstellt. http://www.senckenberg.de – Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 45 – Titelfoto: Die häufige Krabbenspinne Diaea dorsata (FABRICIUS, 1777) lebt bevorzugt an Stämmen und auf Ästen von Laubbäumen. (Foto: Jürgen Fischer, Wunsiedel) Layout: Eva Feltkamp, 60486 Frankfurt Druck: Elektra Reprographischer Betrieb GmbH, 65527 Niedernhausen Umschlaggestaltung: studio zerzawy agd, 65329 Hohenstein Wiesbaden, April 2009 ISBN 978-3-89274-285-2 ISSN 0341-3845 Zitiervorschlag: DOROW, W. H. O.; BLICK, T. & KOPELKE, J.-P. 2009. Naturwaldreservate in Hessen. Band 11/2.1. Goldbachs- und Ziebachsrück. Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 1. Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung 45: 1-326. Inhaltsverzeichnis Band 11/2.1 DOROW, W. -

Ekologie Pavouků a Sekáčů Na Specifických Biotopech V Lesích
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích Ondřej Machač DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE Školitel: doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. Olomouc 2021 Prohlašuji, že jsem doktorskou práci sepsal sám s využitím mých vlastních či spoluautorských výsledků. ………………………………… © Ondřej Machač, 2021 Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích s[doktorská di ertační práce]. Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc, 35 s., v češtině. ABSTRAKT Pavoukovci jsou ekologicky velmi různorodou skupinou, obývají téměř všechny biotopy a často jsou specializovaní na specifický biotop nebo dokonce mikrobiotop. Mezi specifické biotopy patří také kmeny a dutiny stromů, ptačí budky a biotopy ovlivněné hnízděním kormoránů. Ve své dizertační práci jsem se zabýval ekologií společenstev pavouků a sekáčů na těchto specifických biotopech. V první studii jsme se zabývali společenstvy pavouků a sekáčů na kmenech stromů na dvou odlišných biotopech, v lužním lese a v městské zeleni. Zabývali jsme se také jednotlivými společenstvy na kmenech různých druhů stromů a srovnáním tří jednoduchých sběrných metod – upravené padací pasti, lepového a kartonového pásu. Ve druhé studii jsme se zabývali arachnofaunou dutin starých dubů za pomocí dvou sběrných metod (padací past v dutině a nárazová past u otvoru dutiny) na stromech v lužním lese a solitérních stromech na loukách a také srovnáním společenstev v dutinách na živých a odumřelých stromech. Ve třetí studii jsme se zabývali společenstvem pavouků zimujících v ptačích budkách v nížinném lužním lese a vlivem vybraných faktorů prostředí na jejich početnosti. Zabývali jsme se také znovuosídlováním ptačích budek pavouky v průběhu zimy v závislosti na teplotě a vlivem hnízdního materiálu v budce na početnosti a druhové spektrum pavouků. -

Arachnologische Mitteilungen
Arachnologische Mitteilungen E u Arachnology 2012 o 2.9.-7.9.2012 Ljubljana, Slovenia p www.european-arachnology.org e a n Heft 45 Karlsruhe, Juni 2013 ISSN 1018 - 4171 www.AraGes.de/aramit Herausgeber: Arachnologische Gesellschaft e.V. Arachnologische URL: http://www.AraGes.de Mitteilungen Schriftleitung: Theo Blick, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Terrestrische Zoologie, Projekt Hessische Naturwaldreservate, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt/M., E-Mail: [email protected], [email protected] Dr. Sascha Buchholz, Technische Universität Berlin, Institut für Ökologie, Rothenburgstr. 12, D-12165 Berlin, E-Mail: [email protected] Gast-Editor für Artikel 2 - 4: Dr. Matjaž Kuntner, University of Ljubljana, Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Novi trg 2, P. O. Box 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia, E-Mail: [email protected] Redaktion: Theo Blick, Frankfurt Dr. Sascha Buchholz, Berlin Dr. Jason Dunlop, Berlin Dr. Ambros Hänggi, Basel Dr. Hubert Höfer & Stefan Scharf, Karlsruhe (Satz und Repro, E-Mail: [email protected]) Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Elisabeth Bauchhenß, Wien (A) Dr. Christian Komposch, Graz (A) Dr. Peter Bliss, Halle (D) Dr. Volker Mahnert, Douvaine (F) Prof. Dr. Jan Buchar, Prag (CZ) Prof. Dr. Jochen Martens, Mainz (D) Dr. Oliver-David Finch, Rastede (D) Dr. Dieter Martin, Waren (D) Prof. Peter J. van Helsdingen, Leiden (NL) Dr. Uwe Riecken, Bonn (D) Dr. Peter Jäger, Frankfurt/M. (D) Prof. Dr. Wojciech Staręga, Warszawa (PL) Erscheinungsweise: Pro Jahr 2 Hefte. Die Hefte sind laufend durchnummeriert und jeweils abgeschlossen paginiert. Der Umfang je Heft beträgt ca. 50 Seiten. Erscheinungsort ist Karlsruhe.