Supplementary Appendix
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Spender Und Sponsoren Des Schiffbaues 2001-2007
Spender und Sponsoren des Schiffbaues 2001-2007 In dieser Liste sind die Spender und Sponsoren aufgelistet, die den Bau des ersten behinderten- und rollstuhlfahrergerechten Großseglers in Deutschland unterschützt haben. Für die Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Projekt dankt der Verein allen Spendern und Sponsoren. Monat/ Name / Firma Art der Spende Bemerkungen Jahr 12.01. Dr. Georg Maraun Geldspende 70. Geburtstag 02.02. Jürgen Vieth Geldspende 12.02. Dr. Georg Maraun Geldspende 07.02. Karin Leven Geldspende 11.02. HAFF TRANS GmbH Geldspende 11.02. Dr. Arnim Beduhn Geldspende 60. Geburtstag 04.03. MF Ingenieurbüro für Yacht- Sachspende Beratungsleistung und Bootsbau Michail Freitag 05.03. Stadt Ueckermünde Sachspende Ankauf des Schiffskaskos 05.03. Stadt Ueckermünde Sachspende Liegeplatz im Stadthafen 05.03. Sparkasse Uecker -Randow GeldspendeSachs GeldspendeSachs pende pende / Flyerdruck 06.03. HAFF TRANS GmbH Sachspende Beschaffung der Ueckermünde Schiffszeichnunge n 07.03. Oderhaff Reederei Peters Sachspende Bereitstellung der GmbH Konstruktions- unterlagen 09.03. HAFF TRANS GmbH Sachspende Technische Hilfe Ueckermünde 09.03. Ueckermünder Sachspende Bereitstellung der Wohnungsbau GmbH Bauhalle 11.03. MEK Metallbau, Elektro, Sachspende Kraftfahrzeug Service GmbH Ueckermünde 11.03. Sparkasse Uecker-Randow Geldspende 11.03. HAFF TRANS GmbH Sachspende Technik Ueckermünde 11.03. Landkreis Uecker -Randow Sachspende Hafennutzung Industriehafen Berndshof Monat/ Name / Firma Art der Spende Bemerkungen Jahr 11.03. Berufsfachschule für Geldspende Lehrkörper und Heilerzieher Greifswald / Schüler/Innen Bandelin 11.03. Berufsfachschule für Einwerbung von In Projektwochen Heilerzieher Greifswald / Sachspenden der Schule Bandelin 11.03. DR. Gert Wagener und Frau Geldspende Monika Greifswald 11.03. Rats Apotheke Greifswald Sachspende 01.04. Renault Autohaus Demmin Sachspende Blei Browl und Borgwardt OHG 01.04. -

HELCOM Red List
SPECIES INFORMATION SHEET Corophium multisetosum English name: Scientific name: – Corophium multisetosum Taxonomical group: Species authority: Class: Malacostraca Stock, 1952 Order: Amphipoda Family: Corophiidae Subspecies, Variations, Synonyms: Generation length: 2 years? Trophonopsis truncata Strøm, 1768 Trophon truncatus Strøm, 1768 Past and current threats (Habitats Directive Future threats (Habitats Directive article 17 article 17 codes): Fishing (bottom trawling; codes): Fishing (bottom trawling; F02.02.01), F02.02.01), Eutrophication (H01.05) Eutrophication (H01.05) IUCN Criteria: HELCOM Red List NT B2b Category: Near Threatened Global / European IUCN Red List Category Habitats Directive: – – Protection and Red List status in HELCOM countries: Denmark –/–, Estonia –/–, Finland –/–, Germany –/G (endangered by unknown extent), Latvia –/–, Lithuania –/–-, Poland –/–, Russia –/–, Sweden: –/– Distribution and status in the Baltic Sea region C. multisetosum is reported mainly from coastal waters (bays) along southern shores of the Baltic Sea and those in the Danish straits, including adjacent fjords, canals, lagoons, e.g. the Curonian Lagoon, which is the easternmost area. However, there are also records from more open sea, and thus more saline areas such as the Hevring Bay, Arhus Bay, Arkona Basin by Darss-Zingst Peninsula, and the outer Puck Bay. Declining population trends are reported from the Szczecin Lagoon (Wawrzyniak-Wydrowska, pers. comm.). ©HELCOM Red List Benthic Invertebrate Expert Group 2013 www.helcom.fi > Baltic Sea trends > Biodiversity > Red List of species SPECIES INFORMATION SHEET Corophium multisetosum Distribution map The georeferenced records of species compiled from the Danish national database for marine data (MADS), Russian monitoring data (Elena Ezhova, pers. comm), and the database of the Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW), where also the Polish literature and monitoring data for the species are stored. -

Potenziale Und Hemmnisse Für Paludi- Kultur Auf Niedermoorstandorten in Vor- Pommern: Ergebnisse Der Akteurs- Gespräche Und -Werkstätten
Nachhaltigkeit und soziale Anschlussfähigkeit von Landnutzungen Potenziale und Hemmnisse für Paludi- kultur auf Niedermoorstandorten in Vor- pommern: Ergebnisse der Akteurs- gespräche und -werkstätten S. Kleinhückelkotten & H.-P. Neitzke Potenziale und Hemmnisse für Paludikultur auf Nieder- moorstandorten in Vorpommern: Ergebnisse der Akteurs- gespräche und -werkstätten Projektbericht VIP – Vorpommern Initiative für Paludikultur Modul 9: Nachhaltigkeit und soziale Anschlussfähigkeit von Landnutzungen Autoren: Dr. Silke Kleinhückelkotten Dr. H.-Peter Neitzke ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung Das Projekt wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. FKZ: 033L030D Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. ECOLOG-Institut, Hannover Dezember 2012 Inhalt Seite 1 Einleitung 1 2 Flächen mit Potenzial für Paludikultur in Vorpommern 2 3 Hemmnisse für die Umsetzung von Paludikultur auf geeigneten Flächen 26 4 Zusammenfassung 29 Literatur 31 1 Einleitung Im Rahmen des Projekts 'VIP – Vorpommern Initiative für Paludikultur' wurden im Modul 9 'Nachhaltigkeit und soziale Anschlussfähigkeit von Landnutzungen' Gespräche mit Akteuren auf der Ebene des Landes Mecklenburg-Vorpommern und in der Region Vorpommern ge- führt, um a) Unterstützungspotenziale und mögliche Hemmnisse für die Umsetzung von Paludikultur zu ermitteln und b) für Paludikultur geeignete Flächen zu identifizieren. Die Auswahl der Akteure erfolgte auf der Grundlage einer umfassenden Akteursfeldanalyse -

Gestatten Ostvorpommern
Gestatten Ostvorpommern L e b e n ––– w o a n d e r e L e u t e U r l a u b m a c h e n ……… Gestatten Ostvorpommern • Landkreis Ostvorpommern - St ärken und Schw ächen • Modellregion Stettiner Haff – ein Modellvorhaben des BMVBS • Ausblick – gemeinsam sind wir st ärker DerDer LandkreisLandkreis äußerster Nordosten Deutschlands, in Mecklenburg-Vorpommern Lage an Ostsee, Stettiner Haff, Insel Usedom, Peene und Peenestrom landwirtschaftliche Nutzung, ausgedehnte Wälder, Flusstäler und Küstenformen prägen Landschaftsbild sogenannter Perepherieraum mit sehr geringer Einwohnerdichte auf 1.910 km² wohnen 107.700 Einwohner, ca. 56 Einwohner pro km² (Stand: 30.06.08) Hauptwirtschaftszweige: Tourismus, Baugewerbe, Schiffbau, Handwerk, Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Land- u. Forstwirtschaft Fischerei, Hafenumschlag, Verarbeitungsindustrie Entfernungsangaben = Luftlinie AusgangssituationAusgangssituation Hemmnisse Stärken Abwanderung / Arbeitslosigkeit Lage in Brückenkopffunktion in Richtung rund 85 % der jungen Leute verlassen mit dem Skandinavien, Osteuroga und Baltikum Eintritt ins Berufsleben bzw. zur Ausbildung die Region. Der ländliche Raum mit seinen natürliche Abwanderung auch durch hohe strukurelle Ressourcen Arbeitslosigkeit infolge fehlender attraktiver Arbeitsplatzangebote Industrie- und Hafenstandorte Vierow, Lubmin, Wolgast, Anklam Geburtenrückgang Bei Kinderzahlen liegt der Süden der Region konkurrenzfähige Landwirtschaft auf unter dem Bundesdurchschnitt von 1,3 Kinder Weltmarkniveau je Frau Soziale Beziehungen und Netzwerke -

Charakteristik Der Fischfauna Aus Der Sicht
Charakteristik der Fischfauna aus der Sicht der Fischerei unter Berücksichtigung von naturschutzfachlichen Aspekten im Bereich des Greifswalder Boddens und Nördlichen Peenestroms Betrachtungszeitraum: Fischereiwirtschaftliche Daten2000-2006 Aktuelle Probennahme: Mai-Juni 2006 Bericht August 2007 Bearbeiter: Auftraggeber: Institut für Angewandte Ökologie GmbH Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund Alte Dorfstr. 11 Wamper Weg 5 18184 Neu Broderstorf 18439 Stralsund Tel. 038204 618-0 Tel. 03831/249-0 Fax 038204 618-10 Fax 03831/249-309 Email [email protected] Email [email protected] Internet http://www.ifaoe.de Internet www.wsv.de Projektleitung: Prof. Dr. H. Sordyl Probennahme: Dipl.-Biol. D. R. Lill Dr. R. Bochert Dipl.-Ing. T. Ode Bericht: Dipl.-Biol. D. R. Lill Dr. F. Gosselck Inhaltsverzeichnis Seite 1 Einleitung und Zielsetzung 4 2 Material und Methoden 4 2.1 Untersuchungsbereich und -zeitraum 4 2.2 Fischbiologische Untersuchungen 5 2.3 Fangstatistik Greifswalder Bodden 7 3 Ergebnisse 8 3.1 Hydrographie 8 3.1.1 Greifswalder Bodden 8 3.1.2 Nördlicher Peenestrom 8 3.1.3 Abiotische Parameter während der Befischungen 9 3.2 Ichthyofauna 10 3.2.1 Greifswalder Bodden 10 3.2.2 Nördlicher Peenestrom 13 3.3 Fischbiologische Untersuchungen 2006 13 3.3.1 Aalzeesenfänge 13 3.3.2 Strandwadenfänge 18 3.3.3 Bongonetzfänge 19 3.4 Fischereiliche Bedeutung und Fangmengen der kommerziellen Fischerei im Greifswalder Bodden von 2000 bis 2006 19 3.5 Zum Laichgeschehen im Greifswalder Bodden und Peenestrom 23 3.6 Zu Fischmigrationen im Greifswalder Bodden und Peenestrom 26 3.7 Zur Nahrungsökologie im Greifswalder Bodden (übernommen aus BOCHERT & WINKLER 2001 nach JÖNSSON et al. -

Archäologie Und Nation: Kontexte Der Erforschung „Vaterländischen Alterthums“
Die Insel Rügen und die Erforschung ihrer vorgeschichtlichen Denkmäler, 1800 bis 1860 Achim Leube Die Insel Rügen ist heute nicht nur wegen ihrer natürlichen Schönheiten, sondern auch wegen des noch erhaltenen Reichtums vorgeschichtlicher Denkmäler eine der beliebtesten Urlaubs- und Erholungslandschaften Deutschlands. Der damit verbundene Tourismus sowie eine intensivere Be- schäftigung mit dem vaterländischen Altertum setzten auf Rügen am Ausgang des 18. Jahrhun- derts ein und erlebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen starken Aufschwung. Das ist auch verständlich, wenn man das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld betrachtet. Um 1800 war die etwa 1.000 km2 große Insel von ca. 25.000 Menschen bewohnt, von denen etwa 20.000 Einwohner auf dem Lande in Leibeigenschaft einer überaus dominanten – mitunter auch als patriarchalisch bezeichneten – Gutsherrschaft lebten. In zwei kleinen Landstädten, Bergen (Stadtrecht 1613) und Garz (Stadtrecht 1319), gab es eine zahlenmäßig geringe Intelligenz – das Schulwesen lag ganz darnieder. Erst 1913 entstand ein rügensches Gymnasium in Bergen. Rügen gehörte seit 1637 zu Schweden, das aber nur geringe Steuern erhob und Schwedisch- Pommern weitgehend selbstständig beließ. Nachdem bereits unter König Friedrich Wilhelm I. 1720 die Grenzen Preußens bis zur Peene ausgedehnt worden waren, was zur Einverleibung Usedom Wollins geführt hatte, verblieb nur der nördliche Teil Vorpommerns und Rügen als „Schwedisch- Vorpommern“ in schwedischem Besitz. Erst nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 fiel dieser Teil Pommerns – nun als Neuvorpommern und Rügen bezeichnet – an Preußen.1 Die Entdeckung Rügens im frühen 19. Jahrhundert Bereits in schwedischer Zeit wurde Rügen als eine „deutsche“ Insel entdeckt und aufgesucht. Es begann 1796 mit einer Reise Wilhelm von Humboldts. -

Rostock Hbf - Stralsund Hbf - Bergen Auf Rügen � Ostseebad Binz 190
Kursbuch der Deutschen Bahn 2021 www.bahn.de/kursbuch Sassnitz Ostseebad Binz 190 ر Rostock Hbf - Stralsund Hbf - Bergen auf Rügen 190 VVW Verbundtarif Rostock - Gelbensande Zug RE 9 RE 9 RE 9 RE 9 RB 12 RE 10 RE 10 RE 9 ICE RE 9 RE 9 RB 12 ICE ICE 76351 76353 76355 76357 13227 76455 76455 76359 949 76397 76361 13231 1678 1678 f2. 76391 76393 76395 f f2. f2. f2. f2. 76399 f hy hy f2. f2. Ẅ f2. ẇ f2. ẅ Ẇ Ẉ ẅ Ẇ km km von Bonn Hbf Schwerin Hannover Hbf Hbf 45 9 ܥ ẚẍ 9 38 27 9 ܥ 00 9 11 8 ܥ ẙẕ 8 11 27 7 ܥ Rostock Hbf 181-185, 205 ẞẖ ݜ 4 54 ẙẑ 5 53 7 00 0 Bentwisch ᎪܥᎪ 7 07 ܥ 7 35 ܥᎪܥᎪ Ꭺܥ 9 35 ܥᎪܥᎪ Mönchhagen ᎪܥᎪ 7 10 ܥ 7 39 ܥᎪܥᎪ Ꭺܥ 9 39 ܥᎪܥᎪ 15 Rövershagen ẞẖ ܙ 5 05 ܥ 6 04 7 13 ܥ 7 42 ܥ 8 27 ܥ 8 27 9 10 ܥ 9 42 ܥᎪܥᎪ 15 Rövershagen 5 05 ܥ 6 04 7 14 ܥ 8 28 ܥ 8 28 9 11 ܥᎪܥᎪ 20 Gelbensande 5 10 ܥ 6 09 7 18 ܥ 8 35 ܥ 8 35 9 15 ܥᎪܥᎪ 05 10ܥᎪܥ 22 9 48 8 ܥ 48 8 ܥ 24 7 15 6 ܥ 17 5 ܙ Ribnitz-Damgarten West ݘ 29 29 Ribnitz-Damgarten West 5 17 ܥ 6 16 7 25 ܥ 8 49 ܥ 8 49 9 22 ܥᎪܥ10 07 Ꭺܥ 02 10 ܥ 26 9 52 8 ܥ 52 8 ܥ 28 7 19 6 ܥ Ribnitz-Damgarten Ost ݚ 5 21 33 39 Altenwillershagen 5 26 ܥ 6 25 7 32 ܥᎪܥᎪ 9 30 ܥᎪܥᎪ 48 Buchenhorst 5 32 ܥ 6 32 7 38 ܥᎪܥᎪ 9 36 ܥᎪܥᎪ 26 10 ܥ 14 10 ܥ 39 9 02 9 ܥ 02 9 ܥ 41 7 37 6 ܥ 36 5 ܙ Velgast ݚ 54 54 Velgast ẞẍ 5 39 ܥ 6 38 7 42 ܥ 9 03 ܥ 9 03 9 40 ܥ 10 16 ܥ 10 28 63 Martensdorf Ꭺ 5 45 ܥ 6 46 7 49 ܥᎪܥᎪ 9 47 ܥᎪܥᎪ 64 Stralsund-Grünhufe Ꭺ 5 51 ܥ 6 51 7 54 ܥ 9 13 ܥ 9 18 9 53 ܥᎪܥᎪ 41 10 ܥ ẚẍ 10 29 57 9 22 9 ܥ 17 9 ܥ 58 7 55 6 ܥ 55 5 ܙ Stralsund Hbf 193,203,205 ẞẍ ݝ 72 72 Stralsund Hbf ᵜ 10160 ẙẑ 4 59 5 59 ܥ 6 59 7 59 ܥᎪܥᎪ 8 59 ܥ 9 09 9 59 -

366 Rügen - Wunderschöne Insel
Süderholzer Blatt mit amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Süderholz Jahrgang 31 Freitag, den 16. Juli 2021 Nummer 366 Rügen - wunderschöne Insel Die Sommer- und Urlaubszeit hat begonnen kleinen Galerien und Keramikwerkstätten und die Ostseeküste in Mecklenburg-Vor- zu besuchen. Wir waren viel mit Fahrrädern pommern lädt nach vielen Monaten wieder unterwegs, das gefiel, natürlich neben dem Gäste ein. Und die kommen zuhauf. Seit Baden, auch unseren Enkelkindern. Mit langer Zeit schon sind die Hotels und Feri- ihnen teilten wir eine Woche lang unseren enhäuser ausgebucht und auf den Camping- kleinen Wohnwagen. Das fanden sowohl die plätzen bekommt man selten spontan noch Großeltern als auch die Enkel gut. Und das einen Platz. Nicht alle Einheimischen freuen Wetter spielte mit. An den zwei ziemlich küh- sich unbedingt darüber, so manchem wird es len Tagen waren unsere Enkel mit Hilfe des auch mal zu eng auf der Insel. Großvaters sehr kreativ - es entstanden Bilder Ende Juni waren auch wir mal wieder für ein aus Strandgut. Das machte so viel Spaß, dass paar Tage auf Rügen und sind wie immer be- man es nur weiterempfehlen kann. geistert. Rügen - eine Insel, wie sie vielfältiger Nicht nur einmal wurde uns während die- nicht sein kann und immer wieder gibt es Neu- ser Tage bewusst, in was für einem schönen es zu entdecken. Flaches und hügeliges Land Landstrich wir zu Hause sind! Statt hunderter wechseln sich ab, weite Felder gibt es, deren Kilometer, die man aus Bayern und Franken Ende man oft nur erahnen kann. Und dann zurücklegen muss, sind wir im Nu an der Küs- die langen und hellen Strände, Kreidefelsen te. -
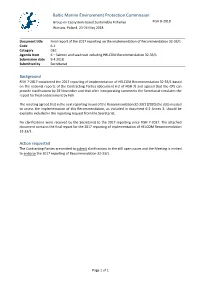
6-1 Final Report of the 2017 Reporting on The
Baltic Marine Environment Protection Commission Group on Ecosystem-based Sustainable Fisheries FISH 8-2018 Warsaw, Poland, 23-24 May 2018 Document title Final report of the 2017 reporting on the implementation of Recommendation 32-33/1 Code 6-1 Category DEC Agenda Item 6 – Salmon and sea trout including HELCOM Recommendation 32-33/1 Submission date 9.4.2018 Submitted by Secretariat Background FISH 7-2017 considered the 2017 reporting of implementation of HELCOM Recommendation 32-33/1 based on the national reports of the Contracting Parties (document 6-2 of FISH 7) and agreed that the CPS can provide clarifications by 29 November and that after incorporating comments the Secretariat circulates the report for final endorsement by Fish. The meeting agreed that in the next reporting round of the Recommendation 32-33/1 (2020) the data needed to assess the implementation of this Recommendation, as included in document 6-2 Annex 3, should be explicitly included in the reporting request from the Secretariat. No clarifications were received by the Secretariat to the 2017 reporting since FISH 7-2017. The attached document contains the final report for the 2017 reporting of implementation of HELCOM Recommendation 32-33/1. Action requested The Contracting Parties are invited to submit clarifications to the still open issues and the Meeting is invited to endorse the 2017 reporting of Recommendation 32-33/1. Page 1 of 1 FISH 8-2018, 6-1 Report on implementation of HELCOM Recommendation 32-33/1 “Conservation of Baltic salmon (salmo salar) and sea trout (salmo trutta) populations by the restoration of their river habitats and management of river fisheries” (To be reported to the Commission every 3 years, starting in January 2012) 0. -

Home Port of the Romantic
University- and Hanseatic Town of Home Port of the Romantic greifswald.info The Centre-Piece Merchants’ Houses The market square is the heart of Greifswald’s historic Old Town. Just like in past days, the town’s and Brick Gothic ‘front room’ is still the meeting place for chatting, gossip and shopping. The most beautiful façades on the market square more than certainly belong to the Town Hall and the two brick Gothic gabled Markt 11 houses Markt 11 and Markt 13. The Historic Book your guided tour Being old merchants’ houses, of the Old Town here: Old Town they remind us of the previ- +49 3834 8536 1380 St. Marien ous wealth of the Hanseatic traders and, together with seven further buildings, belong to the European Route of Brick Gothic. On a walk through the streets of the Old Town, visitors can discover the witnesses of the medieval past. Built in the middle of the 13th Century, the spires of the three churches, St. Nikolai, St. Marien and St. Jacobi can be seen from far afield. The Old Town is surrounded by the remnants of the town wall. Built back then to protect the town from attacks, the former ramparts are today the perfect venue for drawn-out walks. Nicholas, Marie & Jacob Market Square Lovingly known by Greifswald’s citizens as ‘long Nicholas’, ‘fat Marie’ and ‘little Jacob’, the three redbrick churches shape the face of the historic Old town. As the church in which Caspar David Friedrich was baptised, and the place in which the University was founded, the cathedral St. -

•2 •3 •1 •4 •6 •8 •5 •7
Fachkräfte für Reittourismus ) « k r a m 1 Jana Marszalkowski e ) Kopenhagen n n ä e d D ( DÄNEMARK e Pferdehof Ostseebad ©WERK3.de 1 w m l h o OSTSE E c S h ( n r g r o Binz, Binz auf Rügen o B / b e e l n Kap Arkona l e n Mecklenburg-Vorpommern r ø Putgarten T R Dranske Ostseebad Breege Deutschland Gedser Juliusruh Kloster Wiek/ Glowe Bundesstraße Nationalpark, ) Nationalpark n Rügen Naturpark, e Vitte Jasmund 2 Lea Bosdorf d Seebad Autobahn Biosphärenreservat e Sassnitz w Schaprode ) Insel h k c r S Rügen Feriendorf, Eisenbahn a ( Hiddensee Entfernung: ca. 30 km Halbinsel Ostseebad m g 2 r Nationalpark e Fischland- Prerow Sassnitz Fährhafen o Ostseeheilbad Warnowtunnel n Vorpommersche b ä Zingst Ummanz Ralswiek e Ummanz l (mautpichtig) D Darß-Zingst 2 l Boddenlandschaft ( Prora e r Insel Rügen r • Wieck/ e Ostseebad T s Darß Ostseebad Binz d Ahrenshoop Hinweise zur Anreise unter: e G Ostseebad Bergen Ostseebad Sellin Stand 02/2017 www.auf-nach-mv.de/anreise Wustrow Born Ostseebad Baabe 5 Hansestadt Altefähr Putbus 1 Ostseebad Göhren Ostseebad • Barth Samtens • Biosphärenreservat Lauterbach Dierhagen STRALSUND Südost-Rügen Kiel Ostseeheilbad Gager/ Lobbe 3 Rebecca Bothe Graal-Müritz Groß Zicker Klocken- Velgast Ostseebad Rügischer Bodden Thiessow Schleswig- hagen Bernsteinstadt 3 Lucky Meadow Ranch, Ostseebad Ribnitz-Damgarten• Stahl- Mecklenburger Pommersche Holstein Warnemünde Franzburg brode Greifswalder 3 Bucht Ostseebad Ostseeheilbad Bodden Bucht Velgast Kühlungsborn Rövershagen Heiligendamm Marlow Peenemünde Insel Usedom Ostseebad -

CW 5 2014 Governance Report HERRING
C O A S T L I N E 2 0 1 4 - 0 5 W E B HERRING Governance Report Herring network institutions and governance H. V. Strehlow, D. Fey, A. Lejk, F. Lempe, H. Nilsson, I. Psuty & L. Szymanek T h e C o a s t a l U n i o n G e r m a n y EUCC-D D i e K ü s t e n U n i o n D e u t s c h l a n d Coastline Web 05 (2014) HERRING Governance Report Herring network institutions and governance Authors: H. V. Strehlow, D. Fey, A. Lejk, F. Lempe, H. Nilsson I. Psuty & L. Szymanek Rostock, Gdynia, Malmö 2014 ISSN 2193-4177 ISBN 978-3-939206-13-2 This report was developed in the project HERRING - Joint cross-border actions for the sustainable management of natural resource (2012-2014). The international project HERRING seeks to improve the sustainable and holistic management of herring fish in the South Baltic region, a major ecosystem resource, and with it both the reproductive capacity of the species and the success of future sustainable herring fisheries. More information about HERRING can be found on the project website: www.baltic-herring.eu. Partners: EUCC – The Coastal Union Germany Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries, Germany National Marine Fisheries Research Institute, Poland World Maritime University, Sweden and further 8 associated partners (from Germany, Poland, Sweden and Lithuania) Funding: EU South Baltic Cross-border Co-Operation Programme 2007-2013 Imprint Cover picture: Greifswald Bay (Picture: Franziska Stoll) Coastline Web is published by: EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V.