Charakteristik Der Fischfauna Aus Der Sicht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Potenziale Und Hemmnisse Für Paludi- Kultur Auf Niedermoorstandorten in Vor- Pommern: Ergebnisse Der Akteurs- Gespräche Und -Werkstätten
Nachhaltigkeit und soziale Anschlussfähigkeit von Landnutzungen Potenziale und Hemmnisse für Paludi- kultur auf Niedermoorstandorten in Vor- pommern: Ergebnisse der Akteurs- gespräche und -werkstätten S. Kleinhückelkotten & H.-P. Neitzke Potenziale und Hemmnisse für Paludikultur auf Nieder- moorstandorten in Vorpommern: Ergebnisse der Akteurs- gespräche und -werkstätten Projektbericht VIP – Vorpommern Initiative für Paludikultur Modul 9: Nachhaltigkeit und soziale Anschlussfähigkeit von Landnutzungen Autoren: Dr. Silke Kleinhückelkotten Dr. H.-Peter Neitzke ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung Das Projekt wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. FKZ: 033L030D Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. ECOLOG-Institut, Hannover Dezember 2012 Inhalt Seite 1 Einleitung 1 2 Flächen mit Potenzial für Paludikultur in Vorpommern 2 3 Hemmnisse für die Umsetzung von Paludikultur auf geeigneten Flächen 26 4 Zusammenfassung 29 Literatur 31 1 Einleitung Im Rahmen des Projekts 'VIP – Vorpommern Initiative für Paludikultur' wurden im Modul 9 'Nachhaltigkeit und soziale Anschlussfähigkeit von Landnutzungen' Gespräche mit Akteuren auf der Ebene des Landes Mecklenburg-Vorpommern und in der Region Vorpommern ge- führt, um a) Unterstützungspotenziale und mögliche Hemmnisse für die Umsetzung von Paludikultur zu ermitteln und b) für Paludikultur geeignete Flächen zu identifizieren. Die Auswahl der Akteure erfolgte auf der Grundlage einer umfassenden Akteursfeldanalyse -

Gestatten Ostvorpommern
Gestatten Ostvorpommern L e b e n ––– w o a n d e r e L e u t e U r l a u b m a c h e n ……… Gestatten Ostvorpommern • Landkreis Ostvorpommern - St ärken und Schw ächen • Modellregion Stettiner Haff – ein Modellvorhaben des BMVBS • Ausblick – gemeinsam sind wir st ärker DerDer LandkreisLandkreis äußerster Nordosten Deutschlands, in Mecklenburg-Vorpommern Lage an Ostsee, Stettiner Haff, Insel Usedom, Peene und Peenestrom landwirtschaftliche Nutzung, ausgedehnte Wälder, Flusstäler und Küstenformen prägen Landschaftsbild sogenannter Perepherieraum mit sehr geringer Einwohnerdichte auf 1.910 km² wohnen 107.700 Einwohner, ca. 56 Einwohner pro km² (Stand: 30.06.08) Hauptwirtschaftszweige: Tourismus, Baugewerbe, Schiffbau, Handwerk, Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Land- u. Forstwirtschaft Fischerei, Hafenumschlag, Verarbeitungsindustrie Entfernungsangaben = Luftlinie AusgangssituationAusgangssituation Hemmnisse Stärken Abwanderung / Arbeitslosigkeit Lage in Brückenkopffunktion in Richtung rund 85 % der jungen Leute verlassen mit dem Skandinavien, Osteuroga und Baltikum Eintritt ins Berufsleben bzw. zur Ausbildung die Region. Der ländliche Raum mit seinen natürliche Abwanderung auch durch hohe strukurelle Ressourcen Arbeitslosigkeit infolge fehlender attraktiver Arbeitsplatzangebote Industrie- und Hafenstandorte Vierow, Lubmin, Wolgast, Anklam Geburtenrückgang Bei Kinderzahlen liegt der Süden der Region konkurrenzfähige Landwirtschaft auf unter dem Bundesdurchschnitt von 1,3 Kinder Weltmarkniveau je Frau Soziale Beziehungen und Netzwerke -

Satzung Der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz Bebauungsplan Nr
Satzung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz Bebauungsplan Nr. 37 „Photovoltaikanlage auf der stillgelegten Deponie“ FFH-Vorprüfung FFH-Gebiet DE 2049-302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff“ Bearbeiter: Kunhart Freiraumplanung Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey-Kunhart Gerichtsstraße 3 17033 Neubrandenburg Tel: 0395 422 5 110 _______________________________ K. Manthey-Kunhart Dipl.-Ing. (FH) Neubrandenburg, den 31.05.2017 Inhaltsverzeichnis 1. ANLASS UND ZIELE .......................................................................................... 3 2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN ........................................................................ 4 3. VORGEHENSWEISE .......................................................................................... 5 4. PROJEKTBESCHREIBUNG .............................................................................. 6 5. BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES. ..................................... 9 6. BESCHREIBUNG DES FFH-GEBIETES DE 2049-302 „PEENEUNTERLAUF, PEENESTROM, ACHTERWASSER UND KLEINES HAFF“ UND ERMITTLUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH DAS VORHABEN ... 10 7. ZUSAMMENFASSUNG .................................................................................... 15 8. QUELLEN ......................................................................................................... 15 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Lage des Vorhabens zum FFH - Gebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2017) .................... 3 Abb. 2: FFH-Gebiet östlich des Vorhabens (Quelle: © LINFOS/M-V 2017) ..........................10 -

Of the Brackish Environment by Ponto-Caspian Amphipods: a Case Study of the German Baltic Sea
BioInvasions Records (2018) Volume 7, Issue 3: 269–278 Open Access DOI: https://doi.org/10.3391/bir.2018.7.3.07 © 2018 The Author(s). Journal compilation © 2018 REABIC Research Article The conquest (and avoidance?) of the brackish environment by Ponto-Caspian amphipods: A case study of the German Baltic Sea Ulrich Meßner1 and Michael L. Zettler2,* 1Nationalparkamt Müritz, Schlossplatz 3, 17237 Hohenzieritz, Germany 2Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Seestraße 15, 18119 Rostock, Germany Author e-mails: [email protected] (UM), [email protected] (MZ) *Corresponding author Received: 7 March 2018 / Accepted: 25 June 2018 / Published online: 16 July 2018 Handling editor: Philippe Goulletquer Abstract Although an invasion of the brackish water biotopes was to be expected with the appearance of several Ponto-Caspian amphipods in German freshwaters two decades ago (and earlier), only recently (two years ago) the conquest of the mesohaline Baltic Sea could be observed. This discrepancy is a fortiori of interest as previous experimental studies showed that species like Dikerogammarus villosus and Obesogammarus crassus were able to tolerate both mesohaline and also polyhaline conditions. Two decades of invasion history in rivers and lakes have led to drastic faunal changes. If similar or analogue shifts will happen in brackish environments and if estuaries like the Stettin lagoon function not only as “a gate to the Baltic Sea” but also as a “catalyser” or acclimatisation area for invasive species remains to be seen. Simultaneously the question came up, why other also potentially brackish water species failed to colonise mesohaline waters although they partially arrived in the investigation area several decades ago (e.g. -

Usedom Wolin
IKZM Forschung für ein Integriertes Küstenzonenmanagement Oder in der Odermündungsregion IKZM-Oder Berichte 4 (2004) Ergebnisse der Bestandsaufnahme der touristischen Infrastruktur im Untersuchungsgebiet Peene- strom Ostsee Karlshagen Pommersche Bucht Zinnowitz (Oder Bucht) Wolgast Zempin Dziwna Koserow Kolpinsee Ückeritz Bansin HeringsdorfSwina Ahlbeck Miedzyzdroje Usedom Wolin Anklam Swinoujscie Kleines Haff Stettiner (Oder-) Polen Haff Deutschland Wielki Zalew Ueckermünde 10 km Oder/Odra Autoren: Wilhelm Steingrube, Ralf Scheibe & Marc Feilbach Institut für Geographie und Geologie Universität Greifswald ISSN 1614-5968 IKZM-Oder Berichte 4 (2004) Ergebnisse der Bestandsaufnahme der touristischen Infrastruktur im Untersuchungsgebiet von Wilhelm Steingrube, Ralf Scheibe und Marc Feilbach Institut für Geographie und Geologie Wirtschafts- und Sozialgeographie Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Makarenkostraße 22, D -17487 Greifswald Greifswald, November 2004 Impressum Die IKZM-Oder Berichte erscheinen in unregelmäßiger Folge. Sie enthalten Ergebnisse des Projektes IKZM-Oder und der Regionalen Agenda 21 “Stettiner Haff – Region zweier Nationen” sowie Arbeiten mit Bezug zur Odermündungsregion. Die Berichte erscheinen in der Regel ausschließlich als abrufbare und herunterladbare PDF-Files im Internet. Das Projekt “Forschung für ein Integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion (IKZM-Oder)” wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter der Nummer 03F0403A gefördert. Die Regionale Agenda 21 “Stettiner Haff – Region zweier Nationen” stellt eine deutsch-polnische Kooperation mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung dar. Die regionale Agenda 21 ist Träger des integrierten Küstenzonenmanagements und wird durch das Projekt IKZM-Oder unterstützt. Herausgeber der Zeitschrift: EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V. Poststr. 6, 18119 Rostock, http://www.eucc-d.de.de/ Dr. G. Schernewski & N. Löser Für den Inhalt des Berichtes sind die Autoren zuständig. -

Grundstücksauktionshaus
Norddeutschlands größtes Grundstücksauktionshaus Mehrfamilienhaus in Hamburg - Pos. 39 Einfamilienhaus in Hamburg - Pos. 36 Wohn-/Geschäftshaus in Barth - Pos. 46 Einfamilienhaus in Graal-Müritz - Pos. 12 29. Mai 2021 | 11:00 Uhr Norddeutsche Grundstücksauktionen AG www.ndga.de · Tel. 0381 - 444 330 · E-Mail: [email protected] 122. GRUNDSTÜCKSAUKTION Samstag, 29. Mai 2021 ab 11.00 Uhr in Rostock pentahotel, Schwaansche Straße 6, 18055 Rostock Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kunden unseres Hauses, seit 2001 versteigern wir Immobilien aus ganz Norddeutschland. Auf 121 Auktionen wurden über 5.800 Immobilien im Auftrag der Eigen- tümer versteigert. Der Zuschlag wird nur dem Meistbietenden erteilt; zum dann neuen Verkehrswert! Wir arbeiten regelmäßig im Auftrag von Privatpersonen, privat- und öffentlich rechtlichen Unternehmen, Sparkassen und Banken, Private Equity Unternehmen, Nachlasspflegern und Insolvenzverwaltern, kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, Landkreisen, Städten und Gemeinden, der Deutsche Bahn AG , dem Land M-V sowie der Bundes republik Deutschland (und ihren Gesellschaften , ). Immer auf freiwilliger Basis. Rund 200.000 Katalogleser aus über 50 Ländern weltweit informieren sich regelmäßig über unsere Angebote. Zu jeder Auktion werden mehrere Zehntausend Zeitungsbeileger mit Hinweisen auf ausgewählte Objekte verteilt. Diese große Marktdurchdringung, die neutrale Bewertung durch das Auktionshaus und die Transparenz der Auktion bieten sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer ein Höchstmaß an Sicherheit. Im Rahmen der anstehenden Sommer-Auktion kommen insgesamt 49 Immobilien zum Aufruf. Die im Katalog gemachten Angaben zum Zustand des jeweiligen Objektes dienen dazu, den Gesamtzustand beispielhaft wiederzugeben. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben. Angegebene Jahresmieten sind Nettomieten, die Bezeichnung „für die ver- mieteten Flächen“ bedeutet, dass etwaig leerstehende Flächen bei der Angabe der Miete nicht mit einbezogen wurden. -
Motorradtouren Am Stettiner Haff
Bikertouren am Haff idyllische Touren 4 attraktive Ausflugsziele 4 bikerfreundliche Unterkünfte 4 www.motorradfahren-am-haff.de Tour durch das 1 Land der drei Meere (Ueckermünde - Pasewalk - Strasburg - Woldegk - Friedland) ca. 180 km So nämlich wird die Gegend im Nordosten des Landes auch bezeichnet. Zwei davon sind das Wald-Meer und das Land-Meer. Das dritte „Meer“ könnt ihr selbst herausfinden. Am Stettiner Haff entlang geht es durch die Ueckermünder Heide und die Brohmer Berge, vorbei am Galenbecker See. Der Helpter Berg ist mit 179 m die höchste Erhebung des Landes. Von hier aus gelangt man direkt in die Windmühlenstadt Woldegk. Ueckermünde Altwap Friedland . Hintersee Rothemühl Torgelow Strasburg Woldegk Pasewalk Löcknitz Woldegker Windmühle Schloss Rattey Ukranenland Helpter Berg Ukranen-Tour 2 (Ueckermünde - Torgelow - Rothemühl - Anklam) ca. 130 km Durch die Ueckermünder Heide geht es direkt in das Ukranenland nach Torgelow mit der historischen Bootswerft und der Ukranensiedlung. Die Brohmer Berge, der Galenbecker See und die Große Friedländer Wiese sind echte landschaftliche Höhepunkte- die Straßen ein Hochgenuß für Cruiser. Sehenswert in Anklam: das Otto Lilienthal- Museum. Das Peenetal-Moor bei Ducherow (hier gibt es auch ein Motorradmuseum) ist ein Muss auf dem Weg zurück nach Ueckermünde. Anklam Strippow Ducherow Ueckermünde Torgelow Rothemühl Torgelow Kirche Mönkebude Peenetal Grambin Ostvorpommern-Tour 3 (Ueckermünde - Anklam - Wolgast - Lubmin) ca. 225 km Ausgangspunkt ist wiederum die Hafenstadt Ueckermünde. Weiter geht es und auf bestens präparierten, kurvenreichen Nebenstrecken über Anklam wieder nach Greifswald vorbei am ehemaligen KKW Lubmin, dort gibt es eine sehr interessante Ausstellung zur Geschichte der Kernkraft. Im Fischereihafen von Freest empfehlen wir eine Pause, denn hier gibt es die leckersten Fischbrötchen südlich des Nordpols. -

The River Odra Estuary As a Gateway for Alien Species Immigration to the Baltic Sea Basin Das Oderästuar Als Pfad Für Die Einwanderung Von Alienspezies in Die Ostsee
Acta hydrochim. hydrobiol. 27 (1999) 5, 374-382 © WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69451 Weinheim, 1999 0323 - 4320/99/0509-0374 $ 17.50+.50/0 The River Odra Estuary as a Gateway for Alien Species Immigration to the Baltic Sea Basin Das Oderästuar als Pfad für die Einwanderung von Alienspezies in die Ostsee Dr. Piotr Gruszka Department of Marine Ecology and Environmental Protection, Agricultural University in Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza 4/H, PL 71-550 Szczecin, Poland E-mail: [email protected] Summary: The river Odra estuary belongs to those water bodies in the Baltic Sea area which are most exposed to immigration of alien species. Non-indigenous species that have appeared in the Szczecin Lagoon (i.a. Dreissena polymorpha, Potamopvrgus antipodarum, Corophium curvispinum) and in the Pomeranian Bay (Cordylophora caspia, Mya arenaria, Balanus improvisus, Acartia tonsa) in historical time and which now are dominant components of animal communities there as well as other and less abundant (or less common) alien species in the estuary (e.g. Branchiura sowerbyi, Eriocheir sinensis, Orconectes limosus) are presented. In addition, other newcomers - Marenzelleria viridis, Gammarus tigrinus, and Pontogammarus robustoides - found in the estuary in the recent ten years are described. The significance of the sea and inland water transport in the region for introduction of non-indigenous species is discussed against the background of the distribution pattern of these recently introduced polychaete and gammarid species. Keywords: Alien Species, Marenzelleria viridis, Gammarus tigrinus, Pontogammarus robustoides, River Odra Estuary Zusammenfassung: Das Oderästuar gehört zu den Bereichen der Ostsee, die am meisten der Einwanderung von Alienspezies ausgesetzt sind. -

15. Februar 2019
Jahrgang 15/Nummer 02 Freitag, den 15. Februar 2019 Überreichung des Kulturpreises 2018 an Frau Dr. Barbara Roggow durch Bürgermeister Stefan Weigler und Gisela Kretschmer Foto: Frau G. Kretschmer, Vorsitzende des Fördervereins für Kultur, Kunst, Bildung und Sport Wolgast e. V. Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Am Peenestrom und der Gemeinden Wolgast – 2 – Nr. 02/2019 111 sowie der Kreisstraße VG 27 notwendig. Im Bereich der Bundesstraße erstrecken sich die Arbeiten von Abschnitt 170 km 2,420 bis Abschnitt 180 km 0,120. In den Kreisstraßenästen werden Aufschlüsse auf je max. 150 m Länge von der Bundes- Seite straße ausgeführt. Bekanntmachungen Die Arbeiten für die Baugrundaufschlüsse sind auch auf den • Straßenbauamt Neustrelitz - Bekanntmachung an die Bundesstraße angrenzenden Grundstücken (Wald- gem. Bundesfernstraßengesetz § 16a 2 und Ackerflächen) durchzuführen. Sie werden frühestens am 06.03.2019 begonnen und voraussichtlich bis zum 03.05.2019 Ratsinformationen abgeschlossen sein. • Beschlüsse der Stadtvertretung Wolgast Die Baugrundaufschlussarbeiten liegen im Interesse der Allge- vom 28.01.2019 2 meinheit und sind aus diesem Grunde gemäß §16a Bundesfern- Aus der Verwaltung straßengesetz durch die Grundstücksberechtigten zu dulden. • Sprechtag Bürgerbeauftragter 3 Die Grundstücksberechtigten werden deshalb gebeten, die Be- • Hier finden Sie Hilfe! (Hotlines) 3 tretbarkeit der Grundstücke zu gewährleisten. • Information über gesetzliche Regelungen Die Arbeiten werden durch Beauftragte der Straßenbauverwal- bezüglich Gehölzschutz 3 tung durchgeführt, die sich entsprechend ausweisen können. Das beauftragte Prüfinstitut wird mittels Internet über das Amt Stadt Wolgast Am Peenestrom in der 12 KW (18.02. - 22.02.2019) bekannt ge- • Veranstaltungsplan Senioren Buddenhagen 4 geben. • Sprechzeit des Vorsitzenden der OtV Hohendorf Etwaige durch die Baugrundaufschlussarbeiten entstehende am 19.03.2019 4 unmittelbare Vermögensnachteile werden mit Geld entschädigt. -

Kinder- Und Jugendwegweiser Für Den Landkreis Vorpommern-Greifswald Vorwort
LANDKREIS VORPOMMERN-GREIFSWALD Kinder- und Jugendwegweiser für den Landkreis Vorpommern-Greifswald www.kreis-vg.de Vorwort Liebe Kinder, liebe Jugendliche, ich freue mich, Euch den ersten Kinder- und Jugend- Der vorliegende Kinder- und Jugendwegweiser bietet einen Überblick über alle wegweiser für den Landkreis Vorpommern- Greifswald Einrichtungen im Landkreis Vorpommern- Greifswald, die für Euch bedeutsam vorstellen zu dürfen. In Anlehnung an den Pflege- und sind. So dokumentiert er Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenwegweiser, der sich bei der älteren Bevöl- Jugendfeuerwehren und Sportvereine, um aktive und abwechslungsreiche kerung über Jahre etabliert hat, konnten wir nun auch Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Vor allem aber hilft er Euch, medizinische die vorliegende Broschüre für Eure Altersgruppe fertig Möglichkeiten zu finden wenn Ihr in Not seid (z.B. Fachärzte für Kinder – und stellen. Jugendmedizin sowie Rehabilitationseinrichtungen). Der Wegweiser zeigt Euch Möglichkeiten der beruflichen Orientierung und dokumentiert viele wichtige Tele- Beide Wegweiser sind für uns besonders wichtig, denn Kinder- und Familien- fonnummern und Kontaktdaten. freundlichkeit sowie natürlich die Erschaffung und Erhaltung guter Lebens- verhältnisse für Senioren und ältere Menschen sind bei uns im Kreis zentrale Ich hoffe und wünsche uns allen, dass der vorliegende Wegweiser zu Eurem Ziele. Sie werden sowohl von der Politik als auch von mir vielen Entscheidun- Wohlbefinden beiträgt und Euch hilft, passende Angebote für Eure ganz persön- gen zu Grunde gelegt und durch die Verwaltung umgesetzt. lichen Bedürfnisse in unserem Landkreis zu finden. Kinder und Jugendliche finden im Landkreis Vorpommern- Greifswald eine Herzliche Grüße, Euer Vielfalt an Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten, um eine gleichberechtigte Entwicklung zu ermöglichen. Dennoch sind und bleiben die Eltern natürlich Dirk Scheer die Hauptverantwortlichen bei der Erziehung ihrer Kinder. -
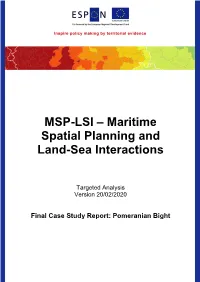
MSP-LSI – Maritime Spatial Planning and Land-Sea Interactions
MSP-LSI – Maritime Spatial Planning and Land-Sea Interactions Targeted Analysis Version 20/02/2020 Final Case Study Report: Pomeranian Bight This targeted analysis activity is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Sue Kidd, Stephen Jay, Leonnie Robinson, Dave Shaw, Hannah Jones – University of Liverpool (UK) Marta Pascual, Diletta Zonta, Ecorys (Belgium) Katrina Abhold, Ina Kruger , Katriona McGlade, Ecologic Institute (Germany) Dania Abdhul Malak, Antonio Sanchez, University of Malaga (Spain) Advisory Group Project Steering Group: Holger Janssen, Ministry of Energy, Infrastructure and Digitalization Mecklenburg-Vorpommern, Germany (Lead Stakeholder); Lenca Humerca-Solar,Ministry of the Environment and Spatial Planning, Directorate Spatial Planning, Construction and Housing, Slovenia, Katarzyna Krzwda & Agata Zablocka, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Department for Maritime Economy, Poland, Sandra Momcilovic, Ministry of Construction and Physical Planning, Croatia, Katharina Ermenger and Gregor Forschbach, Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany, Lodewijk Abspoel, Ministry for Infrastructure and Water Management, Netherlands. ESPON EGTC Michaela Gensheimer, Senior Project Expert, Johannes Kiersch, Financial Expert Version 20/02//2020 Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. -

Wirtschaftsstandort Landkreis Ostvorpommern
Wirtschaftsstandort LANDKREIS OSTVORPOMMERN 7%+! INFOI RMATIONSBROSCH¶REN &¶R+OMMUNEN ,ANDKREISE +LINIKEN )NDUSTRIE UND(ANDWERKSORGANISATIONEN "ILDUNGS UND INFORMATIV 3OZIALEINRICHTUNGEN &REMDENVERKEHRSVEREINE ODER5NTERNEHMENUNSERE0RODUKTESINDIMMER PRAKTISCH DASIDEALE-EDIUMF¶RFFENTLICHKEITSARBEIT ÎIM0RINT UND)NTERNETBEREICH AKTUELL 5NSEREBREITE0RODUKTPALETTEWIRDAUCH3IE KOMPETENT ¶BERZEUGEN)NDUSTRIE (ANDWERK (ANDEL UND$IENSTLEISTUNGNUTZENUNSERE"ROSCH¶REN KREATIV ALSOPTIMALE0LATTFORMF¶R5NTERNEHMENS PRSENTATIONEN SOLIDE 7IR¶BERZEUGENDURCH%RFAHRUNG 1UALITT FINANZIERT UNDMITGUTEN)DEEN5NDDASSEITMEHR ALS*AHREN 7%+!INFOVERLAGGMBH ,ECHSTRAEØ-ERING 4ELEFON % -AILINFO WEKA INFODE WWWWEKA INFODE Landkreis Ostvorpommern G r u ß w o r t G r e e t i n g „Gestatten Ostvorpommern“ “Introducing Ostvorpommern” Sehr geehrte Damen und Herren, Dear Sir or Madam, die aktuelle Broschüre „Wirtschaftsstandort Landkreis The idea behind this current “Ostvorpommern Rural District as Ostvorpommern“möchte Sie über die Wirtschaftsstruktur a Business Location” brochure is to give you information on and im Bereich Ostvorpommern informieren und interessie- arouse your interest in the economic structure of the Ostvorpom- ren. mern region. Für die Gemeinden und den Landkreis ist die wirt- The economic development of the Ostvorpommern region is of schaftliche Entwicklung der Region Ostvorpommern von primary importance to the municipalities and the rural district. Its erstrangiger Bedeutung. Wichtiges Planungsinstrument key planning instrument is the Regional