Synergiepotenzial Einer Fragmentierten Wasserwirtschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
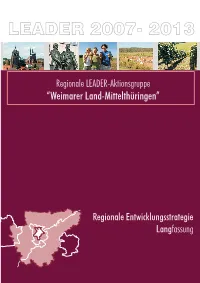
Regionale Entwicklungsstrategie Langfassung
LEADER 2007- 2013 Regionale LEADER-Aktionsgruppe “Weimarer Land-Mittelthüringen” Regionale Entwicklungsstrategie Langfassung r Regionale Entwicklungsstrategie der Region Weimarer Land - Mittelthüringen Regionale Entwicklungsstrategie der Region Weimarer Land - Mittelthüringen Inhaltsverzeichnis 1 Abgrenzung und Lage ....................................................................................... 5 1.1 Beteiligte Gebietskörperschaften ..................................................................................... 5 1.2 Begründung der Abgrenzung ........................................................................................... 6 2 Organisationsstruktur und Prozessorganisation ............................................ 8 2.1 Struktur und Eignung der RAG ........................................................................................ 8 2.2 Regionalmanagement...................................................................................................... 1 2.3 Methodik der Erarbeitung ................................................................................................ 1 3 Konsistenter Ansatz ........................................................................................... 4 3.1 Regionale Planungen ...................................................................................................... 4 3.2 Auswertung, Zusammenfassung und kritische Bewertung relevanter Planungen und Vorhaben für die Entwicklungsstrategie ..................................................................................... -

Ettersberg-Journal 04 2019
Amtsblatt der Landgemeinde Am Ettersberg - 1 - 1. Jahrgang · 4. Ausgabe · 01. April 2019 Ettersberg- Nördliches Journal Weimarer Land Amtsblatt der Landgemeinde Am Ettersberg Die nächste Ausgabe erscheint am: 02.05.2019 Redaktionsschluss: 12.04.2019 mit den Ortschaften: Berlstedt (mit Ortsteilen Hottelstedt, Ottmannshausen und Stedten a. E.), Buttelstedt (mit Ortsteilen Daasdorf, Nermsdorf und Weiden), Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Krautheim (mit Ortsteil Haindorf), Ramsla, Sachsenhausen, Schwerstedt, Vippachedelhausen (mit Ortsteil Thalborn), Wohlsborn erfüllende Gemeinde für: Ballstedt, Ettersburg, Stadt Neumark Landgemeinde Am Ettersberg . Berlstedt . Hauptstraße 23 . 99439 Am Ettersberg Homepage: www.vgnordkreis-weimar.de . Telefon: 036452 - 785-0 . E-Mail: [email protected] . Fax: 036452 - 785 - 21 Alle Ämter der Landgemeinde Am Ettersberg sind wie folgt geöffnet: dienstags 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr donnerstags 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr freitags 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr sowie an jedem ersten Samstag im Monat zusätzlich das Einwohnermeldeamt 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr IHRE ANSPRECHPARTNER: EINWOHNERMELDEAMT - Tel. 036452 - 785 - 26 - Fax: 78535 ERZIEHUNGSGELD/KITA’S - Tel. 036452 - 785-25 oder 785-23 (An-/Abmeldungen, Passwesen, pol. Führungszeugnis) (An-/Abmeldung Kita) E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] STANDESAMT - Tel. 036452 - 785-17 oder 785-27 BAUAMT - Tel. 036452 - 785-14 oder 785-28 (Eheschließungen, Geburtsurkunden, Sterbefälle) (Bauanträge, Straßenausbaubeiträge, Liegenschaften) E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] ORDNUNGSAMT - Tel. 036452 - 785-13 Kasse - Tel. 036452 - 785-22 oder 785-29 E-mail: [email protected] (Zahlungsverkehr, SEPA-Verfahren) E-mail: [email protected] VORSITZ/HAUPTAMT - Tel. -

Antwort Auf Die Kleine Anfrage 4125 Des Abgeordneten Kuschel DIE
THÜRINGER LANDTAG Drucksache 6/7884 6. Wahlperiode 30.10.2019 Kleine Anfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE) und Antwort des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales Struktur der Abwasserentsorgung in der Verwaltungsgemeinschaft "Grammetal" (Landkreis Weimarer Land) Die Kleine Anfrage 4125 vom 17. September 2019 hat folgenden Wortlaut: Laut § 2 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung sollen Gemeinden, die Mitglied einer Verwaltungsgemein- schaft sind oder für die eine erfüllende Gemeinde Aufgaben wahrnimmt, zur Gewährleistung der Aufgaben der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserbeseitigung und -reinigung einem Zweckverband nach dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit angehören. Laut einer Veröffentlichung auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft "Grammetal" strukturiert sich die Abwasserentsorgung der Mit- gliedsgemeinden wie folgt: Im Abwasserverband Grammetal sind die Gemeinden Hopfgarten, Mönchen- holzhausen mit Niederzimmern, Nohra Ortsteil Utzberg Verbandsmitglieder. Beim Abwasserbetrieb Weimar sind die Gemeinden Isseroda und Nohra mit Ortsteil Obergrundstedt und Ulla. Eigenstandorte sind dem- nach Bechstedtstraß, Daasdorf am Berge, Ottstedt am Berge und Troistedt. Die Verwaltungsgemeinschaft "Grammetal" wird gemäß des Beschlusses des Landtags vom 12. September 2019 über das Thüringer Ge- setz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 und zur Anpassung gerichts- organisatorischer Vorschriften in eine Landgemeinde umgewandelt. Die Verwaltungsgemeinschaft "Gram- metal" -

Ettersberg-Journal 03 2020
ETTERSBERG-JOURNAL Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg Gemeinde Am Ettersberg 2. Jahrgang · 3. Ausgabe · 3. März 2020 Der Geltungsbereich umfasst die Ortschaften: Berlstedt (mit Ortsteilen Hottelstedt, Ottmannshausen und Stedten a. E.), Nördliches Weimarer Land Buttelstedt (mit Ortsteilen Daasdorf, Nermsdorf und Weiden), Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Krautheim (mit Ortsteil Haindorf), Ramsla, Sachsenhausen, Schwerstedt, Vippachedelhausen (mit Ortsteil Thalborn), Wohlsborn erfüllende Gemeinde für: Gemeinde Ballstedt, Gemeinde Ettersburg, Stadt Neumark Aus dem Inhalt Amtlicher Teil 2/3 Ansprechpartner 4 Gemeinde 8 Ortschaften 10 selbständige Gemeinden Nichtamtlicher Teil 12 Gemeinde 14 Verbandsnachrichten 15 Schulen 16 Kitas/Feuerwehren 17 Nachrichten und Veranstaltungen Gemeinde/Ortschaften 24 selbständige Gemeinden 25 Kirchliche Nachrichten 27 Anzeigenteil Nächstes Amtsblatt erscheint: 02.04.2020 Redaktionsschluss: 17.03.2020 Kontakt für Beiträge: [email protected] Die Grundsatzfestlegungen zu Veröffentlichungen im Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg finden Sie auf unserer Internetseite www.am-ettersberg.de www.am-ettersberg.de Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg - 2 - 2. Jahrgang · 3. Ausgabe · 03. März 2020 ANSPRECHPARTNER GEMEINDE AM ETTERSBERG Berlstedt | Hauptstraße 23 | 99439 Am Ettersberg HINWEIS Telefon: 036452 - 785 - 0 [email protected] Fax: 036452 - 785 - 21 ist die Adresse, unter der Sie alle Schäden, Fax Einwohnermeldeamt: 036452 - 785 - 35 die Ihnen in Ihrer Ortschaft auffallen, Homepage: www.am-ettersberg.de direkt an den Bauhofleiter übermitteln können, E-Mail allgemein: [email protected] der Ihr Anliegen direkt an die Gemeindearbeiter weiter gibt. E-Mail Amtsblatt: [email protected] Z. B.: umgestürzte Bäume, Schäden an Straßenbeschilderungen E-Mail Meldung Schaden: [email protected] und Verkehrsanlagen, Schäden an Buswartehallen, Bürgermeister: Herr Thomas Heß Schäden an gemeindlichen Gebäuden 1. -

5. Wahlperiode Drucksache 5/8189 10.09.2014 Umsetzung Der EU
THÜRINGER LANDTAG Drucksache 5/ 5. Wahlperiode 8189 10.09.2014 K l e i n e A n f r a g e der Abgeordneten Schubert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und A n t w o r t des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz Umsetzung der EU-Richtlinie zum Lärmschutz Die Kleine Anfrage 4120 vom 24. Juli 2014 hat folgenden Wortlaut: Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm, die sogenannte EU-Umgebungslärmrichtlinie verfolgt die EU europaweit vergleich- bare Ansätze, Menschen vor Lärm zu schützen. Lärmschwerpunkte werden durch eine Kartierung erfasst. Kommunen stellen daraufhin unter Beteiligung der Öffentlichkeit Lärmaktionspläne auf. Die EU-Umge- bungslärmrichtlinie wurde durch Änderungen im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in deutsches Recht umgesetzt. In mehreren Stufen müssen danach der Lärm in Ballungsräumen und an Hauptverkehrs- straßen sowie Haupteisenbahntrassen erfasst und in der Folge Lärmaktionspläne aufgestellt werden. Bis zum 18. Juli 2013 mussten Gemeinden an Straßen mit über drei Millionen Fahrzeugen im Jahr Lärmakti- onspläne aufstellen. Ich frage die Landesregierung: 1. Welche Gemeinden müssen in Thüringen gemäß der 1. bzw. der 2. Stufe der EU-Umgebungslärmrichtlinie (§ 47d BImSchG) Lärmaktionspläne aufstellen (bitte auflisten)? 2. Wie groß ist die Anzahl - aufgeschlüsselt nach Gemeinden - von an Hauptverkehrsstraßen wohnenden Menschen, die gemäß der Lärmkartierung Lärm von 55 dB(A) in der Nacht ausgesetzt sind? 3. Wie viele Menschen konnten in welchen Gemeinden durch Maßnahmen der Lärmaktionspläne in welchem Umfang von Lärm entlastet werden (bitte auflisten)? 4. Wie viele und welche der in Thüringen zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen verpflichteten Gemeinden haben noch keine Lärmaktionspläne aufgestellt (bitte auflisten)? 5. -

Verwaltungsgemeinschaften, Städte, Gemeinden, Erfüllende Gemeinden, Landgemeinden Und Abwasserzweckverbände Im Kreis Weimarer Land
Verwaltungsgemeinschaften, Städte, Gemeinden, Erfüllende Gemeinden, Landgemeinden und Abwasserzweckverbände im Kreis Weimarer Land Stand: 11.03.2021 Postanschrift Struktur Bürgermeister/-in Stadt Apolda Rüdiger Eisenbrand Stadt Apolda - OT Herressen-Sulzbach Markt 1 - OT Nauendorf 99510 Apolda - OT Oberndorf - OT Oberroßla/Rödigsdorf - OT Schöten Tel.: 03644/6500 - OT Utenbach Fax: 03644/650400 - OT Zottelstedt E-Mail [email protected] Internet www.apolda.de Postanschrift Struktur Bürgermeister/-in Stadt Bad Berka Michael Jahn Stadt Bad Berka - OT Bergern Am Markt 10 - OT Gutendorf 99438 Bad Berka - OT Meckfeld - OT München - OT Schoppendorf Tel.: 036458/550 - OT Tannroda Fax: 036458/55155 - OT Tiefengruben E-Mail [email protected] Internet www.bad-berka.de Verwaltungsgemeinschaften, Städte, Gemeinden, Erfüllende Gemeinden, Landgemeinden und Abwasserzweckverbände im Kreis Weimarer Land Postanschrift Struktur Bürgermeister/-in Stadt Bad Sulza als Erfüllende Gemeinde Dirk Schütze für: Stadt Bad Sulza Eberstedt Hans-Otto Sulze Markt 1 Großheringen Jens Baumbach 99518 Bad Sulza - OT Kaatschen-Weichau Tel.: 036461/24100 Niedertrebra Jörg Geyer Fax.: 036461/24112 - OT Darnstedt Obertrebra Dieter Feldrappe E-Mail Rannstedt Horst Krocker [email protected] Schmiedehausen Bernd Otterstein - OT Lachstedt Internet: www.bad-sulza.de Stadt Bad Sulza als Landgemeinde Außenstelle Wormstedt OS Auerstedt (ehemals Saaleplatte) OS Bad Sulza OS Wormstedt OS Eckolstädt Im Unterdorf 110 OS Flurstedt 99518 Bad Sulza OS Gebstedt -

Gesetz- Und Verordnungsblatt Für Den Freistaat Thüringen
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen 2019 Ausgegeben zu Erfurt, den 27. Juni 2019 Nr. 7 Inhalt Seite 23.05.2019 Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thü- ringer Gemeindehaushaltsverordnung -ThürGemHV-)..................................................................... 153 29.05.2019 Dritte Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Vergütung für Hebammen- und Entbindungspfl egerhilfe außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung..................................... 174 14.05.2019 Thüringer Verordnung zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisation im Sektor Obst und Gemüse............................................................................................................................................. 176 18.05.2019 Zweite Verordnung zur Änderung der Thüringer Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbe- reich des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz ................................... 176 25.05.2019 Thüringer Verordnung über die Schiedsstelle nach § 36 des Pfl egeberufegesetzes (ThürSchiedsVO- Pfl BG)............................................................................................................................................ 188 15.05.2019 Verordnung zur Änderung der Thüringer Heilverfahrensverordnung und der Thüringer Trennungsgeld- verordnung.................................................................................................................................... 191 18.05.2019 Thüringer -

Validierung Des Zwischenberichts Teilgebiete Der Bundesgesellschaft Für Endlagerung Für Die Gebietsanteile Thüringens
Validierung des Zwischenberichts Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung für die Gebietsanteile Thüringens Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz Abteilung 8 Geologie und Bergbau Referat 81 Geologische Landesaufnahme, Geologisches Landesarchiv Stand 07.06.2021 Zusammenfassung Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat als Vorhabenträgerin für das Verfahren zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle den Zwi- schenbericht gemäß § 13 Abs. 2 S. 3 StandAG am 28.09.2020 veröffentlicht. In dem Bericht werden die Ergebnisse zur Ermittlung von Teilgebieten dargestellt, die im weiteren Standortauswahlverfahren als Suchraum verbleiben. Im Zwischenbericht Teilgebiete der BGE werden vier Teilgebiete ausgewiesen, die zum Teil in Thürin- gen liegen: für zwei der Teilgebiete werden Kristallingesteine als Wirtsgestein in Betracht gezogen, für zwei Teilgebiete Steinsalz in stratiformer Lagerung. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) wurde vom Thüringer Minis- terium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) am 13.10.2020 mit der Validierung des Zwi- schenberichts der BGE im Hinblick auf die für Thüringen relevanten Teilgebiete beauftragt. Nach erster Durchsicht und Stellungnahme durch das TLUBN im Januar 2021 stellt der vorliegende Bericht die Er- gebnisse der umfassenden fachlichen Prüfung des Zwischenberichts durch den Geologischen Dienst Thüringen dar. Die Anwendung der im Standortauswahlverfahren festgelegten Kriterien und Anforderungen -

Abwasserbeseitigungspflichtige Im Landkreis Weimarer Land
Abwasserbeseitigungspflichtige im Landkreis Weimarer Land Verwaltungseinheit Abwasserentsor- Ansprechpart- Tel.-Nr. (nach Alphabet) gung ner Apolda AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Auerstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Bad Berka ZV JenaWasser Herr Luthe 03641/688-548 Bad Sulza AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Ballstedt ANW Herr Scheide 036451/738788 Bechstedtstraß Eigenbetrieb Gemeinde 03643/83110 Grammetal Berlstedt ANW Herr Scheide 036451/738788 Blankenhain ZV JenaWasser Herr Luthe 03641/688-548 Buchfart Eigenbetrieb Gemeinde 03643/849151 Buttelstedt ANW Herr Scheide 036451/738788 Daasdorf am Berge Eigenbetrieb Gemeinde 03643/83110 Grammetal Döbritschen AM Herr Gedig 036453/82983 Eberstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Eckolstädt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Ettersburg ANW Herr Scheide 036451/738788 Flurstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Frankendorf AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Gebstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Großheringen AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Großobringen ANW Herr Scheide 036451/738788 Großromstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Großschwabhausen AM Herr Gedig 036453/82983 Gutendorf ZV JenaWasser Herr Luthe 03641/688-548 Hammerstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Heichelheim ANW Herr Scheide 036451/738788 Hermstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Hetschburg ZV JenaWasser Herr Luthe 03641/688-548 Hohenfelden AZVAU Herr Fidelak 03628/609-0 Hohlstedt AZV Apolda Herr Reuter 03644/5390 Hopfgarten AVG Frau Liesegang 036203/72533 Hottelstedt ANW Herr Scheide 036451/738788 Isseroda KS -

Kleine Anfrage 4125 Des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE)
THÜRINGER LANDTAG 17.09.2019 6. Wahlperiode Kleine Anfrage 4125 des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE) Struktur der Abwasserentsorgung in der Verwaltungs- gemeinschaft "Grammetal" (Landkreis Weimarer Land) Laut § 2 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung sollen Gemeinden, die Mit- glied einer Verwaltungsgemeinschaft sind oder für die eine erfüllende Gemeinde Aufgaben wahrnimmt, zur Gewährleistung der Aufgaben der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserbeseitigung und -reinigung einem Zweckverband nach dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit angehören. Laut einer Veröffentlichung auf der In- ternetseite der Verwaltungsgemeinschaft "Grammetal" strukturiert sich die Abwasserentsorgung der Mitgliedsgemeinden wie folgt: Im Abwas- serverband Grammetal sind die Gemeinden Hopfgarten, Mönchenholz- hausen mit Niederzimmern, Nohra Ortsteil Utzberg Verbandsmitglieder. Beim Abwasserbetrieb Weimar sind die Gemeinden Isseroda und Noh- ra mit Ortsteil Obergrundstedt und Ulla. Eigenstandorte sind demnach Bechstedtstraß, Daasdorf am Berge, Ottstedt am Berge und Troistedt. Die Verwaltungsgemeinschaft "Grammetal" wird gemäß des Beschlus- ses des Landtags vom 12. September 2019 über das Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften in eine Land- gemeinde umgewandelt. Die Verwaltungsgemeinschaft "Grammetal" und deren Mitgliedsgemeinden unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes. Ich frage die Landesregierung: 1. Mit welcher Begründung sind entgegen -

Synergiepotenzial Einer Fragmentierten Wasserwirtschaft
Synergiepotenzial einer fragmentierten Wasserwirtschaft Ein Beitrag zum Wert des Zusammenwirkens in fragmentierten Organisationsstrukturen der Wasserwirtschaft Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades "Doktor-Ingenieur" (Dr.-Ing.) an der Fakultät für Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar vorgelegt von Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.Ing. Univ. Holger Graetz aus Koblenz Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.Ing Hans Wilhelm Alfen (Mentor) Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Londong Univ.-Prof. Dr.-Ing. Robert Holländer Tag der Disputation: 18. Januar 2008 Impressum Schriftenreihe der Professur Betriebswirtschaftslehre im Bauwesen Herausgeber © Bauhaus-Universität Weimar Fakultät Bauingenieurwesen Professur Betriebswirtschaftslehre im Bauwesen Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hans Wilhelm Alfen Marienstraße 7a D – 99423 Weimar Telefon: +49 (0) 3643 58 4592 Autor Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Holger Graetz E-Mail: [email protected] Bezugsmöglichkeit Verlag der Bauhaus-Universität Weimar Fax: +49 (0) 3643 58 1156 E-Mail: [email protected] Druck docupoint Magdeburg GmbH Umschlaggestaltung Christian Mohr ISBN 978-3-86068-335-4 Diese Veröffentlichung steht online als Volltext im Publikationsportal der Bauhaus-Univerität Weimar unter folgender URL zur Verfügung: http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/2008/1290/ Die vorliegende Arbeit wurde durch die Friedrich-Naumann-Stiftung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der Bundesrepublik Deutschland gefördert. I Schlagworte Entscheidungshilfemodell, Entscheidungsträger, -

Amtsblatt 02/2021
AMTSBLATT 27. Jahrgang Ausgabe 31.03.2021 Nr. 02/21 DAS ERWARTET SIE IN DIESER AUSGABE: Amtlicher Teil Beschlüsse der IX. Sitzung des Kreistages vom 04.03.2021 ▲ Seite 4 Bekanntmachung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag ▲ Seite 12 Bekanntmachung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag ▲ Seite 14 Nichtamtlicher Teil Veröffentlichung der Benutzungs- entgelte im Rettungsdienst ▲ Seite 16 Informationen aus dem Ehrenamts- zentrum ▲ Seite 21 Bienensachverständige im Kreis Weimarer Land ▲ Seite 24 UNSER NEUES GESICHT... CORONA-BÜRGERTELEFON des Kreises Weimarer Land Nach gut einem Jahr intensiver Planungs- kation mit der Kreisverwaltung und sons- und Vorbereitungszeit steht das von Grund tigen Behörden sorgen. Montag bis Freitag: auf neu gestaltete Portal des Landratsam- 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr tes Weimarer Land den Bürgerinnen und Schneller ans Ziel kommen Bürgern sowie Interessierten zur Verfü- Einige Servicefunktionen sind bereits mit Telefon: 03644/540-912 gung. Vorausgegangen war ein vollständi- Start der neuen Homepage verfügbar. So ger Wechsel des behördlichen Auftritts, zu können Sie Termine in der Kfz-Zulas- dem auch die neugestaltete Webseite der sungsstelle schon seit Längerem online HINWEIS IN EIGENER SACHE Kreisverwaltung zählt. Der Webauftritt ist vereinbaren oder Ihr Wunschkennzeichen nun optisch ansprechend in einem moder- online beantragen. Oder wollen Sie online Alle hier veröffentlichten amtlichen nen Design gestaltet und gleichzeitig funk- eine Sperrmüllentsorgung beantragen? Be kanntmachungen erfolgen gemäß tionell