Mitläufer Oder "Nazi"?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Literaturübersicht Hochschulen Und Nationalsozialismus (PDF)
Michael Jung Literaturübersicht Hochschulen und Nationalsozialismus (Stand November 2020) Die Übersicht ist gegliedert in: A. Deutschland 1. (Ehemalige) Technische Hochschulen 2. Ehemalige Bergakademien 3. Universitäten (und weitere wissenschaftliche Hochschulen) B. Österreich, Schweiz, Norwegen (nur Technische Hochschulen/Bergakademie) Die Übersicht umfasst nur Veröffentlichungen, die sich mit einzelnen Hochschulen, ihren Instituten, Lehrenden, Studierenden und anderen Mitgliedern beschäftigen. Eine möglichst umfassende Auflistung ist dabei beabsichtigt, jedoch besteht insbesondere bei den Beiträgen in Sammelbänden und Zeitschriften kein Anspruch auf Vollständigkeit. Artikel in Massenpublikationen sind nicht berücksichtigt. Die einzelnen Abschnitte sind gegliedert nach Hochschulen in alphabetischer Reihenfolge und absteigendem Erscheinungsdatum der Veröffentlichungen. A. Deutschland 1. (Ehemalige) Technische Hochschulen: Aachen: Zur NS-Zeit der Hochschule im Internet: http://www.archiv.rwth-aachen.de/web/rea/Seite/geschichte_45.htm Richard Kühl, Leitende Aachener Klinikärzte und Ihre Rolle im "Dritten Reich". Kassel 2011. Stefan Krebs, Werner Tschacher, „Eine Art von Gewissenserforschung“? Konstruierte Brüche und Kontinuitäten an der Technischen Hochschule Aachen 1928 —1950. In: Noyan Dinckal, Christof Dipper, Detlev Mares (Hrsg.), Selbstmobilisierung der Wissenschaft. Technische Hochschulen im „Dritten Reich“. Darmstadt 2010. Ulrich Kalkmann, Die Technische Hochschule Aachen im Dritten Reich (1933–1945). Aachen 2003. Ulrich Kalkmann, -

Recent Developments of German Legal Philosophy: a Report and Appraisal (1964-1966)
RECENT DEVELOPMENTS OF GERMAN LEGAL PHILOSOPHY: A REPORT AND APPRAISAL (1964-1966) Karl Engisch* Translator's Preface* Fundamental German thought about law, appearing under the name of legal philosophy, has greatly influenced Anglo-American jurisprudential thought. In the present century several of our distinguished jurisprudents have derived stimulus from German legal philosophers, for example, Roscoe Pound from Josef Kohler and Julius Stone from Gustav Radbruch. Since Germany con- tinues to be one of those countries where jurisprudentialthought is cultivated in an outstanding manner, I have felt that it would render a service to the cultivation of the same thought in the English-speaking world if recent developments of German legal philosophy could be brought to the notice of our legal scholars. Since only a few articles and no books by present German legal philosophers have been translated into English, this object could be achieved to a degree by translating a report on German legal-philosophical literature into English. The author of this report is one of the most distinguished contemporary German legal philosophers. In this area, he is particularly distinguished in the field of legal logic and the methodology of legal science and renowned for his keen analyses and sober judgment. His re- ports on the subject are published biennially in the periodical Zeitschrift ffir die gesamte Strafrechtswissenschaft and the present report is the most recent of these. It appeared in 1967 in volume 78, No. 3 of that periodical (pp. 490-523). Hoping that this translation will serve a good purpose, I intend to continue making available in English his subsequent reports. -

The Renaissance of Natural Law and the Beginnings of Penal Reform in West Germany
Chapter 11 CRIMINAL LAW AFTER NATIONAL SOCIALISM The Renaissance of Natural Law and the Beginnings of Penal Reform in West Germany Petra Gödecke S The effort to achieve a comprehensive revision of the penal code had occupied German professors and practitioners of criminal law since the Kaiserreich.1 But the penal reform movement and the official reform commissions, which contin- ued all the way up to the Nazi regime’s penal reform commission under Justice Minister Franz Gürtner, remained unsuccessful. This chapter investigates when penal reform reappeared on the agenda of German criminal law professors after 1945 and what shape this new penal reform discourse took. The early postwar phase of the reform discourse had little influence on the comprehensive penal reform that was eventually passed in 1969 or on the revisions of laws on sexual offenses that took place from 1969 to 1973. But this early phase is of consider- able interest because it reveals the complex mix of continuity and change in a particular discipline at a moment of political rupture and because it reconstructs how a new reform discourse emerged under the influence of the experiences of the Nazi period and the social and cultural upheavals of the postwar era. This chapter begins with a brief overview of the penal code and of the situa- tion of academic criminal law at the universities around 1945. The next two sec- tions examine the debates on natural law and the question of why there were no efforts to completely revise the criminal code immediately after 1945. This issue leads into the following two sections, which explore the work situation, publica- tion venues, and professional meetings of legal academics in the field of criminal law after 1945. -

Dokument 1.Pdf
Jahrgang 43 | 2010 Herausgegeben von der Gießener Gießener Hochschulgesellschaft ISSN 0533-8689 Universitätsblätter Jahrgang 43 | 2010 Herausgegeben von der Gießener Hochschulgesellschaft Gießener Universitätsblätter Druck und Verlag: Brühlsche Universitätsdruckerei Gießen 001-004_Vorspann.indd 1 08.06.10 09:57 Wir danken allen Firmen, die unsere Förderbemühungen durch Anzeigenaufträge unterstützen. Unsere verehrten Leser bitten wir, die Anzeigen zu beachten. Inserenten: Karstadt Warenhaus GmbH Lehmanns Fachbuchhandlung Möbelstadt Sommerlad ovag Energie A. Ringel & Sohn GmbH & Co. KG Sparkasse Gießen Stadtwerke Gießen AG Abbildung auf der Umschlagseite: Theater mit Wolle. Bildmontage mit integrierten Kinderfotos, siehe Beitrag zu „imago2010“ (ab S. 113). Herausgeber Gießener Hochschulgesellschaft Schriftleitung Prof. Dr. Peter von Möllendorff Institut für Altertumswissenschaften Justus-Liebig-Universität Philosophikum I, Otto-Behaghel-Straße 10 G 35394 Gießen [email protected] Redaktion Dr. Angelika Müller-Scherf Postfach: Ludwigstraße 23 35392 Gießen Telefon 06409 804312 [email protected] Druck und Verlag Brühlsche Universitätsdruckerei Gießen ISSN 0533-8689 001-004_Vorspann.indd 2 08.06.10 09:57 Inhalt I. Berichte aus Universität und Stadt Bericht des Präsidenten der JLU ………………………………………………………………………………… 5 Bericht der Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen …………………………………………………………… 9 Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Vorstandsvorsitzenden der GHG …………………… 11 II. Wissenschaftliche -

International Student Guide
Akademisches Auslandsamt International Office international student guide STUDY LIFE STUDY LIFE EXPLORE GIESSEN EXPLORE GIESSEN Justus Liebig University Giessen The President Akademisches Auslandsamt · International Office Goethestr. 58 35390 Giessen [email protected] www.uni-giessen.de/cms/internationales Giessen, December 2014 Dear International Students, It is a great pleasure for me to welcome you to the city of Gies- sen and to our university – a university with a history of over 400 years and a university town with the highest ratio of stu- dents in Germany. We are particularly proud of our international outlook. Today, JLU is cooperating with some 215 selected universities in 28 European countries in the ERASMUS programme alone. In ad- dition, JLU maintains a strong network with strategic partners around the world to ensure that academic exchange and coop- eration take place at all levels throughout the university. This brochure contains a wealth of useful information about the city of Giessen as well as about the university and its or- ganisational structure. I hope that it answers most of the ques- tions you might be asking yourself before coming here. If you need further information on specific issues or personal advice, our International Office and your departmental supervisors will be only too pleased to help you. Apart from academic life, social life is a very important fac- tor when studying abroad. I therefore warmly recommend our intercultural meeting centre “Lokal International”, which is run 2 JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN by our International Office and the Studentenwerk Giessen, our local student services organisation. It is an excellent place to meet other students and to exchange views on academic and personal matters. -

Revolution Or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy Erik Wolf
Notre Dame Law School NDLScholarship Natural Law Forum 1-1-1958 Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy Erik Wolf Follow this and additional works at: http://scholarship.law.nd.edu/nd_naturallaw_forum Part of the Law Commons Recommended Citation Wolf, Erik, "Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy" (1958). Natural Law Forum. Paper 25. http://scholarship.law.nd.edu/nd_naturallaw_forum/25 This Article is brought to you for free and open access by NDLScholarship. It has been accepted for inclusion in Natural Law Forum by an authorized administrator of NDLScholarship. For more information, please contact [email protected]. REVOLUTION OR EVOLUTION IN GUSTAV RADBRUCH'S LEGAL PHILOSOPHY Erik Wolf SINcE GUSTAV RADBRUCH'S DEATH in 1949 there has been some discussion of whether his philosophical thinking remained in principle the same from the Grundziige der Rechtsphilosophie (1914) to the Vorschule der Rechts- philosophie (1948), or whether it underwent a drastic revolution or reform after 1945 which could properly be designated as "a substantial change in his point of view."' Some legal philosophers deny any and all development;2 others maintain that there was a decisive change. 3 The latter opinion is particularly important in that it is the thesis of a significant and compre- hensive study.4 The former view, however, which contests the suggestion that any such change ever took place, can appeal to a no less profound interpretation of Radbruch's legal philosophy. 5 As for the cause of this alleged revolution or reform we are referred not to any inner transformation in Radbruch himself, but to two external ex- periences: one in the realm of German political history, and the other in the realm of the history of ideas. -
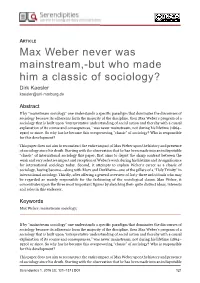
Max Weber Was Never Mainstream
ARTICLE Max Weber never was mainstream,-but who made him a classic of sociology? Dirk Kaesler [email protected] Abstract If by “mainstream sociology” one understands a specific paradigm that dominates the discourses of sociology because its adherents form the majority of the discipline, then Max Weber’s program of a sociology that is built upon “interpretative understanding of social action and thereby with a causal explanation of its course and consequences,” was never mainstream, not during his lifetime (1864– 1920) or since. So why has he become this overpowering “classic” of sociology? Who is responsible for this development? This paper does not aim to reconstruct the entire impact of Max Weber upon the history and presence of sociology since his death. Starting with the observation that he has been made into an indisputable “classic” of international sociology this paper, first aims to depict the sharp contrast between the weak and very selective impact and reception of Weber's work during his lifetime and its significance for international sociology today. Second, it attempts to explain Weber's career as a classic of sociology, having become—along with Marx and Durkheim—one of the pillars of a “Holy Trinity” in international sociology. Thirdly, after offering a general overview of forty-three individuals who may be regarded as mainly responsible for the fashioning of the sociological classic Max Weber, it concentrates upon the three most important figures by sketching their quite distinct ideas, interests and roles in this endeavor. Keywords Max Weber; mainstream sociology; If by “mainstream sociology” one understands a specific paradigm that dominates the discourses of sociology because its adherents form the majority of the discipline, then Max Weber’s program of a sociology that is built upon “interpretative understanding of social action and thereby with a causal explanation of its course and consequences,” was never mainstream, not during his lifetime (1864– 1920) or since. -

Juristische Hermeneutik Zwischen Vergangenheit Und Zukunft
Meder/Carlizzi/Mecke/Sorge (Hrsg.) Juristische Hermeneutik zwischen Vergangenheit und Zukunft Juristische Hermeneutik zwischen Vergangenheit und Zukunft • Meder u.a. (Hrsg.) Nomos Verlagsgesellschaft Stämpfli Verlag ISBN 978-3-8487-0050-9 ISBN 978-3-7272-7720-7 Nomos Stämpfli Verlag BUC_Meder_0050-9.indd 1 26.10.12 10:04 copyright NOMOS Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 STEPHAN MEDER Interpretation und Konstruktion. Zur juristischen Hermeneutik von Francis Lieber (1800-1872) 11 CHRISTOPH-ERIC MECKE „Regeln werden nur den Schwachköpfen dienen, um sie des eigenen Denkens zu überheben“ – Puchtas und Savignys juristische Hermeneutik im Vergleich 37 MARTIN AVENARIUS Universelle Hermeneutik und Praxis des Rechtshistorikers und Juristen. Die Entwicklung ihres Verhältnisses im Lichte der Diskussion zwischen Gadamer und Wieacker 59 GAETANO CARLIZZI Historische und theoretische Hauptfragen der „Gegenwärtigen Juristischen Hermeneutik“ 105 JOSÉ ANTONIO SEOANE Hermeneutik und Typus. Historische und systematische Bemerkungen 121 CHRISTOPH SORGE Zwischen Kritik, Konsens und Reflexion: Hermeneutisch-rhetorische Traditionen der Rechtsfindung 137 STEPHAN MEDER Zetetik versus Dogmatik? Eine Grundfrage der juristischen und theologischen Hermeneutik 225 Autorenverzeichnis 245 copyright NOMOS 5 copyright NOMOS Stephan Meder/Gaetano Carlizzi/ Christoph-Eric Mecke/Christoph Sorge (Hrsg.) Juristische Hermeneutik zwischen Vergangenheit und Zukunft Nomos Stämpfli Verlag copyright NOMOS Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8487-0050-9 (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden) ISBN 978-3-7272-7720-7 (Stämpfli Verlag, Bern) 1. Auflage 2013 © Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. -

Legal Certainty and Legal Methods: a European Alternative to American Legal Indeterminacy? James Maxeiner University of Baltimore School of Law, [email protected]
University of Baltimore Law ScholarWorks@University of Baltimore School of Law All Faculty Scholarship Faculty Scholarship Spring 2007 Legal Certainty and Legal Methods: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? James Maxeiner University of Baltimore School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarworks.law.ubalt.edu/all_fac Part of the International Law Commons, and the Legislation Commons Recommended Citation Legal Certainty and Legal Methods: A European Alternative to American Legal Indeterminacy?, 15 Tul. J. Int'l & Comp. L. 541 (2007) This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at ScholarWorks@University of Baltimore School of Law. It has been accepted for inclusion in All Faculty Scholarship by an authorized administrator of ScholarWorks@University of Baltimore School of Law. For more information, please contact [email protected]. Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? James R. Maxeiner' Americans are resigned to a high level oflegal indetenninacy. This Article shows that Europeans do not accept legal indetenninacy and instead have made legal certainty a general principle of their law. This Article uses the example ofthe German legal system to show how Gennan legal methods strive to realize this general European principle. It suggests that these methods are opportunities for Americans to develop their Ow.11 system to reduce legal indeterminacy and to increase legal certainty. I. LEGAL CERTAINTY IN EUROPE ......................................................... 545 A. Legal Certainty and the Fonnal Rule ofLaw ........................ 545 B. General Principles ofEuropean Union Law.......................... 547 C Legal Certainty as a General Principle ofEuropean Law .......................................................................................... 549 D. -

Einführung in Die Rechtstheorie Und Rechtslogik
Ludwig-Maximilians-Universität München - Juristische Fakultät - Einführung in die Rechtstheorie und Rechtslogik Sommersemester 2018 Prof. Dr. Dr. Jan-Hendrik Röver, LL.M. (LSE), FRSA 1 Teil 1: Einleitung Teil 2: Rechtstheorie § 1 Einführung § 2 Begriff und Geltung des Rechts § 3 Rechtsnorm § 4 Rechtssystem § 5 Rechtswissenschaft § 6 Gerechtigkeit und Rechtsnorm Teil 3: Rechtslogik § 7 Einführung § 8 Syllogistik: Grundlagen § 9 Syllogistik: Schlussfehler § 10 Aussagenlogik § 11 Deontische Logik 2 Einleitung 1 • Lernziele Übersicht über die Rechtstheorie und Rechtslogik Wissenschaftlicher Umgang mit Recht Definition: Wissenschaft ist jedes rational nachprüfbare Verfahren, das mit Hilfe bestimmter, am Gegenstand entwickelter Denkmethoden geordnete Erkenntnisse gewinnt Rechtstheorie steuert (im Zusammenspiel mit Rechtsphilosophie, juristischer Methodenlehre und anderen Grundlagenfächern) den Rechtsfindungsprozess durch rationale Regeln Vgl. auch Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen, Hamburg 9.11.2012 (Drs. 2558-12) (abrufbar unter „www.wissenschaftsrat.de“): „Die Rechtswissenschaft muss den inner- sowie interdisziplinären Austausch stärken, sich intensiver mit ihren Grundlagen befassen und thematisch wie personell vielfältiger werden.“ 3 Einleitung 2 • Rechtspraxis Notwendigkeit der Rechtstheorie ergibt sich (wie Methodenlehre) nicht zuletzt aus dem Willkürverbot, Art. 3 I GG und dem Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 III GG • Examensrelevanz Anleitung zum klaren Denken -

Pleading and Access to Civil Procedure: Historical and Comparative Reflections on Iqbal, a Day in Court and a Decision According to Law
Pleading and Access to Civil Procedure: Historical and Comparative Reflections on Iqbal, A Day in Court and a Decision According to Law James R. Maxeiner* Table of Contents I. INTRODUCTION ......................................................................... 1259 II. CIVIL PROCEDURE‟S CONSTITUTIONAL COMMITMENTS ......... 1260 A. “The civil justice system is . in serious need of repair” .............................................................................. 1261 B. Taking Advantage of What has been Done by the Civil Law ................................................................................... 1262 C. What of American Exceptionalism? .................................. 1264 III. PLEADING AND ACCESS TO CIVIL PROCEDURE ....................... 1265 A. The Purposes of Pleading and the Needs of Civil Procedure ......................................................................... 1266 B. What Law Applying Requires of Civil Procedure ............. 1267 C. The Limits of Pleading—The Interdependency of Law and Fact ............................................................................ 1268 D. Iqbal and the Limits of Pleading ....................................... 1269 IV. THREE AMERICAN SYSTEM FAILURES ..................................... 1270 A. Common Law Pleading ..................................................... 1271 B. Fact Pleading (Also Known as Code Pleading) ............... 1273 C. Notice Pleading: The Federal Rules of Civil Procedure of 1938 ............................................................................. -

Gießener Universitätsblätter 2010
Jahrgang 43 | 2010 Herausgegeben von der Gießener Gießener Hochschulgesellschaft ISSN 0533-8689 Universitätsblätter Jahrgang 43 | 2010 Herausgegeben von der Gießener Hochschulgesellschaft Gießener Universitätsblätter Druck und Verlag: Brühlsche Universitätsdruckerei Gießen 001-004_Vorspann.indd 1 08.06.10 09:57 Wir danken allen Firmen, die unsere Förderbemühungen durch Anzeigenaufträge unterstützen. Unsere verehrten Leser bitten wir, die Anzeigen zu beachten. Inserenten: Karstadt Warenhaus GmbH Lehmanns Fachbuchhandlung Möbelstadt Sommerlad ovag Energie A. Ringel & Sohn GmbH & Co. KG Sparkasse Gießen Stadtwerke Gießen AG Abbildung auf der Umschlagseite: Theater mit Wolle. Bildmontage mit integrierten Kinderfotos, siehe Beitrag zu „imago2010“ (ab S. 113). Herausgeber Gießener Hochschulgesellschaft Schriftleitung Prof. Dr. Peter von Möllendorff Institut für Altertumswissenschaften Justus-Liebig-Universität Philosophikum I, Otto-Behaghel-Straße 10 G 35394 Gießen [email protected] Redaktion Dr. Angelika Müller-Scherf Postfach: Ludwigstraße 23 35392 Gießen Telefon 06409 804312 [email protected] Druck und Verlag Brühlsche Universitätsdruckerei Gießen ISSN 0533-8689 001-004_Vorspann.indd 2 08.06.10 09:57 Inhalt I. Berichte aus Universität und Stadt Bericht des Präsidenten der JLU ………………………………………………………………………………… 5 Bericht der Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen …………………………………………………………… 9 Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Vorstandsvorsitzenden der GHG …………………… 11 II. Wissenschaftliche