Jahrbuch 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zabe Hilde BA-N HJ - BDM Gruppenführerin V Litochovicích O
Zabe Herta BA-N HJ - BDM (Untergauführerin Glaube u. Schönheit v Litochovicích o. Litoměřice); Zabe Hilde BA-N HJ - BDM Gruppenführerin v Litochovicích o. Litoměřice; Zabejschek Rosa, roz. Hanreich BA-N nar. 13. 3. 1914 Tracht b. Nikolsburg, bytem Schlock o. Bärn; učitelský ústav v Brně, učitelka; BdD, DKV, NSF, NSV (Hilfsstellenleiterin f. Mutter u. Kind), NSLB; Prameny: NA Praha 123 - 748 - 4; Zabel Alfred BA-N NSDAP (OG L v OG Nixdorf I. o. Rumburg); Prameny: NA Praha 123 - 769 - 6; Zabel Anton BA-N nar. 5. 3. 1886 Niedergrund b. Warnsdorf, bytem Rumburk; 1935 SdP č. 311 703, 1. 11. 1938 NSDAP č. 6 694 650 (15. IV. - XII. 1940 BL - Stellvertreter v OG Rumburg - Nord), NSV (Wirtschaftsleiter KLV Lager v Thamühl am See „Annahof“); Prameny: NA Praha 123 - 743 - 2; Zabel Josef BA-N nar. 18. 3. 1900 Krásná Lípa o. Rumburk, bytem tamtéž; dělník, topič; 1936 SdP, 1. 11. 1938 NSDAP (BL); Zabel Marianne BA-N NSDAP, NSF (Geschäftsführerin v KL tetschen); Prameny: NA Praha 123 - 772 - 4; Zabel Paul BA-N nar. 17. 1. 1899, bytem Rumburg; učitel; 1. 11. 1938 NSDAP č. 6 694 651 (OGS v OG Rumburg I. - Nord), SA Sturmmann; Prameny: NA Praha 123 - 783 - 3; Zaber Anton BA-N nar. 5. 12. 1889 Unterreichenau, bytem tamtéž; malíř a lakýrník, pensista; DNSAP, SA, NSDStB, NSV (od VII. 1939 BW v OG Untereichenau I. ); Zabotetsky Elsa BA-N nar. 9. 3. 1890, bytem Rumburk; 1. 11. 1938 NSDAP, Beauftragterin f. Haus - u. Volkswirtschaft; Zabotetsky Julius BA-N nar. 3. 9. 1883, bytem Rumburk; 1. -

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Uationalsozialistisclie deutsche Arbeiterpartei. Peidisgescltåstsstelle München Der Führer: Adolf Hitler zugleich Oberster SA.-Führer. Der chef der Kanzlel des 7äl1rers der USDAP. Der Peicltsorganisationslelter der UFDAP. und Reichsleiter Philipp Bouhler, Berlin W 8, Boßstraße l. Leiter der Deutschen Ärbeitsfrontr Die Kandel des Tülirers der UFDAP.: Reichsleiter Dr. Robert Leh, München, Barerstraße 15. Amt l. Persönliche Angelegenheiten des Führers und Hauptorganisationsamt — Qrganisationsleitung Sonderaufgaben. der Reichsparteitage — Hauplpersonalamt — Haupt- Amt ll. Bearbeitung von Eingaben, die die NSDAP., schulungsamt — Ordensburgen der NSDAP. — ihre Gliederungen und angeschlossenen Ber- Hauptamt NSBQ — Hauptamt für Handwerk und biinde, sowie die Stellen des Reiches und der Handel. Länder betreffen. Amt Ill. Bearbeitung von Gnadensachen von Ange- hörigen der Bewegung- Der Peitlissclratzmeister der UFDÄP·: Amth. Bearbeitung von sozialtvirtschaftlichen Ange- Reichsleiter Franz Xader Schwarz, München, Arri- legenheiten und Gesuchen sozialer Art- straße 10. Amt V. Personals und Berkoaltungsangelegenheiten Finanzoerroaltung Reichshaushaltamt Neichsrechnungsamt — Verwaltungsamt — Rechts- Der Stellvertreter cles Mitvers- amt — Reichsreoisionsamt —- Hilfskasse der NSDAP. Rudolf Heß, München, Braunes Haus,B1-ienner- Aeichszeugmeisterei Sonderbeaustragte des strasze 44. Reichsschatzmeisters. Die Peidtslelter der UFDAP.: Arnann Max, Reichsleiter der Presse· Der Peichspropaganclaleiter der UFDAP.: Bormann Martin, Stabsletter des Stellvertreters -

Séminaire De Budapest, 15-17 Avril 2004 Actes Seminar of Budapest
DGIV/EDU/MEM (2004) 19 prov. bil. Séminaire de Budapest, 15-17 avril 2004 Actes Seminar of Budapest, 15-17 April 2004 Proceedings The opinions expressed in this work are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe. All requests concerning the reproduction or translation of all or part of the document should be addressed to the Publishing Division, Communication and Research Directorate (F-67075 Strasbourg Cedex or [email protected]). All other correspondence concerning this publication should be addressed to the Directorate of school and higher education, Division for the European dimension of education. Les vues exprimées dans cet ouvrage sont de la responsabilité des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la ligne officielle du Conseil de l’Europe. Toute demande de reproduction ou de traduction de tout ou d’une partie du document doit être adressée à la Division des éditions, Direction de la communication et de la recherche (F-67075 Strasbourg ou [email protected]). Toute autre correspondance relative à cette publication doit être adressée à la Direction de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Division de la dimension européenne de l'éducation. © Council of Europe, December 2004 Table des matières/Contents Welcome speech by Walter Schwimmer ............................................... 5 Secretary General of the Council of Europe Welcome speech by Peter Medgyes..................................................... 9 Deputy State Secretary, Hungarian Ministry of Education „Kamocha, just like you” by Alfred Schöner......................................... 11 Rector of Jewish Theological seminary, University of Jewish Studies Les victimes de l’Holocauste par Jean-Michel Lecomte ...................... 15 Expert, membre du groupe de projet «Enseigner la mémoire» Persecution and Resistance of Jehovah’s Witnesses ........................ -

Chronologie >Hohe Schule< Der NSDAP
Gerd Simon unter Mitwirkung von Ulrich Schermaul und Matthias Veil Chronologie >Hohe Schule< der NSDAP Einleitung Zur Einschätzung der hier mitgeteilten Informationen s. http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HSText.pdf Zu einigen zentralen Dokumenten s. - Alfred Rosenberg: Die Hohe Schule der NSDAP und ihre Aufgaben: http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Ro_3706.pdf - Alfred Rosenberg: Denkschrift über die ersten Vorbereitungsarbeiten für die Hohe Schule: http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Ro_3805.pdf - Alfred Rosenberg: Denkschrift über die Aufgaben der Hohen Schule http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HSDok3809.pdf - [Alfred Baeumler?]: Grundlinien des Aufbaus der Hohen Schule: http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Bae.pdf - Kurt Wagner: Idee und Aufgabe der Hohen Schule http://homepages.uni-tuebingen/gerd.simon/HS_DS_Wa_4206.pdf Zu einzelnen Wissenschaftlern wie etwa dem Macher in der >Hohen Schule<, Kurt Wagner s. http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrWagnerKurt.pdf oder Otto Paul und zu der Zentralbibliothek der HS s. http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrPaulO.pdf Der Bestand BA NS 8 ist seit 9.11.2007 größtenteils im Facsimile online einsehbar : http://www.bundesarchiv.de/aktuelles/pressemitteilungen/00229/index.html Das trifft jedenfalls zu auf die zentral die >Hohe Schule< betreffenden Akten : NS 8/50 , NS 8/128 , NS 8/131 , NS 8/167 , NS 8/169 , NS 8/172 , NS 8/175 , NS 8/176 , NS 8/182 , NS 8/184 , NS 8/187 , NS 8/193 , NS 8/199 , NS 8/202 , NS 8/206 , NS 8/207 , NS Simon: Chronologie >Hohe Schule< der NSDAP 2 8/217 , NS 8/245 , NS 8/260 , NS 8/264 , NS 8/265 , NS 8/266 , NS 8/267, NS 8/268 , NS 8/274 , Der >Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg<, von dessen Kulturraub die >Hohe Schule< profi- tiert, wurde hier nur spärlich in Bezug auf die >Hohe Schule< ausgewertet. -

Oldest Holocaust Survivor Tells a Story of Faith and Courage That's out of the Ordinary Leopold Engleitner Endured the Holocaust
Books News The story of the oldest living Holocaust survivor Oldest Holocaust survivor tells a story of faith and courage that's out of the ordinary Leopold Engleitner endured the Holocaust. His long life since has inspired others. By November 30, 2008 edition By Isabelle de Pommereau Correspondent Frankfurt Leopold Engleitner’s blue eyes still burn bright. Last month, the 103-year-old traveled to Frankfurt, from his home in Austria to tell his story at the world’s largest publishing event. Mr. Engleitner, a former farmer from the Salzburg region, is a Jehovah’s Witness. And he is the oldest living survivor of the Holocaust. At first no one seemed interested in the facts of his life, which included an unwavering faith and enduring internments in the Buchenwald, Wewelsburg, and Ravensbrueck camps run by German Nazis. Then a young Austrian filmmaker met Engleitner by chance and ended up listening to his stories for hours on end. The filmmaker, Berhnard Rammerstorfer, was captivated by what he heard and eventually dropped everything he was doing to write Engleitner’s biography. “What impressed me was that a simple farmer had the courage to withstand Hitler, to refuse to go to war although millions of people did go to war, that he had the strength to adhere to his own conscience,” says Mr. Rammerstorfer. He first published “Unbroken Will: The Extraordinary Courage of an Ordinary Man,” in German in 1999. It was republished this year, and an English edition is scheduled to be released in 2009. Walter Manoschek, a political scientist at the University of Vienna who has worked on a project sponsored by the Austrian government to rehabilitate Austrian victims of the Nazi regime, says that Engleitner’s story brings to life one of the least-known groups of Nazi victims that also included Gypsies, homosexuals, political prisoners, and the mentally and physically disabled. -
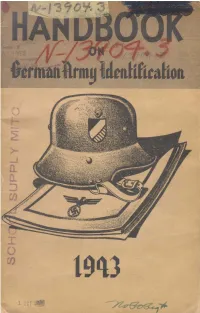
Handbook on German Army Identification
c rx . zt'fa. "r' w FOREWORD THIS HANDBOOK was prepared at the Military Intelligence Training Center, Camp Ritchie, Maryland, and is designed to provide a ready reference manual for intelligence person- nel in combat operations. The need for such a manual was so pressing that some errors and omissions are anticipated in the current edition. Any suggestions as to additions, or errors noted, should be reported directly to the Comman- dant, Military Intelligence Training Center, for correction in later editions. 513748 -- 43---1 HANDBOOK ON GERMAN ARMY IDENTIFICATION Left to right: Soldier (noncommissioned officer candidate-note silver cord across outer edge of shoulder strap), air force captain (belongs to staff, probably Air Ministry), SS Obergruppenfiihrer Josef Diet- rich (commander SS Division Adolf Hitler and chief of SS Oberabschnitt Ost), Hitler, Reichsfihrer SS Heinrich Himmler (head of the SS and German police). WAR DEPARTMENT, WASHINGTON, APRIL 9, 1943. HANDBOOK ON GERMAN ARMY IDENTIFICATION SECTION I. General. Paragraph Identification of German military and semi- military organizations --- ______ 1 II. German Order of Battle. Definition--___------------------------_ 2 Purpose and scope --- __ ___---- ----- 3 III. The German Army (Das Deutsche Heer). Uniforms and equipment-------_------- 4 German Army identifications of specialists - - 5 Colors of arms of service (Waffenfarbe) ___- _ _ 6 Enlisted men (Mannschaften)__ _____ 7 Noncommissioned officers (Unteroffiziere) .-- 8 Officers (Offiziere)--------------.--------- 9 German identification -

Die Polnischen Zeugen Jehovas Im KZ Ebensee Von Justyna Haas
Editorial Inhaltsübersicht Der Markt Ebensee wurde in den letzten Monaten mehrfach in der Editorial . .Seite 3 Presse erwähnt. Die Artikel und Kommentare bezogen sich zum einen auf den vorbildhaften Umgang mit seiner NS-Vergangenheit als ehe- maliger KZ-Standort, zum anderen jedoch auch auf rechtsextreme Florian Wenninger Verbindungen und Gewalt verherrlichende Videomitschnitte, die von Die Rettung des Vaterlandes oder Ebenseer Jugendlichen selbst angefertigt und auf der Videoplattform vom Wesen der „Reinen“ YouTube platziert worden waren. Tatsächlich existiert in Ebensee eine Demokratie . .Seite 4 Szene, die durch Auseinandersetzungen mit MigrantInnen und Schmieren von NS-Parolen aufgefallen war. Nach Hausdurchsuchun- gen wurden 3 Jugendliche zu gemeinnütziger Arbeit als Tatausgleich Befreiungsfeier der KZ-Gedenkstätte verurteilt, der Anführer, der auch Kontakte zur rechtsextremen Szene Ebensee . .Seite 10 in Deutschland hat, wartet auf freiem Fuß noch auf seine Verhand- lung. Eine andere Gruppe produzierte das mehrere Wochen im Inter- net kursierende Video (mit einschlägigem Hardcore als Hintergrund- Prato-Ebensee - ein europäisches Projekt musik), das junge Männer zeigt, die in Tarnkleidung mit Motorradhel- Rede von Claudio Martini . .Seite 11 men und Softguns Exekutionsszenen simulieren. Ehrlich irritiert rea- gierten Gemeindeverantwortliche und Lehrerschaft und eine Krisen- sitzung gemeinsam mit der Exekutive wurde einberufen. Im Zuge die- „Giving Memory a future“ . .Seite 13 ser Besprechung, an welcher Mag. Andreas Schmoller, der -

Einsicht 13 Bulletin Des Fritz Bauer Instituts
Einsicht 13 Bulletin des Fritz Bauer Instituts Endphasenverbrechen Fritz Bauer Institut und frühe Strafverfolgung Geschichte und MMitit BBeiträgeneiträgen vvonon SSvenven KKeller,eller, CClaudialaudia BBade,ade, Wirkung des Holocaust SSybilleybille SSteinbacher,teinbacher, DDanielaniel BBlatman,latman, EdithEdith RaimRaim Inwieweit hat die Shoah mit ihren Folgen, hat das Editorial Naziregime mit seinen Auswirkungen die Identitäten der dreißig Frauen und Männer geprägt, die in diesem Buch Einblick in ihre Lebensgeschichte geben? Worüber haben sie nachgedacht, als sie nach ihrer Identität gefragt wurden? Identität auch in dem Zusammenhang, unausweichlich durch die Herkunft an eine der beiden Seiten gebunden zu sein: Beidseits von Auschwitz. doch noch in die Hände der Wehrmacht oder SS fi elen. Claudia Bade Nachkommen von Verfolgten – Nachkommen von untersucht Denunziationen a m Kriegsende. Häufi ge Anlässe hierfür Verfolgern. waren »Rundfunkverbrechen« (das Abhören von »Feindsendern«) und der verbotene Umgang mit Kriegsgefangenen und ausländi- Auch wenn im Hinblick auf die Verfolgten und deren schen Zivil- und Zwangsarbeitern. Sybille Steinbacher beschreibt die Nachkommen die jüdische Seite hier im Fokus steht, Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. so wollten wir doch eine weitere Gruppe zu Wort Dieser Beitrag geht auf ihren Vortrag zum 70. Jahrestag der Befreiung kommen lassen. Es gelang uns, den Künstler Alfred Liebe Leserinnen und Leser, von Auschwitz am 27. Januar 2015 in der Goethe-Universität Frank- Ullrich, einen Sinto, dessen Mutter den Porajmos furt am Main zurück. Daniel Blatman befasst sich mit den Todesmär- (das „Große Verschlingen“) überlebt hat, für unser am 8. Mai 1945 endete mit der bedin- schen, auf die die SS die KZ-Häftlinge bei der Aufgabe der Lager gungslosen Kapitulation des Deutschen angesichts der näher rückenden feindlichen Truppen zwang. -

Grossdeutschland NSDAP Verbaende Und Reichsregierung
32 Gkoßdeutschrand. —» Die mer-AP- B".- Großdeutschland I- Aufbau der NationalsozialistischenzDeutschen Arbeiterpartei (NSDAP.), ihrer Gliederungen lind »der angeschlossenen -. « Verbände.. sz ’ « - 1. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Reichsgeschästsstelle München. Der Führers Adolf Hitler zugleich Oberster ·SA.-Führer· Der Chef der ännzlei des Führers der NSVAPsz und angeschlossenen Verbande sowie die Stellen des Reiches undder Länder betreffend. « Reichsleiter Bouhle r« Philipp, Berlin W 8, Voßstraße 4. « Amt III, Amtsleiter V e rt e n t a m p - Huberh Bearbeitung von Gnasdensachen von Angehöri- Die Kanzleides Führers der RSDAP gen der Bewegung . "- — Amt I, hauptamtsleiter B o rm anfn . Albert: Amt IV, Amtsleiter E n y rim, Heinz:« Bearbei- Persönliche Angelegenheiten des Führers und tung von sozialwirtschaftlichen Angelegenheiten Sonderaufgaben. « - - und Gesuchen sozialer Art. " Amt 11-, Amtsleiter Vrack Viktor: Bearbeitung Amt V, Amtsleiter Jaens ch herbei-t: Personal-» von Eingaben, die NSDAP., ihre Gliederungen Und Verwaltungsangelegenheiten. - Der Stellvertreter des Führers: · . Rudolf Heß.« München, Braunes Haus, Brienner-Straße 45. « Die Reichsleilung der ASDAP R o se n b e r g Alfred, Leiter des Außenpolitischsen Amtes der NSDAP· und Beauftragter des Die Reichsleiter: Führers für die· gesamte geistige und welt- Amann Max, Reichsleiter der Presse. · anschauliche Erziehung der NSDAP. ; Bormann Martin, Stabsleiter des Stellver- Schirach Baldur v., Reichsjugendsührer. treters des Führers. ·" « Schwarz Franz Xaver, Reichsschatzmeister. - «Bouhler Philipp, Chef der Kanzlei des Christians en Friedrich, Korpssührer des Führers. NSFK. J Buch Walter, Oberster Parteirichter. D ar rö Malta-, Leiter des .Reichsamtes für Der Reichsorganisaliansleiler »der "JISDAP. und Agrarpolitik. — « Leiter der Deutschen Arbeits-freut Dietrich Okto, «Dr.", Reichspressechef der Reichsleiter Dr. Robert Ley, München, Baker- NSDAP — straße 15. -
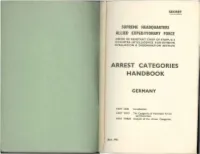
Arrest Categories Handbook
SECRET SUPREME HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY FORCE OFFICE OF ASSISTANT CHIEF OF STAFF, G-2 COUNTER-INTELLIGENCE SUB-DIVISION EVALUATION & DISSEMINATION SECTION ARREST CATEGORIES HANDBOOK GERMANY PART ONE Introduction. PART TWO The Categories of Automatic Arrest and Detention. PART THREE Analysis of the Arrest Categories. .April, 1945 2 3 the Interior, the Nazi Police are thoroughlv permeated by the SS. All person~el of the Gestapo are members o( the SS, and carry SS as PART ONE well as Police ran~; furthe_nnore, m_embership of the SS is a prerequisite for advancement m the Krzpo, and, m general, also in the Orpo. INTRODUCTION 5. Persons _will be subject to arrest: if they have at any time held a _rank or ap~mtment falling ·within the automatic arrest categories, 1. The object of this handbook is to enlarge on the categories with the followmg exceptions :- laid down in the Mandaton- Arrest Directive, and to assist Counter Intelligence staffs in carrying out the arrest policy. (a) Persons dismissed by the Xazis, on grounds of political unreliability 2. The handbook comprises :- (b) Persons who retired from such an appointment before 1933. (a) A statement of the categories included in the :\laudatory 6. The fact that a person does not fall within the automatic arrest Arrest Directi,·e categories does not exempt him from arrest if he is indiddually suspect. (b) A brief appreciation of each category, together with a detailed breakdown by rank and/or function of persons 7. It should be noted that feminine counterparts exist for many falling within the category. of the male ranks listed in PART THREE, especially in the Police and the Civil Service. -

Jahrbuch 2011
www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) Jahrbuch 2011 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) JAHRBUCH 2011 Schwerpunkt: Politische Verfolgung im Lichte von Biographien Redaktion: Christine Schindler Der Druck dieser Publikation wurde finanziell unterstützt durch: Arbeiterkammer Wien Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7 – Wissenschaft) Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Die Beiträge der einzelnen AutorInnen repräsentieren grundsätzlich deren Meinung. Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.d-nb.de abrufbar ISBN 978-3-901142-59-8 © Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien 2011 Herstellung: Plöchl Druck GmbH, A-4240 Freistadt Auslieferung: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wipplingerstraße 6-8 (Altes Rathaus) A-1010 Wien Tel. +43-1-22 89 469-319 Fax +43-1-22 89 469-391 e-Mail: [email protected] http://www.doew.at Inhalt – Jahrbuch 2011 www.doew.at Christine Schindler Redaktionelle Vorbemerkung 7 Barbara Prammer Rede anlässlich der Jahresversammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes am 9. März 2010, Altes Rathaus 13 Schwerpunkt Politische Verfolgung im Lichte von Biographien Stephan Roth „Mein Augenmerk war immer darauf gerichtet, mich nicht erwischen zu lassen, denn nur, wenn ich am Leben bliebe, konnte ich gegen Hitler kämpfen -

Das BVW Im Dritten Reich
Das BVW im Dritten Reich Statistiken, Strategien und Fallbeispiele aus der Zeit des Nationalsozialismus Als Adolf Hitler im Jahr 1933 an die Macht kam, Eine Standardablehnung geht heutzutage zwar nicht gab es rund fünfzig Firmen in Deutschland, die ein mehr davon aus, dass ausschließlich Männer Vor- Betriebliches Vorschlagswesen (BVW) hatten. Da- schläge einreichen und sie endet auch mit einer ande- ran hat sich auch bis 1939 kaum etwas geändert. ren Grußformel. Aber ansonsten sehen siebzig Jahre Doch vier Jahre später war diese Zahl auf das sie- danach bei vielen Firmen Ablehnungen fast genauso benhundertfache angewachsen. aus: nicht besonders fetzig, aber mit viel Empathie. Doch schauen wir uns zunächst einmal an, wie alles VON PETER KOBLANK begann. • Erste Anfänge des BVW • Briefkasten und Kommission Erste Anfänge des BVW • Fallbeispiel: BVW vor 1914 Alfred Krupp (1812-1887), der größ- • Problem mit dem Management te Waffenproduzent seiner Zeit, gilt • Drittes Reich - die ersten Jahre als der erste, der in Deutschland ein • BVW-Boom ab 1939 Betriebliches Vorschlagswesen ein- • Beteiligungsquote geführt hat.2 • Annahmequote und Nutzen Als Reaktion auf den ersten großen • Fallbeispiel: BVW-Einführung 1942 Massenstreik im Deutschen Reich • Fallbeispiel: Rekordjahr 1943 veröffentlichte Krupp 1872 ein Ge- • Göring-Speer-Verordnung neralregulativ, das der Belegschaft • Förderung des BVW durch die DAF der Firma Friedr. Krupp in Essen strenge Pflichten • DAF-Beauftragte für das BVW auferlegte, aber auch weitreichende Rechte und Sozi- • Meldepflicht