Des Reiches Strasse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Noah Gemeinde . Mein Praktikum in Der Noah Gemeinde Christuskirche Gitter/Hohenrode . Wegerneuerung Heilige Dreifaltigkeit
MÄRZ BIS JUNI 2020 Noah Gemeinde . Mein Praktikum in der Noah Gemeinde Christuskirche Gitter/Hohenrode . Wegerneuerung Heilige Dreifaltigkeit . Die Kontorei der Heiligen Dreifaltigkeit probt wieder St. Mariae-Jakobi . Besuch im Hospiz Salzgitter IMPRESSUM INHALT Grußwort 03 Ausgabe 24 März bis Juni 2020 Die Taufe - mehr als nur Wasser 04 Checkliste zur Taufe S.08 / Pfarrverband stärkt Ehrenamt? S.9 / · HERAUSGEBER Die evangelisch-lutherischen Ausstellung in Groß Flöthe S.9 / Vorankündigung für Pfingsten S. 9 / Kirchengemeinden in Salzgitter-Süd: Weltgebetstag 2020 S.10 / Ansprechpartner S.10 / Frauenhilfe Veranstaltungen S.11 / Noah-Gemeinde Christuskirche Gitter/Hohenrode Musikalische Veranstaltungen S.12 / Ökumene S.14 / Evangelische Jugend S.15 Heilige Dreifaltigkeit St. Mariae-Jakobi Gottesdienste 20 · DRUCK Gemeindebriefdruckerei 29393 Groß Oesingen Aus der Christuskirchengemeinde Gitter/Hohenrode 24 · LAYOUT Neues aus der Frauenhilfe S.24 / Posaunenchor Gitter auf Wandertour im Südharz S.25 / Astrid Schäfer, Salzgitter Krippenspiel 2019 S.26 / Wegerneuerung S.27 / Einladung Osterfrühstück S.27 / [email protected] Titelfoto: Finn Schäfer Freud und Leid S.27 / Ansprechpartner S.27 · ANZEIGENREDAKTION Birgit Holst, Salzgitter Aus der Gemeinde Noah 29 [email protected] Mein Praktikum in der Noah Gemeinde S.29 / Der neue Sozialdezernent zu Besuch S.29 / 0 53 41 / 3 68 35 Ulrike Schaare-Kringer, Salzgitter Neues aus der Rasselbande S.30 / Einladung vom Kita Elternchor S.30 / [email protected] Aktuelle Angebote des Familienzentrums KunterBund S.31 / · REDAKTIONSSCHLUSS Nachruf für Ursula Moldenhauer S.32 / Freud und Leid S.32 / Advent anders S.33 / für die nächste Ausgabe: 15.05.2020 Ansprechpartner S.33 · AUFLAGE 7920 Exemplare zur kostenlosen Verteilung Aus der Gemeinde St. -

Zeitumstellung Zur Sommerzeit Predigt Uwe Vetter Text: 1.Mose 32: 23-32 Vom Aufgang Der Sonne Kurzgefasste Theologie Der Morgenstund´
1 437 Laetare 26.März 2017 Leidenszeit: Zeitumstellung zur Sommerzeit Predigt Uwe Vetter Text: 1.Mose 32: 23-32 Vom Aufgang der Sonne Kurzgefasste Theologie der Morgenstund´ 1.Mose 32 23. Und Jakob stand auf / / in jener Nacht / / und nahm seine zwei Frauen / / und seine zwei Mägde / / und seine elf Söhne / / und überschritt die Furt des Jabboq. 24. / / Er nahm sie / / und führte sie über den Fluss . / / Auch all seine Habe brachte er hinüber. / / Jakob aber blieb allein zurück. 25. Da rang jemand mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 26. Als dieser jemand merkte, dass er den Jakob nicht überwältigen konnte, berührte er Jakobs Hüfte... 27. und ... sagte: „Lass mich los, die Morgenröte bricht an!“ – Jakob antwortete: „Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich! … 30. ... gib mir deinen Namen preis!“ – Der jemand erwiderte: „Was fragst du nach meinem Namen!“ Und er segnete den Jakob dort. 31. Da nannte Jakob die Stätte Pni-El, - ´Angesicht Gottes` - denn gesehen habe ich Gott von Angesicht zu Angesicht und gerettet hat sich meine Seele. 32. Und es ging ihm (!) die Sonne auf, als er an Pniel vorüber war; nur an seiner Hüfte hinkte er danach noch. Laetare ! Freut euch ! heißt dieser Sonntag. Freuen ?! Heute ?! werden sich einige beschweren. Wo wir letzte Nacht einen Alptraum erlebten: Zeitumstellung! Eine volle Stunde verloren! Um den Schlaf gebracht streicht man jetzt den ganzen Tag herum, übernächtigt, grau gesichtig, unwach und leidend… Das ist bedauerlich, denn heute ist der Sonntag, an dem die Passionszeit Pause macht: Unterbrechung der Fastenzeit. – Ich sehe, wir brauchen wir heute etwas Aufmunterndes für alle Verschlafenen. -

Erwin Und Elmire 1776 (70’)
Sound Reseach of Women Composers: Music of the Classical Period (CP 1) Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1739–1807 Erwin und Elmire 1776 (70’) Schauspiel mit Gesang nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe Erstveröffentlichung/First Publication erste vollständige szenische Aufführung am 25. Juni 2009 im Ekhof-Theater Gotha first complete scenic performance on June 25th 2009 at Ekhof-Theatre Gotha hrsg. von /edited by Peter Tregear Aufführungsmaterial leihweise / Performance material available for hire Personen Olympia: Sopran/Soprano Elmire: Sopran/Soprano Bernardo: Tenor oder/or Sopran/Soprano Erwin: Tenor oder/or Sopran/Soprano Orchesterbesetzung/Instrumentation 2 Flöten/2 Flutes 2 Oboen/2 Oboes Fagott/Bassoon 2 Hörner/2 Horns Violine 1/2 Viola Kontrabass Quelle: Anna Amalia Bibliothek, Weimar, Mus II a:98 (Partitur), Mus II c:1 (Vokalstimmen) © 2011 Furore Verlag, Naumburger Str. 40, D-34127 Kassel, www.furore-verlag.de Alle Rechte vorbehalten / Das widerrechtliche Kopieren von Noten wird privat- und strafrechtlich geahndet Printed in Germany / All rights reserved / Any unauthorized reproduction is prohibited by law Dieses Werk ist als Erstveröffentlichung nach §71 UrhG urheberrechtlich geschützt. Alle Aufführungen sind genehmigungs- und gebührenpflichtig. Furore Edition 2568 • ISMN: 979-0-50182-383-5 Inhalt/Contents Seite / Page Dr. Peter Tregear Erwin und Elmire – Eine Einführung 3 Professor Nicolas Boyle Goethes Erwin und Elmire in seiner Zeit 4 Dr. Lorraine Byrne Bodley Die Tücken des Musiktheaters: Anna Amalias -

Entautomatisierung 2017
Repositorium für die Medienwissenschaft Annette Brauerhoch, Norbert Otto Eke, Renate Wieser u.a. (Hg.) Entautomatisierung 2017 https://doi.org/10.25969/mediarep/3874 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Brauerhoch, Annette; Eke, Norbert Otto; Wieser, Renate u.a. (Hg.): Entautomatisierung. Paderborn: Fink 2017 (Schriftenreihe des Graduiertenkollegs "Automatismen"). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/3874. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-28545 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung 4.0/ Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Attribution 4.0/ License. For more information see: Auskünfte zu dieser Lizenz finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ BRAUERHOCH.qxd 21.05.14 09:47 Seite 1 In den bisherigen Bänden der Schriftenreihe »Automatismen« widmeten sich Forscher aus den Kulturwissenschaften, der Me- dienwissenschaft, Psychologie, Soziologie und der Informatik den Erscheinungsformen von Automatismen. Der neueste Band nähert sich ihnen aus der entgegengesetzten Perspektive der Ent- UNIVERSITÄT PADERBORN UNIVERSITÄT automatisierung und ihrer Bedeutung für die Veränderung eta- · blierter Strukturen. Die Beiträge fragen u.a., ob und inwiefern Entautomatisierung mit der strukturbildenden Funktion von Automatismen zusammen- hängt, ob und welche geregelte Rolle Zäsuren und Singularitäten in beider Beziehung spielen oder ob sich Momente der Entau - tomatisierung subjektiv verorten lassen. Mit Beiträgen von Amy Alexander, Christopher Balme, Annette Brauerhoch, Heike Derwanz, Martin Doll, Norbert Otto Eke, Lioba Foit, Ute Holl, Timo Kaerlein, Irina Kaldrack, Carmin ENTAUTOMATISIERUNG Karasic, Laura U. Marks, Dieter Mersch, Michaela Ott, Drehli Robnik, Chris Tedjasukmana, Renate Wieser und Anke Zechner. -

Chemical Innovation in Plant Nutrition in a Historical Continuum from Ancient Greece and Rome Until Modern Times
DOI: 10.1515/cdem-2016-0002 CHEM DIDACT ECOL METROL. 2016;21(1-2):29-43 Jacek ANTONKIEWICZ 1* and Jan ŁAB ĘTOWICZ 2 CHEMICAL INNOVATION IN PLANT NUTRITION IN A HISTORICAL CONTINUUM FROM ANCIENT GREECE AND ROME UNTIL MODERN TIMES INNOWACJE CHEMICZNE W OD ŻYWIANIU RO ŚLIN OD STARO ŻYTNEJ GRECJI I RZYMU PO CZASY NAJNOWSZE Abstract: This monograph aims to present how arduously views on plant nutrition shaped over centuries and how the foundation of environmental knowledge concerning these issues was created. This publication also presents current problems and trends in studies concerning plant nutrition, showing their new dimension. This new dimension is determined, on one hand, by the need to feed the world population increasing in geometric progression, and on the other hand by growing environmental problems connected with intensification of agricultural production. Keywords: chemical innovations, plant nutrition Introduction Plant nutrition has been of great interest since time immemorial, at first among philosophers, and later among researchers. The history of environmental discoveries concerning the way plants feed is full of misconceptions and incorrect theories. Learning about the multi-generational effort to find an explanation for this process that is fundamental for agriculture shows us the tenacity and ingenuity of many outstanding personalities and scientists of that time. It also allows for general reflection which shows that present-day knowledge (which often seems obvious and simple) is the fruit of a great collective effort of science. Antiquity Already in ancient Greece people were interested in life processes of plants, the way they feed, and in the conditions that facilitate or inhibit their growth. -

Pedigree of the Wilson Family N O P
Pedigree of the Wilson Family N O P Namur** . NOP-1 Pegonitissa . NOP-203 Namur** . NOP-6 Pelaez** . NOP-205 Nantes** . NOP-10 Pembridge . NOP-208 Naples** . NOP-13 Peninton . NOP-210 Naples*** . NOP-16 Penthievre**. NOP-212 Narbonne** . NOP-27 Peplesham . NOP-217 Navarre*** . NOP-30 Perche** . NOP-220 Navarre*** . NOP-40 Percy** . NOP-224 Neuchatel** . NOP-51 Percy** . NOP-236 Neufmarche** . NOP-55 Periton . NOP-244 Nevers**. NOP-66 Pershale . NOP-246 Nevil . NOP-68 Pettendorf* . NOP-248 Neville** . NOP-70 Peverel . NOP-251 Neville** . NOP-78 Peverel . NOP-253 Noel* . NOP-84 Peverel . NOP-255 Nordmark . NOP-89 Pichard . NOP-257 Normandy** . NOP-92 Picot . NOP-259 Northeim**. NOP-96 Picquigny . NOP-261 Northumberland/Northumbria** . NOP-100 Pierrepont . NOP-263 Norton . NOP-103 Pigot . NOP-266 Norwood** . NOP-105 Plaiz . NOP-268 Nottingham . NOP-112 Plantagenet*** . NOP-270 Noyers** . NOP-114 Plantagenet** . NOP-288 Nullenburg . NOP-117 Plessis . NOP-295 Nunwicke . NOP-119 Poland*** . NOP-297 Olafsdotter*** . NOP-121 Pole*** . NOP-356 Olofsdottir*** . NOP-142 Pollington . NOP-360 O’Neill*** . NOP-148 Polotsk** . NOP-363 Orleans*** . NOP-153 Ponthieu . NOP-366 Orreby . NOP-157 Porhoet** . NOP-368 Osborn . NOP-160 Port . NOP-372 Ostmark** . NOP-163 Port* . NOP-374 O’Toole*** . NOP-166 Portugal*** . NOP-376 Ovequiz . NOP-173 Poynings . NOP-387 Oviedo* . NOP-175 Prendergast** . NOP-390 Oxton . NOP-178 Prescott . NOP-394 Pamplona . NOP-180 Preuilly . NOP-396 Pantolph . NOP-183 Provence*** . NOP-398 Paris*** . NOP-185 Provence** . NOP-400 Paris** . NOP-187 Provence** . NOP-406 Pateshull . NOP-189 Purefoy/Purifoy . NOP-410 Paunton . NOP-191 Pusterthal . -
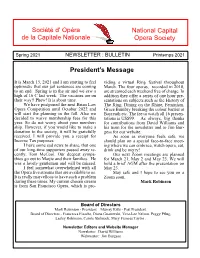
Spring 2021 NEWSLETTER : BULLETIN Printemps 2021 President’S Message
Société d' Opéra National Capital de la Capitale Nationale Opera Society Spring 2021 NEWSLETTER : BULLETIN Printemps 2021 President’s Message It is March 15, 2021 and I am starting to feel viding a virtual Ring festival throughout optimistic that our jail sentences are coming March. The four operas, recorded in 2018, to an end. Spring is in the air and we saw a are streamed each weekend free of charge. In high of 16 C last week. The vaccines are on addition they offer a series of one hour pre- their way!! Phew! It is about time. sentations on subjects such as the History of We have postponed the next Brian Law The Ring, Dining on the Rhine, Feminism, Opera Competition until October 2022 and Grace Bumbry breaking the colour barrier at will start the planning in the fall. Also we Bayreuth etc. The fee to watch all 16 presen- decided to waive membership fees for this tations is US$99. As always, big thanks year. So do not worry about your member- for contributions from David Williams and ship. However, if you would like to make a his team for the newsletter and to Jim Bur- donation to the society, it will be gratefully gess for our website. received. I will provide you a receipt for As soon as everyone feels safe, we Income Tax purposes. should plan on a special face-to-face meet- I have some sad news to share, that one ing where we can embrace, watch opera, eat, of our long-time supporters passed away re- drink and be merry! cently, Tom McCool. -

Der Weltgeist Von Weimar Das Wissen Die Literatur Bescherte Der Stadt Inneren Reichtum, Konnte Aber Äußere Katastrophen Nicht Verhindern Der Zeit
Raritäten Die Herzogin Die Bibliothek besitzt SONDERAUSGABE Auf Anna Amalias kostbare Handschriften, Spuren durch Weimar Bibeln und Globen S.8/9 Herzogin Anna Amalia Bibliothek spazieren S.19 WWW.WELT.DE OKTOBER 2007 EDITORIAL Der Weltgeist von Weimar Das Wissen Die Literatur bescherte der Stadt inneren Reichtum, konnte aber äußere Katastrophen nicht verhindern der Zeit Am 2. September 2004 brannten Teile T Von Dieter Stolte der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar aus. Rund 50 000 Bücher ibliotheken sind das Wissen wurden zerstört. Drei Jahre dauerten der Zeit. Ihre Geschichte die Wiederaufbauarbeiten. Am 24. Ok- begann im 1. Jahrtausend tober 2007 kann das historische Bvor Christus, als der Assyrer- Bibliotheksgebäude mit dem restau- könig Assurbanipal in Ninive rierten Rokokosaal eröffnet werden. 5000 Keilschrifttafeln zusammen- trug. Sie überlebten den Zusam- T Von Wolf Lepenies menbruch seines Reiches und können noch heute im Britischen nna Amalia, Herzogin von Museum studiert werden. So Sachsen-Weimar-Eisenach, erging es vielen Bibliotheken des starb am 10. April 1807. In Altertums: Trotz Naturkatastro- Weimar hielt zu ihrem „fei- phen, Feuersbrünsten und Plün- erlichsten Andenken“ Goe- derungen überlebten sie, blieben Athe die Ansprache. Er erinnerte Zeugnisse der Menschheit. Ins- an die Fürstin als eine große Frau, besondere die Klöster erwarben die dem „übrigen Menschenge- sich große Verdienste bei der schlecht“ ein Beispiel für „Stand- Pflege von Bibliotheken. Die Höfe haftigkeit im Unglück und teil- der Fürsten machten sie im 17. nehmendes Wirken im Glück“ ge- und 18. Jahrhundert zum Mittel- geben hatte. punkt geistiger Begegnungen. Wo Standhaftigkeit benötigte Anna es Bibliotheken gab, wehte als- Amalia vor allem im Siebenjähri- bald ein Geist des Wissens und gen Krieg (1756–1763): Die Staats- Verstehens. -

Anna Amalia Herzogin Von Sachsen-Weimar-Eisenach
Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach Orte und Länder Aufgewachsen am Braunschweig-Wolfenbüttler Hof, seit ihrer Vermählung mit Herzog Ernst August II. Constan- tin von Sachsen-Weimar-Eisenach im Jahr 1756 in Wei- mar ansässig. Biografie Als fünftes von dreizehn Kindern des Herzogs Carl I. und Philippine Charlotte, geb. Prinzessin von Preußen am 24. 10. 1739 in Wolfenbüttel geboren. Umfassende Ausbil- dung in allen geistes- und naturwissenschaftlichen Fä- chern, daneben besonders ambitionierte Unterweisung im Tanzen, Klavier-, Traversflöten-, Harfenspiel und in der Komposition. Nach ihrer Eheschließung mit Herzog Ernst August II. Constantin von Sachsen-Weimar-Eise- nach (1756) Übersiedelung nach Weimar. Nach dem Tod des Gatten 1758 vormundschaftliche Regentin und bis zur Regentschaftsübernahme ihres Sohnes Carl August (1775) Durchsetzung eines eigengeprägten Hofkonzepts Herzogin Anna Amalia von Georg Melchior Kraus (Öl auf („Weimarer Musenhof“). Sie setzte sich mit einer geziel- Leinwand), 1774 ten Personalpolitik, mit der sie Dichter wie Johann Carl August Musäus (ab 1763), ab 1772 Christoph Martin Wie- Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar- land zu den Erziehern ihrer Söhne machte, ab 1775 Jo- Eisenach hann Wolfgang Goethe und wenig später Johann Gottf- Geburtsname: Anna Amalia Prinzessin von ried Herder an sich band und Musiker wie Ernst Wil- Braunschweig-Wolfenbüttel helm Wolf, Carl Friedrich Freiherr von Seckendorff oder die Sängerin Corona Schröter in ein umfassendes Pro- * 24. Oktober 1739 in Wolfenbüttel, gramm integrierte, für Wissenschaft, Literatur, bildende † 10. April 1807 in Weimar, Kunst und Musik ein und hatte an allen Bereichen selbst aktiven Anteil. Ihr kompositorisches Œuvre umfasst Fürstin, Begründerin des Weimarer Musenhofs, Kammermusik und musikdramatische Werke (s.u.). -

300 Jahre St. Petersburg – Russland Und Die "Göttingische Seele"
1 Göttinger Bibliotheksschriften 22 2 3 300 Jahre St. Petersburg Russland und die „Göttingische Seele“ Ausstellung in der Paulinerkirche Göttingen unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Johannes Rau und dem Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin Herausgegeben von Elmar Mittler und Silke Glitsch Göttingen 2004 4 Gefördert durch © Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 2003 3., erneut durchgesehene Auflage 2004 Umschlag: Ronald Schmidt, AFWK • Layout: Jan-Jasper Fast, SUB Digital Imaging: Martin Liebetruth, GDZ • Tobias Möller, SUB Assistenz Textredaktion: Yvonne Hartmann-Barbaro, SUB Satz: Michael Kakuschke, SUB • Einband: Burghard Teuteberg, SUB ISBN 3-930457-29-6 ISSN 0943-951X 5 Inhalt Zum Geleit Lutz Stratmann ............................................................................. 9 Dominik Freiherr von König ......................................................... 10 Horst Kern ................................................................................. 12 Elmar Mittler .............................................................................. 13 Russland und die „Göttingische Seele“ Silke Glitsch, Reinhard Lauer ....................................................... 15 300 Jahre St. Petersburg von Peter Hoffmann .................................................................... 19 Exponate ................................................................................... 34 Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert – Göttingen und St. Petersburg. -

ºthe Principles of Rational Agricultureº by Albrecht Daniel Thaer (1752±1828)
J. Plant Nutr. Soil Sci. 2003, 166, 687±698 DOI: 10.1002/jpln.200321233 687 ºThe principles of rational agricultureº by Albrecht Daniel Thaer (1752±1828). An approach to the sustainability of cropping systems at the beginning of the 19th century Christian L. Feller1*, Laurent J.-M. Thuris1,2, Raphal J. Manlay1, Paul Robin3, and Emmanuel Frossard4 1 Institut de Recherche pour le DØveloppement (IRD), Laboratory MOST (Organic Matter in Tropical Soils), BP 64501, F-34394 Montpellier Cedex 5, France 2 Phalippou-Frayssinet SA, Organic Fertilizers, La Mothe, F-81240 Rouairoux, France 3 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), UMR 1123-System, Cirad-Lavalette, TA 179/01, F-34395 Montpellier Cedex 5, France 4 Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Institute of Plant Sciences, Group of plant nutrition, P.O. Box, Eschikon 33, CH-8315 Lindau, Switzerland Accepted 13 October 2003 Summary ± Zusammenfassung The identification of quantitative fertility indicators for evaluatingthe sustainability of croppingand farmingsystems has become a major issue . This question has been extensively studied by the German agronomist Albrecht Daniel Thaer at the beginning of the 19h century. In this paper Thaer's work is set in its historical background, from the end of the 16th century (Palissy, 1580) to the middle of the 19th century (Liebig, 1840). Then the paper focuses on Thaer's quantitative and complex fertility scale (expressed in ªfertility degreesº), which was based on soil properties, on the requirement of nutrients by plants, and on the croppingsystem (includingcrop rotation). Thaer expressed soil fertility and economic results as a function of rye production in ªscheffel of rye per journalº (ca. -

Goethe's Urfaust and the Enlightenment
Goethe’s Urfaust and the Enlightenment: Gottsched, Welling and the “Turn to Magic” By Copyright 2014 James Michael Landes Submitted to the graduate degree program in Germanic Languages and Literatures and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson Professor Leonie Marx ________________________________ Co-Chairperson Professor Frank Baron ________________________________ Professor Maria Carlson ________________________________ Professor William Keel ________________________________ Professor Per Øhrgaard Date Defended: 10 March 2014 The Dissertation Committee for James Michael Landes certifies that this is the approved version of the following dissertation: Goethe’s Urfaust and the Enlightenment: Gottsched, Welling and the “Turn to Magic” ________________________________ Chairperson Professor Leonie Marx ________________________________ Co-Chairperson Professor Frank Baron Date approved: 10 March 2014 ii Abstract The Urfaust, composed in the early 1770s, is the first draft of Johann Wolfgang von Goethe’s (1749-1832) masterpiece, Faust, Teil I (1808). While this early draft is relatively unexamined in its own right, an examination of this work in the context of its original creation offers insights into Goethe’s creative processes at the time in relation to the Enlightenment poetic debates of the eighteenth century, through which literary critics, such as J.C. Gottsched (1700-1766) attempted to define the rules by which poetic construction should operate. In examining the Urfaust, one can see how Goethe’s poetic aims transcended those of the Enlightenment debate, going far beyond the Enlightenment critics of Gottsched, such as J.J. Bodmer (1698-1783) and J.J. Breitinger (1701-1776) in making the case for additional room for the fantastic in poetic construction.