213836 UG.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
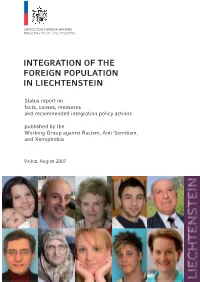
Integration of the Foreign Population in Liechtenstein
OFFICE FOR FOREIGN AFFAIRS PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN INTEGRATION OF THE FOREIGN POPULATION IN LIECHTENSTEIN Status report on facts, causes, measures and recommended integration policy actions published by the Working Group against Racism, Anti-Semitism, and Xenophobia Vaduz, August 2007 Source: Office of Equal Opportunity, Vaduz. Photographer: Ingrid Delacher, blusky.li. Integration in Liechtenstein TABLE OF CONTENTS INDEX OF TABLES AND FIGURES 6 INTRODUCTION 7 SUMMARY 10 PART I: INTEGRATION POLICY 14 1 Goals and content of integration policy 14 1.1 Government Policy Paper on Integration Policy 14 1.2 Non-discriminatory treatment of foreigners 16 2 Legal framework of integration policy 17 2.1 Integration and non-discrimination 17 2.2 Temporary and permanent residence, naturalization 19 3 Competences and instruments for the promotion of integration 22 3.1 Office of Equal Opportunity, commissions, and working groups 22 3.2 Offices of the National Administration 23 3.3 Police, Office of the Public Prosecutor, and Probation Service 24 3.4 Municipalities 24 3.5 Non-governmental organizations 24 PART II: FOREIGNERS IN LIECHTENSTEIN 26 4 Overview data on the foreign population 26 4.1 Share of foreigners 26 4.2 Sociodemographic characteristics 28 4.3 Length and status of stay 29 4.4 Data on crime perpetrated by the foreign population 30 5 Asylum 31 5.1 Asylum procedure and competences 31 5.2 Asylum seekers and provisionally admitted persons 32 5.3 Admission on humanitarian grounds, persons in need of protection, and refugees 35 6 Attitudes -

400 Jahre Kauf Schädlersboden Herausgeber Alpgenossenschaft Kleinsteg
400 Jahre Kauf Schädlersboden Herausgeber Alpgenossenschaft Kleinsteg Autoren Christoph Beck, Peter Beck, Stephan Beck, Mario F. Broggi, Helmuth Frick, Rainer Lampert, Norman Nigsch, Jürgen Schindler, Hugo Sele Bilder Peter Beck, Stephan Beck, Josef Eberle, Franz Gassner, Norman Nigsch, Martin Walser, Gemeindearchiv Gestaltung Franz Gassner Lektorat Josef Eberle, Jürgen Schindler Druck BVD Druck + Verlag AG 400 Jahre Kauf Schädlersboden Inhaltsverzeichnis 2 Vorwort Stephan Beck, Präsident Alpgenossenschaft Kleinsteg 3 Grussworte Christoph Beck, Gemeindevorsteher 4 Zusammenfassung der Kaufurkunde aus dem Jahr 1615 Jürgen Schindler, Gemeidearchivar 6 Vom Schädlersboden zum Maiensäss und zur Alpgenossenschaft Kleinsteg Peter Beck, Genossenschafter 20 Die Alpgenossenschaft Kleinsteg heute Stephan Beck, Präsident Alpgenossenschaft Kleinsteg 32 Das rechtliche Umfeld der Alpgenossenschaft Kleinsteg Hugo Sele und Rainer Lampert, Genossenschafter und Rechtsanwälte 44 Der Wald der Alpgenossenschaft Kleinsteg Norman Nigsch 50 Die Alpwirtschaft im Wandel Helmuth Frick 56 Natur und Landschaft im Kleinsteg – mit welcher Zukunft? Mario F. Broggi 66 Zahlen und Fakten rund um die Alpgenossenschaft Kleinsteg 68 Verzeichnis der Genossenschafter 70 Der Alpausschuss 1943 bis 2015 72 Bodenbedeckung und Holznutzung (1979 bis 2014) «Wir sind stolz auf 609 Jahre gemeinschaftliche und identitätsstiftende Tätigkeit.» tionen der Betroffenen auf Gemeinde- oder genos senschaftlicher Ebene›. Das heute oft bemängelte Sozialkapital unserer Gesellschaft und der Mangel -

88.701 Skibus Schaanwald - Malbun (Linie B) Stand: 27
FAHRPLANJAHR 2021 88.701 Skibus Schaanwald - Malbun (Linie B) Stand: 27. Oktober 2020 87000 87002 87001 Schaanwald, Zollamt 08 10 12 10 Malbun, Jöraboda 16 05 Schaanwald, Zuschg 08 11 12 11 Malbun, Bergbahnen 16 10 Schaanwald, Waldstrasse 08 12 12 12 Malbun, Schneeflucht 16 12 Schaanwald, Industrie 08 13 12 13 Malbun, Jugendheim 16 12 Mauren FL, Ziel 08 13 12 13 Steg FL, Hotel 16 17 Mauren FL, Freihof 08 14 12 14 Steg FL, Tunnel 16 18 Mauren FL, Post 08 15 12 15 Triesenberg, Rizlina 16 21 Mauren FL, Freiendorf 08 16 12 16 Triesenberg, 16 22 Mauren FL, Wegacker 08 16 12 16 Abzw. Masescha Mauren FL, Fallsgass 08 17 12 17 Triesenberg, Guferwald 16 24 Eschen, Kohlplatz 08 18 12 18 Triesenberg, Steinort 16 25 Eschen, Post 08 19 12 19 Triesenberg, Obergufer 16 25 Eschen, Eintracht 08 20 12 20 Triesenberg, Post 16 28 Eschen, Haldengasse 08 20 12 20 Triesenberg, Rütelti 16 29 Eschen, Brühl 08 21 12 21 Triesenberg, Täscherloch 16 30 Bendern, Widagass 08 22 12 22 Triesen, Vaschiel 16 34 Bendern, Post 08 23 12 23 Triesen, Matschils 16 35 Bendern, Under Atzig 08 23 12 23 Triesen, Meierhof 16 36 Bendern, Pinocchio 08 25 12 25 Vaduz, Schwefel 16 37 Schaan, Rosengarten 08 26 12 26 Vaduz, Au 16 38 Schaan, Hilcona 08 27 12 27 Vaduz, Spital 16 39 Schaan, Ivoclar 08 28 12 28 Vaduz, Post 16 41 Schaan, Bahnhof 08 30 12 30 Vaduz, Städtle 16 42 Schaan, Zentrum/LKW 08 31 12 31 Vaduz, Quäderle 16 42 Schaan, Laurentiusbad 08 32 12 32 Vaduz, Hofkellerei 16 43 Schaan, Quader 08 33 12 33 Vaduz, 16 44 Vaduz, Mühleholz 08 34 12 34 Ebenholz/Universität Vaduz, 08 35 -

Aktuelles Aus Dem Gemeinderat (Beschlussprotokoll)
GEMEINDE VADUZ 22. Dezember 2020 236159 AKTUELLES AUS DEM GEMEINDERAT (BESCHLUSSPROTOKOLL) 34. Sitzung des Gemeinderates vom 22. Dezember 2020 Online abrufbar auf www.vaduz.li Das Sitzungsprotokoll wird dem Gemeinderat voraussichtlich an der Sitzung vom 19. Januar 2021 zur Genehmigung vorgelegt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Voranschlag 2021, Korrektur Vor Einreichung des Voranschlages 2021 an die Regierung wurde ein Berechnungsfehler festgestellt. Dieser hat Auswirkungen auf die an der Gemeinderatssitzung vom 17. November 2020 genehmigten Zahlen der Investitionsrechnung und führt in der Folge zu einer Erhöhung der budgetierten Mehrausgaben. Investitionsrechnung Die Angaben zur Investitionsrechnung 2021 lauten neu wie folgt: Das Bruttoinvestitionsvolumen beläuft sich im kommenden Jahr auf CHF 26.8 Mio. und liegt somit um CHF 0.6 Mio. über dem Niveau des Voranschlages 2020. Nach Abzug der prognostizierten investiven Einnahmen von CHF 1.9 Mio. werden für 2021 Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 24.9 Mio. budgetiert. Die Nettoinvestitionen können zu 40.6 % aus den Selbstfinanzierungsmitteln von CHF 10.1 Mio. gedeckt werden. Der Differenzbetrag von CHF 14.8 Mio. wird aus den Flüssigen Mitteln des Finanzvermögens finanziert. Der korrigierte Voranschlag 2021 ist durch die Regierung an ihrer Sitzung vom 15. Dezember 2020 genehmigt worden. Antrag: Der Gemeinderat genehmigt das korrigierte Budget 2021 wie folgt: Die Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 26.8 Mio., Einnahmen von CHF 1.9 Mio. und somit den daraus resultierenden Nettoinvestitionen von CHF 24.9 Mio. Beschluss: Gemäss Antrag angenommen, einstimmig / 13 Anwesende Seite 1 von 22 GEMEINDE VADUZ 22. Dezember 2020 236159 Abschreibung von Steuer- und Kontokorrentguthaben 2020 Gemäss Gemeinde-Finanzhaushaltverordnung müssen Forderungen bei Eintreten eines Forderungsverlustes vorbehaltlich spezieller gesetzlicher Bestimmungen abgeschrieben werden. -

Nordic Day: Der Liechtensteinische Langlauf-Schnuppertag in Steg
SAMSTAG 18 | Notruf / Termine 29. DEZEMBER 2012 Volksservice WICHTIGE TELEFONNUMMMERN FÜR DAS FL Nordic Day: Der liechtensteinische NOTRUFNUMMERN Sanität 144 Feueralarm, Öl-, Chemieunfälle 118 Polizei 117 Langlauf-Schnuppertag in Steg Rettungsflugwacht 1414 Tox-Zentrum 145 ÄRZTE IM DIENST Notfallnummer 230 30 30 ZAHNÄRZTE IM DIENST 10 – 12 UHR Samstag, 29. Dezember 2012 Dr. med. dent. Meier Gebhard, Eschen 373 73 90 Sonntag, 30. Dezember 2012 Dr. med. dent. Meier Gebhard, Eschen 373 73 90 STÖRUNGSDIENSTE Telekommunikation (Festnetz und Mobil-Netze): Telecom Liechtenstein AG 217 51 75 Radio und Fernsehen Telecom Liechtenstein AG 217 51 75 Liechtensteinische Kraftwerke während der Geschäftszeit 236 01 11 ausserhalb der Geschäftszeit 233 37 33 Liechtensteinische Gasversorgung Störungs- und Pikettdienst 233 35 55 Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland 373 25 25 APOTHEKEN Apotheke am Postplatz Schaan, Postplatz Der2 Nordic Day in Steg233 steht sämtlichen55 Altersklassen off 55en und ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. (Foto: Michael Zanghellini) Schlossapotheke Vaduz, Aeulestr. Langlauf60 Auch233 in diesem 25 läufer links liegen30 lassen, um blu- ein Valünalopp stets über beste Pis- NORDIC DAY 2012 TopPharm Apotheke tigen Anfängern die ersten Schritte tenverhältnisse verfügt. Schaan, Landstr. Jahr97 kann man 232seine guten 48 auf den schmalen44 Skiern zu erleich- Vorsätze fürs neue Jahr schon tern. Auch die Fortgeschrittenen Ein Skitag für alle Was: Langlauf-Schnuppertag für die KRANKENHÄUSER vor Silvester verwirklichen. kommen nicht zu kurz, denn alle Der Nordic Day steht sämtlichen Al- ganze Familie. Vaduz 235 44 Teilnehmerinnen11 und Teilnehmer tersklassen offen. Für Kinder ab fünf Datum: Samstag, 29. Dezember. Grabs 081/772 Heute Samstag51 findet der 11werden in den Fähigkeiten entspre- Jahren wird ein spezieller Fun-Par- Teilnehmer: Offen für alle, Kinder ab St. -

88.902 Sargans - Balzers – Vaduz - Schaan - Nendeln – Mauren – Feldkirch (Nachtbus N2) Stand: 27
FAHRPLANJAHR 2021 88.902 Sargans - Balzers – Vaduz - Schaan - Nendeln – Mauren – Feldkirch (Nachtbus N2) Stand: 27. Oktober 2020 82101 82301 82102 Sargans, Bahnhof 01 26 Feldkirch, Busplatz 02 40 Sargans, Post 01 27 Feldkirch, Landesgericht 02 41 Trübbach, Dornau 01 34 Feldkirch, Schulzentrum 02 42 Balzers, Sportplatz 01 35 Tisis, 02 42 Balzers, Schlossweg 01 36 Leopold-Scheel-Weg Balzers, Rheinstrasse 01 37 Tisis, Letzestrasse 02 43 Balzers, Mälsnerdorf 01 38 Tisis, Rappenwaldstrasse 02 44 Balzers, Rietstrasse 01 39 Tisis, Töbeleweg 02 44 Balzers, Höfle 01 39 Schaanwald, Zollamt 02 45 Balzers, Alter Pfarrhof 01 40 Schaanwald, Zuschg 02 46 Balzers, Egerta 01 41 Schaanwald, Industrie 02 47 Balzers, Roxy 01 42 Mauren FL, Ziel 02 48 Triesen, Säga 01 43 Mauren FL, Freihof 02 49 Triesen, Gartnetschhof 01 44 Mauren FL, Post 02 50 Triesen, Argweg 01 45 Mauren FL, Freiendorf 02 50 Triesen, Bächlegatter 01 45 Mauren FL, Wegacker 02 51 Triesen, Schule 01 47 Mauren FL, Fallsgass 02 51 Triesen, Post 01 48 Eschen, Kohlplatz 02 52 Triesen, Maschlina 01 50 Eschen, Post 02 54 Triesen, Messina 01 51 Eschen, Eintracht 02 55 Vaduz, Rütti 01 51 Eschen, Presta 02 56 Vaduz, Au 01 52 Eschen, Sportpark 02 57 Vaduz, Spital 01 53 Nendeln, Bahnhof 02 58 Vaduz, Post 01 54 Nendeln, 02 59 Vaduz, Post 01 56 03 20 Sebastianstrasse Vaduz, Städtle 01 56 03 20 Nendeln, Tonwarenfabrik 03 00 Vaduz, Quäderle 01 57 03 21 Nendeln, Oberwiesen 03 00 Vaduz, Hofkellerei 01 58 03 22 Schaan, Hilti 03 02 Vaduz, 01 59 03 23 Schaan, Im Besch 03 04 Ebenholz/Universität Schaan, Bierkeller -

88.901 Feldkirch – Bendern – Schaan/Vaduz – Balzers (Nachtbus N1) Stand: 6
FAHRPLANJAHR 2020 88.901 Feldkirch – Bendern – Schaan/Vaduz – Balzers (Nachtbus N1) Stand: 6. November 2019 Feldkirch, Bahnhof Feldkirch, Busplatz Feldkirch, Busplatz Feldkirch, Landesgericht Feldkirch, Schulzentrum Tisis, Leopold-Scheel-Weg Tisis, Letzestrasse Tisis, Rappenwaldstrasse Tisis, Töbeleweg Schaanwald, Zollamt Schaanwald, Zuschg Schaanwald, Waldstrasse Schaanwald, Industrie Mauren FL, Ziel Mauren FL, Freihof Mauren FL, Post Mauren FL, Freiendorf Mauren FL, Wegacker Mauren FL, Fallsgass Eschen, Kohlplatz Eschen, Post Eschen, Eintracht Eschen, Haldengasse Eschen, Brühl Bendern, Widagass Bendern, Post Bendern, Under Atzig Bendern, Pinocchio Schaan, Rosengarten Schaan, Hilcona Momentan sind keine Fahrplandaten verfügbar Schaan, Ivoclar Actuellement aucune information horaire n’est à disposition Schaan, Bahnhof Al momento non sono disponibili dati sugli orari Schaan, Bahnhof No timetable data available at the moment Schaan, Zentrum Schaan, Laurentiusbad Schaan, Quader Vaduz, Mühleholz Vaduz, Ebenholz/Universität Vaduz, Hofkellerei Vaduz, Quäderle Vaduz, Städtle Vaduz, Post Vaduz, Post Vaduz, Spital Vaduz, Au Vaduz, Rütti Triesen, Messina Triesen, Maschlina Triesen, Post Triesen, Sonnenkreisel Triesen, Schule Triesen, Bächlegatter Triesen, Argweg Triesen, Gartnetschhof Triesen, Säga Balzers, Roxy Balzers, Egerta Balzers, Alter Pfarrhof Balzers, Höfle Balzers, Rietstrasse Balzers, Mälsnerdorf Balzers, Brückle Balzers, Rheinstrasse Balzers, Schlossweg 1 / 2 FAHRPLANJAHR 2020 88.901 Feldkirch – Bendern – Schaan/Vaduz – Balzers (Nachtbus -

Auszug Aus Dem Gemeinderatsprotokoll Nr. 14/19 77001
Gemeindevorstehung Landstrasse 4 LI-9497 Triesenberg Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll Nr. 14/19 77001 Sitzung 29. Oktober 2019 Vorsitz Christoph Beck, Vorsteher anwesend Reto Eberle, Wangerbergstrasse 15 Michael Gätzi, Bergstrasse 118 Stephan Gassner, Farabodastrasse 40 (ab Traktandum 2) Thomas Lampert, Rotenbodenstrasse 111 Thomas Nigg, Am Wangerberg 7 Alexandra Roth-Schädler, Rossbodastrasse 35 Armin Schädler, Bühelstrasse 12 Gertrud Vogt, Burkatstrasse 23 Corina Vogt-Beck Lavadinastrasse 21 Barbara Welte-Beck, Wangerbergstrasse 72 zu Traktandum 1: Jonny Beck, Wassermeister zu Traktandum 2: Stephan Wohlwend, Amt für Bevölkerungsschutz Roberto Trombini, Leiter Hochbau zu Traktandum 3 Thomas Zyndel, Gemeindeförster entschuldigt --- Protokoll Nicole Eberle Traktanden 1. Besichtigung der Wasserinfrastruktur 2. Information über die Revision der Gefahrenkarte für das Alpengebiet (Steg und Malbun) 3. Gründung Waldbesitzervereinigung - Anfrage zur Mitgliedschaft 4. Genehmigung des Protokolls 13/19 vom 1. Oktober 2019 5. Rheintalseitiges Gemeindegebiet / Bestellung Begleitgruppe und Projektgruppe für die Erarbeitung eines räumlichen Leitbildes 6. Bodentausch Grundstück Nr. 1125, Allmeina 7. Wasserschaden Geschäftslokal Nord, Landstrasse 7 8. Brandschutzmassnahmen Hotel Kulm / Bauliche Massnahmen 9. Integration des Ortsbusses in die Linie 22 Triesenberg-Rotenboden- Gaflei, Genehmigung des Fahrplans und Bewilligung der Mehrkosten 10. Informationstechnologie – Backup-Server Upgrade sowie Ablösung des Microsoft Small Business Servers 2011 Auszug -

Sales Manual. Swiss Travel System
Sales Manual. Swiss Travel System. Version 1, 2020 Swiss Travel Guide Button-PRINT.pdf 1 20.08.19 14:27 Go digital – get the app! English Bernina at Lago Bianco Express STS-GB-L-20-en.pdfSTS-GB-L-20-en.pdfSTS-GB-L-20-en.pdf 1 1 18.09.19 18.09.19 11:301 11:30 18.09.19 11:30 StrasbourgStrasbourg | Paris | StrasbourgParis | Paris KarlsruheKarlsruhe | Frankfurt |Karlsruhe Frankfurt | Dortmund | | FrankfurtDortmund | Hamburg | Dortmund | Hamburg | Berlin | Hamburg| Berlin | Berlin Stuttgart StuttgartStuttgart Ulm | MünchenUlmUlm | München | München München MünchenMünchen Stockach StockachStockach Engen Engen Engen Blumberg-ZollhausBlumberg-ZollhausBlumberg-Zollhaus DEUTSCHLANDDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND SeebruggSeebruggSeebrugg Bargen BargenOpfertshofenBargen Opfertshofen Ravensburg RavensburgRavensburg Train,Train,Train, busbus and andbus boat boatand boat Opfertshofen Überlingen ÜberlingenÜberlingen BeggingenBeggingenBeggingen Singen SingenSingen Thayngen ThayngenThayngen HemmentalHemmentalHemmental atat aa glanceglanceat a glance Rhein/Rhein/ Rhein/ SchleitheimSchleitheimSchleitheim MulhouseMulhouse Mulhouse Radolfzell RadolfzellRadolfzell Le RhinLe Rhin Le Rhin Mainau MainauMainau Version:Version: 12.20 12.201919 Version: 12.2019 Meersburg MeersburgMeersburg DueDue to to lack lack of of space spaceDue not not toall alllack lines lines of are spaceare indicated. indicated. not all Subjectlines Subject are to indicated. tochange. change. Subject to change. SchaffhausenSchaffhausenSchaffhausenRamsen RamsenRamsen Wangen (Allgäu)WangenWangen (Allgäu) -

Vorlage Auszug Aus Dem Gemeinderatsprotokoll
Gemeindevorstehung Landstrasse 4 LI-9497 Triesenberg 74509 Aus dem Gemeinderat / Sitzung vom 29. Oktober 2019 Besichtigung Wasserinfrastruktur Der Gemeinderat besichtigt zusammen mit dem Wassermeister Jonny Beck das Reservoir Balischguad und das Pumpwerk Gnalp. Das Reservoir Balischguad bildet mit seiner Quellfassung das Herzstück der Versorgung für den Weiler Rotenboden. Zudem befindet sich im Gebäude auch die Entnahmestelle für die Grundversorgung des Reservoirs Masescha. Dieses wird durch eine Verbindung mit der Vaduzer Wasserleitung mit frischem Trinkwasser versorgt. Das Pumpwerk auf Gnalp ist eines von insgesamt drei Pumpwerken, die eine Wasserver- sorgung im rheintalseitigen Feriengebiet gewährleisten und so das notwendige Wasser bis ins Reservoir Färchanegg befördern. Revision Gefahrenkarte für das Alpengebiet (Steg und Malbun) Die letzten Gefahrenkarten für das Alpengebiet (Steg und Malbun) stammen aus dem Jahr 1999. Einerseits dienen die Gefahrenkarten der Prävention in Form einer Massnah- menplanung sowie der Raumplanung, in der sie sich als Grundgrösse etabliert haben, und andererseits sind die Gefahrenkarten zwischenzeitlich im Bereich Intervention eine wesentliche Grundlage für die Einsatz- und Rettungskräfte im Ernstfall. Die Regierung hat das Amt für Bevölkerungsschutz beauftragt, die landesweite Gefahren- karte einer Revision zu unterziehen. Die betroffenen Eigentümer, deren Grundstücke im Alpengebiet (Steg und Malbun) sich im Untersuchungsperimeter "bau- und siedlungsnahe Gebiete" in der Bauzone befinden und neu von der -

Orchideen Des Fürstentums Liechtenstein
Orchideen des Fürstentums Liechtenstein Hans-Jörg Rheinberger Barbara Rheinberger Peter Rheinberger Fotos: Kurt Walser In der Schriftenreihe der Regierung 2000 Orchideen des Fürstentums Liechtenstein Hans-Jörg Rheinberger Barbara Rheinberger Peter Rheinberger Fotos: Kurt Walser Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein Band 13 2. verbesserte und nachgeführte Auflage Vaduz 2000 Herausgeber: Regierung des Fürstentums Liechtenstein Redaktion: Mario F. Broggi, Vaduz Titelblatt und Layout: Ateliers Louis Jäger und Silvia Ruppen, Vaduz Fotos: Kurt Walser, Schaan (falls nicht bei Bildlegende anderer Bildautor erwähnt) Druck: BVD Druck + Verlag AG, Sdlaan Bezugsquelle: Amt für Wald, Natur und Landschaft. FL-9490 Vaduz Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz 2000 ISBN 3-952 1855-0-7 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Rheinberger, Hans-Jörg: Orchideen des Fürstentums Liechtenstein / Hans-Jörg Rheinberger; Barbara Rheinberger; Peter Rheinberger. - Vaduz : Amtlicher Lehrmittelverl., 2000 (Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein; Bd. 13) ISBN 3-952 1855-0-7 Geleitwort zur 2. Auflage Der im Jahre 1991 veröffentlichte Band über die Orchideen des Fürstentums Liechtenstein war in kurzer Zeit vergrif fen . Dies zeigt, wie beliebt Orchideen sind und welche Faszination sie auf uns Menschen ausüben können. Weiters be legt dies, mit welch hoher Qualität und ansprechender Form die Autoren das Buch gestaltet haben. Die Nachfrage blieb bis heute unvermindert hoch und eine Neuauflage drängte sich auf. Fast in jedem Land Miueleuropas ha ben sich Orchideenfreunde in Vereini gungen zur Erforschung und zum Schutz der Orchideenwelt zusammen gefunden. Studien über Orchideen wer den oft in der Freizeit erarbeitet und nicht durch Berufsbotaniker. In stiller Kleinarbeit und mit fundiertem Wissen sind in diesem Band die Kenntnisse über die heimische Orchideenwelt von Barbara, Hans-Jörg und Peter Rhein berger zusammengetragen und in hervorragender Weise dargestellt worden. -

Durch Eine Spende an Die CARITAS LIECHTENSTEIN Bringen Die
Durch eine Spende an die CARITAS LIECHTENSTEIN bringen die nachstehenden Personen Glück- und Segens- wünsche zu Weihnachten und Neujahr für ihre Freunde, Verwandten und Bekannten zum Ausdruck. Sie leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in Notsituationen in Liechtenstein. Die CARITAS LIECHTENSTEIN dankt allen Spendern und Spenderinnen für das Vertrauen in die Arbeit der Caritas 2018 und schliesst sich diesen Wünschen sehr herzlich an. Zukunftsstiftung der Liechtensteinische Elsa und Engelbert Schreiber, Kirchstrasse Helga Fischer, Bartlegroschstrasse 42, Ines Rampone-Wanger, Schinderböchel Ruth Braun, Forellenweg 10, Vaduz Landesbank AG, Vaduz 39, Vaduz Vaduz 13, Vaduz Hanspeter Erne, Lawenastrasse 18, Triesen Michelle Frick, Eibenweg 1, Vaduz Gisela Zinsmeister, am Sunnenberg 11, Claudia und Dieter Goop-Goldi, In der Peter Kieber, Im Quäderle 17, Vaduz Xaver Biedermann, Platta 49, Schellenberg Marion Musenbichler, Im Täscherloch 14, Triesen Egerta 19, Schaan Marina und Georg Kieber, Binzastrasse 6, Reinold Heeb, Fallagass 1, Ruggell Triesenberg Marlies Quaderer, Speckibündt 15, Schaan Dieter Meier, Kappelestrasse 7, Eschen Mauren Susanne und Christoph Wenaweser, Ulrich Scherrer, Im Bretscha 33, Schaan Elfrieda und Rudolf Kleeberger, Unterfeld Nikolaus von und zu Liechtenstein, Regina Vogt, Gnetsch 36, Balzers Tanzplatz 31, Schaan Immojak Establishment, Rotengasse 13, 19, Triesen Gebhardstorkel 8, Schaan Melitta Weilenmann, Am Exerzierplatz 20, Erich Marxer, Kohlbrunnen 5, Nendeln Ruggell Josefina Kunz, Schalunstrasse 16, Vaduz Roger Matt, Weiherring 1, Mauren Vaduz Roland Matt, Rütteler 18, Schellenberg Erika Hofer Vogt und Paul Vogt, Fernando Fiorillo, Saxgass 13, Schaan Bersad Cehic, Schalunstrasse 33, Vaduz Evelyn Gstöhl, Hub 4, Eschen Herbert Kranz, Wingertstrasse 6, Eschen Palduinstrasse 74, Balzers Irene und Harald Marxer, Silligatter 1, Daniel Hilti, In der Egerta 17, Schaan Erwin Risch, Landstrasse 31, Schaan Michael Mayenknecht, Guler 12, Mauren Gilbert Büchel, Kirchstrasse 54, Ruggell Eschen Gemeinde Eschen, St.