Faltblatt Erichsburg.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
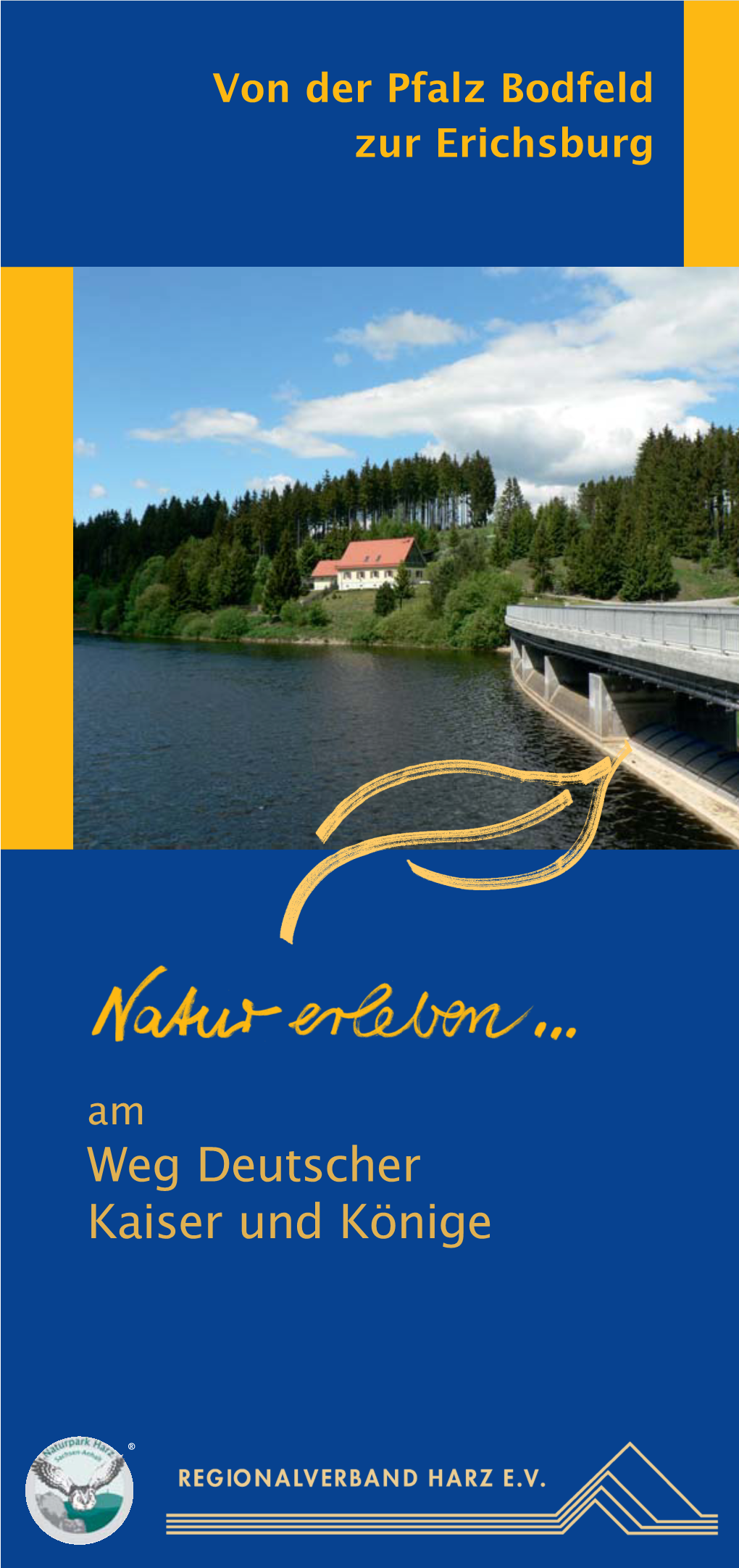
Load more
Recommended publications
-

Broschüre – Die Justiz in Sachsen-Anhalt
DIE JUSTIZ in Sachsen-Anhalt Inhalt Die Justiz in Sachsen-Anhalt 2 Die Justiz in Sachsen-Anhalt Vorwort Vorwort 3 1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit 4 2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit 6 Nr. Inhaltsverzeichnis Seite 3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 10 Vorwort Seite 3 4 Die Sozialgerichtsbarkeit 12 5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit 14 1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit Seite 4 6 Die Finanzgerichtsbarkeit 16 7 Die Staatsanwaltschaften 18 2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit Seite 6 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 8 Die Justizvollzugsbehörden 20 3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit Seite 10 9 Der Soziale Dienst der Justiz 22 eine der Grundsäulen unseres demokratisch verfassten Gemeinwesens ist ein funkti- 10 Ehemalige Städte und Gemeinden 4 Die Sozialgerichtsbarkeit Seite 12 onierender Rechtsstaat. Für ihn arbeiten Gerichte und Staatsanwaltschaften, um dem und ihre jetzigen Bezeichnungen 24 Recht Geltung zu verschaffen. 11 Zuordnung der Städte und Gemeinden zu den Bezirken der Gerichte und 5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit Seite 14 Staatsanwaltschaften 61 Ihnen liegt hier eine Broschüre vor, die für jede Stadt und Gemeinde in Sachsen-An- halt auflistet, welches Gericht beziehungsweise welche Staatsanwaltschaft für den 12 Anschriftenverzeichnis der Gerichte und 6 Die Finanzgerichtsbarkeit Seite 16 jeweiligen Ort zuständig ist. Die Gerichtsstrukturen orientieren sich an den Verwal- Justizbehörden des Landes Sachsen-Anhalt 76 tungseinheiten, wie sie die Kreisgebietsreform aus dem Jahr 2007 vorgibt. Sie als 87 Impressum 7 Die Staatsanwaltschaften Seite 18 Bürger finden damit eine Behörden- und Justizstruktur vor, die überschaubar und einheitlich ist. 8 Die Justizvollzugsbehörden Seite 20 Die vorliegende Broschüre soll Ihnen helfen, den grundsätzlichen Aufbau des „Dienst- leistungsbetriebes Justiz“ besser zu verstehen. Sie beinhaltet Informationen zu allen 9 22 Der Soziale Dienst der Justiz Seite Gerichten und Staatsanwaltschaften in unserem Bundesland. -

Tourenplan Papierbehälter 120 L / 240 L Altpapier 22
TOURENPLAN Papierbehälter 120 l / 240 l Altpapier 22 07.01. Tour 1: Stadtgebiet Blankenburg A 03.02. lbert-Schneider-Straße, Albrechtstraße, Alte Halberstädter Straße, Amalienstraße, Am Hang, Am Helsunger Weg, Am Schäferplatz, Amselweg, 03.03. Am Thie, An der Wasserstelle, Asternweg, Badegasse, Bahnhofstraße, 31.03. Bährstraße, Bartholomäikirchhof, Bäuersche Straße, Bergstraße, Birkental, Registerfeld 28.04. Börnecker Straße, Dr.-Jasper-Straße, Elisabethstraße, Fichtestraße, Finkenherd, 27.05. Fliederweg, Forstmeisterweg, Friedrich-August-Straße, Gärtnerweg, Gehren komplett, Georg-Schultz-Straße, Georgstraße, Gewerbegebiet 23.06. Lerchenbreite, Gnauck-Kühne-Straße, Großvaterweg, Grüne Gasse, 21.07. Harlippenstraße, Harzstraße, Hasselfelder Straße, Heidelberg, Heinrichsweg, In die Papierbehälter gehören: 18.08. Helenenstraße, Helsunger Straße, Herderstraße, Herwegstraße, Herzogstraße, Briefumschläge, Broschüren, Bücher, Eierschachteln aus Pappe, 15.09. Herzogsweg, Hinter dem Rathaus, Hohe Straße, Hospitalstraße, Kataloge, Prospekte, Schreibpapier, Schulhefte, Verpackungen 13.10. Husarenstraße, Kallendorfer Weg, Karlstraße, Katharinenstraße, aus Karton, Papier und Pappe, Zeitschriften, Zeitungen. Knockestraße, Krumme Straße, Kuno-Rieke-Straße, Lange Straße, 10.11. Lessingplatz, Lessingstraße, Lindestraße, Liststraße, Löbbeckestraße, Bitte beachten Sie, dass der Behälter nicht ausschließlich mit 08.12. Lühnergasse, Lühnertorplatz, Mahnerstraße, Marienstraße, Markt, Katalogen und Büchern befüllt wird, da dieser sonst zu schwer ist Marktstraße, -

Rettungsdienstbereichsplan Vom
Rettungsdienstbereichsplan Landkreis Harz (Lesefassung – beinhaltet die 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 10.11.2016, die 2. Satzung zur Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes vom 14.12.2017 sowie die 3. Satzung zur Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes vom 15.03.2018) Rettungsdienstbereichsplan für den Landkreis Harz Präambel Auf Grundlage der §§ 8, 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) i.V.m. § 7 Abs. 2 des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG-LSA) vom 18.12.2012 (GVBl. LSA S. 624) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Landkreises Harz am 03.12.2014 zur Sicherstellung des bedarfsgerechten und flächendeckenden Rettungsdienstes für den Rettungsdienstbereich Landkreis Harz nachfolgenden Rettungsdienstbereichsplan als Satzung beschlossen: § 1 Aufgaben, Geltungsbereich, Trägerschaft Der Rettungsdienst ist gem. § 2 Abs. 2 RettDG LSA als Bestandteil der Daseinsvorsorge eine öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr und wirkt beim Katastrophenschutz mit. Er umfasst die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der qualifizierten Patientenbeförderung sowie der rettungsdienstlichen Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von erkrankten oder verletzten Personen. Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 RettDG LSA ist zur Gewährleistung der flächendeckenden Versorgung für jeden Rettungsdienstbereich ein Rettungsdienstbereichsplan als Satzung zu beschließen und in regelmäßigen Zeitabständen fortzuschreiben. Der vorliegende Rettungsdienstbereichsplan regelt die bedarfsgerechte rettungsdienstliche Infrastruktur und die wirtschaftliche und effiziente Durchführung eines flächendeckenden Rettungsdienstes im Landkreis Harz. Der Rettungsdienstbereichsplan gilt für den Rettungsdienstbereich Harz, der das Gebiet des Landkreises Harz umfasst. In ihm werden grundsätzliche Festlegungen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Landkreis Harz getroffen. -

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992
ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -

Abbenrode - Das Dorf an Der Ecker : Informationsschrift Über Die Ortsgeschichte Der Gemeinde Abbenrode Von Der Ersten Ansiedlung Bis Zur Gegenwart
Abbenrode - das Dorf an der Ecker : Informationsschrift über die Ortsgeschichte der Gemeinde Abbenrode von der ersten Ansiedlung bis zur Gegenwart. Hrsg. vom Rat der Gemeinde Abbenrode, erarb. vom Chronistenkollektiv. Abbenrode 1989. 53 S. - Bc 245 (G) - Abert, Paul: Durch den Harz. Leipzig 1926. VIII, 228 S. (Storm Reiseführer) - Ab 184 (K) - Archäologische Berichte aus Sachsen-Anhalt. Landesamt für archäologische Denk- malpflege Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle (Saale) Erscheint jährl. 1993 (1994) 1994 (1996) 1995 (1996) - Ae 330 (K) - Heimatblätter der Kreises Artern. [Hrsg.: Kulturbund zur demokratischen Erneue- rung Deutschlands, Kreisleitung Sangerhausen in Verbindung mit dem Rat des Kreises, Abteilung Kultur, Sangerhausen]. Sangerhausen Auch u.d.T.: Heimatblätter des Kreises Sangerhausen. - Erschien mehrmals jährl. 6 (1954) 7-9, 13 (1955) 17, 18 (1956) - Ec 70 (K) - Zeitschrift des Vereins für Heimatkunde, Geschichte und Schutz von Artern e. V. - Aratora : (Neugründung 29.10.1990). Hrsg. vom Vorstand des Heimatvereins Ara- tora Artern e.V. Artern Erscheint jährl. 1 (1991) 4 (1994) 7 (1997) 2 (1992) 5 (1995) 8 (1998) 3 (1993) 6 (1996) - Ec 37 (G) - Aschersleben Schulprogrammschriften des Gymnasiums 1831 - 1910 - Ea 65-67 (K) - Die 150jährige Geschichte des Wasserheilbades Bad Lauterberg im Harz : Wirkung und Hoffnung - das ganzheitliche Gesundheitsprinzip Sebastian Kneipps bleibt immer gültig. Hrsg. vom Kneippverein Bad Lauterberg im Harz e.V. Bad Lauterberg [1989?] - Bh 207 (K) - Heimatbuch und Wanderführer für Bad Sachsa. [Zsgest. von Hans Horn und F. W. Biertimpel-Gallen]. Osterode/Harz 1950. 75, [16] S. - Bg 38 (K) - Blankenburg Schulprogrammschriften des Gymnasiums 1841 - 1915 - Bd 103 / Bd 132 (K) - Der Kurgast : amtliche Kurzeitung des Heilbades Blankenburg, Harz. -
Wernigerode Castle
Landmark 8 Wernigerode Castle ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. Among the fi rst 120 UNESCO Global Geoparks, spread throughout 33 countries around the world, is Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which locations and landscapes of international geological importance are found. They are operated by organisations which, with the involvement of the local population, campaign for the protection of geological heritage, for environmental education and for sustainable regional development. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 16,15 miles 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 QuedlinburgQ 4 OsterodeOsterodedee a.H.a.Ha 9 11 5 131 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen NordhausenNdh 12 21 As early as 2004, 25 Geoparks in Europe and China had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. Historism 1 Wernigerode Castle Originally, a medieval fortress crowned the promontory of the Agnesberg. After the devastating ravages of the 30-Years-War (1618 – 1648), the work of reconstructing the fortress as a Baroque residence castle began under the Count ERNST OF STOLBERG-WERNIGERODE (1716 – 1778). -

Tracer Test in the Abandoned Fluorspar Mine Straßberg/Hartz
http://www.IMWA .info IMWA Symposium 2001 TRACER TEST IN THE ABANDONED FLUORSPAR MINE STRASSBERG/HARZ MOUNTAINS, GERMANY Christian Wolkersdorfer and Andrea Hasche TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Hydogeologie, Gustav-Zeuner-Str. 20, D- 09596 Freiberg/Sachsen, e-mail: [email protected] Abstract: After three new water adits were constructed, the water budget of the abandoned Straßberg mine increased substantially. A multi-tracer test was conducted in an attempt to determine why this occurred. Potassium chloride, coloured club moss spores, and microspheres were used to show the hydrodynamic relation between the three mining districts. It was determined that the flow direction is from north to south and that the mean effective flow velocities range from 0.1-1.5 m min-1. Furthermore, it is clear now that a dam between two of the three pits is hydraulically inactive at the current flow situation. Solid tracers, used in conjunction with a reliable injection and sampling technique, proved to be a good means to investigate the hydrodynamic conditions within this abandoned underground mine. However, there is still no good explanation for the increased water budget infiltrating from the Brachmannsberg mining district. Key words: tracer; abandoned mine; microspheres; hydrodynamics Introduction In 1991, economic and environmental reasons caused the closure of the Straßberg fluorspar mine, owned by the Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH [Company for remediation and utilisation of abandoned mines Ltd] (KUYUMCU & HARTWIG 1998). Situated in the Mid-Harz Fault Zone of the eastern Harz Mountains (Figure 1), approximately 30 km south of Quedlinburg and 6 km west of Harzgerode, the Straßberg mine (TK 4332 Harzgerode) was the most important producer of fluorite in the former GDR (MOHR 1978). -

HARZ MOUNTAINS 229 Quedlinburg Thale Gernrode © Lonely Planet Publications Planet Lonely © Wernigerode Harz National Park Brocken Goslar (Harz Journey; 1824)
© Lonely Planet Publications 229 Harz Mountains The Harz Mountains rise picturesquely from the North German Plain, covering an area 100km long and 30km wide at the junction of Saxony-Anhalt, Thuringia and Lower Saxony. Although the scenery here is a far cry from the dramatic peaks and valleys of the Alps, the Harz region is a great year-round sports getaway, with plenty of opportunities for hiking, cycling and skiing (downhill and nordic) in and around the pretty Harz National Park. The regular influx of visitors in all seasons is testament to the enduring appeal of the Harz; historically, too, its status as a prime national holiday destination has never been questioned. From 1952 until reunification, the region was divided between West and East Germany, effectively becoming an uneasy political holiday camp straddling the Iron Curtain. The Brocken (1142m) is the focal point, and has had more than its fair share of illustri- ous visitors: the great Goethe was frequently seen striding the local trails and set ‘Walpur- gisnacht’, an early chapter of Faust, on the mountain, while satirical poet Heinrich Heine spent a well-oiled night here, as described in Harzreise (Harz Journey; 1824). Elsewhere the charming medieval towns of Wernigerode and Quedlinburg pull the crowds, while equally venerable steam trains pull them along between the mountain villages, spas and sports resorts that litter the region. Get out your knee socks or your ski mask and treat yourself to a taste of the active life. HIGHLIGHTS Pagan Rituals Trek to the Brocken or -

678 Wernigerode - Drei Annen Hohne - Benneckenstein - Eisfelder Talmühle - Nordhausen Nord
Hasselfelde - 678 Wernigerode - Drei Annen Hohne - Benneckenstein - Eisfelder Talmühle - Nordhausen Nord - Schierke (Schmalspurbahn) Rbd Magdeburg Train No. 14411 14441 14461 14401 14431 14403 14405 14449 14445 14407 14443 14415 14466 14433 14447 14417 14409 14409 km 0,0 Wernigerode Dep ... ... ... 6.35 8.00 Ý 9.02 â 9.42 ú 9.42 10.45 11.56 ... ... ... Ý 14.35 â 14.35 ... Ý 16.58 â 17.10 1,0 Wernigerode Westerntor ¶ ... ... ... 6.40 8.05 å 9.06 å 9.47 åµ 10.54 12.10 ... ... ... å 14.40 å 14.40 ... å 17.03 å 17.15 2,5 Wernigerode Kirchstraße µ ... ... ... 6.44 8.09 å 9.11 å 9.51 åµ 10.58 12.14 ... ... ... å 14.44 å 14.44 ... å 17.07 å 17.19 4,3 Wernigerode-Hasserode µ ... ... ... 6.52 8.16 å 9.18 å 9.58 åµ 11.05 12.22 ... ... ... å 14.52 å 14.52 ... å 17.14 å 17.26 5,9 Steinerne Renne ´ ... ... ... 6.57 8.22 å 9.25 å 10.05 åµ 11.11 12.28 ... ... ... å 14.57 å 14.57 ... å 17.21 å 17.40 14,1 Drei Annen Hohne Arr ... ... ... 7.18 8.43 å 9.46 å 10.26 å 10.37 11.33 12.49 ... ... ... å 15.18 å 15.18 ... å 17.43 å 18.02 14,1 Drei Annen Hohne Dep ... ... ... · 8.51 · · · · · ... ... ... å 15.27 · ... · · 19,4 Schierke Arr ... ... ... · 9.05 · · · · · ... ... ... Ý 15.41 · ... · · 14,1 Drei Annen Hohne Dep ... ... ... 7.26 ... å 9.54 å 10.34 å 11.23 11.48 12.57 .. -

Wernigerode Schermke Bundesstraße Wald Osterode Neuwegersleben Landstraße Über Gasthaus Steinerne Renne Hornburg Länge: Ca
Ausgewählte Landkreisgrenze Ortschaft LANDKREIS HARZ Autobahn See Brockenaufstiege Ampfurth Fluss Hamersleben Bundeskraftfahrtstraße Gunsleben Großer Grab en Ausgangspunkt: Wernigerode Schermke Bundesstraße Wald Osterode Neuwegersleben Landstraße über Gasthaus Steinerne Renne Hornburg Länge: ca. 14 km (ca. 850 Höhenmeter zu überwinden) Veltheim Dedeleben Aderstedt Hessen Eisenbahn Dauer: ca. 4,5 Stunden OSCHERSLEBEN Schladen Pabstorf Peseckendorf Markierung: durchgängige Markierung roter Punkt im Dreieck Schmalspurbahn Rohden Rohrsheim Schlanstedt Strecke: GROSSER Vogelsdorf Klein Germersleben B 245 Wulferstedt Klein Oschersleben – OT Hasserode / Floßplatz, Gasthaus Steinerne Renne, Hannecken B 79 bruch (MolkenhausChaussee), links abbiegen in den Höllenstieg bis FALLSTEIN B 244 A 395 Gemeinde Huy UNESCO Oranierroute zum Glashüttenweg, rechts abbiegen, Brockenstraße bis zum Gipfel Groß Germersleben Straße der Romanik Eilsdorf Hordorf Welterbe Bühne Deersheim Wülperode Anderbeck über Thumkuhlental, Glashüttenweg Badersleben Deutsche Standorte Länge: ca. 18 km (ca. 850 Höhenmeter zu überwinden) Dardesheim Eilenstedt Großalsleben Gartenträume Dingelstedt Hadmersleben Fachwerkstraße Dauer: ca. 5 Stunden Lüttgenrode Krottdorf Kleinalsleben Markierung: verschiedene Osterwieck Schwanebeck Strecke: Vienenburg Wiedelah Huy Neinstedt B 244 Röderhof – OT Hasserode / Floßplatz, Drängetal, Lossendenkmal, Thumkuhlental Ilse Wanderwege Radwege (Geologischer Lehrpfad), Ellenbogenchaussee (Bergwachthütte), Berßel Westeregeln Glashüttenweg (HarzerHexenStieg), -

Auf Diesen Bus-Linien Gilt HATIX
ê Braunschweig Alt Wallmoden ê Magdeburg ê 650 Klein Mahner ê Beuchte 822 Dardesheim 834 ê Neu Wallmoden ê 860 ê Hildesheim 212 Deersheim Huy Schwanebeck ê Braunschweig ê Bredelem 833 Vienenburg 210 Berßel 214 ê Hessen Osterwiek Nienhagen Schauen Zilly Sargstedt Hahausen Aspenstedt ê Dardesheim 222 236 Neuerkrug ê Liebenburg 852 Athenstedt 220 ê Dedeleben 273 Gröningen 801 802 803 Abbenrode 836 ê Rhüden Langelsheim 213 Groß Quenstedt Emersleben Astfeld 804 805 806 821 Wasserleben 210 Bornhausen Deesdorf Langeln Innerstestausee Wolfshagen Schachdorf Danstedt im Harz Goslar 874 Stöbeck Oker Veckenstedt Heudeber 832 Rammelsberg 866 873 1 2 11 12 Stapelburg Granestausee 810 871 272 Halberstadt 13 14 15 16 859 Seesen 271 275 234 Bad Harzburg Baumwipfelpfad 270 Harsleben Wegeleben Lautenthal Reddeber Minsleben 231 Herrhausen Hahnenklee Rabenklippen 201 202 Derenburg Ilsenburg Langenstein Kirchberg 861 830 Drübeck 203 204 Silstedt Hedersleben Radau-Wasserfall 875 Münchehof 205 831 Bockswiese Wernigerode 837 Plessenburg Darlingerode Schulenberg Okerstausee ê Ildehausen Schloss 233 Regenstein Eckerstausee Benzingerode Höhlenerlebnis- Wildemann 841 Ditfurt zentrum 250 Heimburg 820 274 842 Brocken Bad Grund 1.141 m Michaelstein Westerhausen 235 232 ê Heteborn/Gatersleben/ Altenau Torfhaus 264 Clausthal- 230 206 Nachterstedt Gittelde 460 Schaubergwerk Blankenburg Schaubergwerk Zellerfeld Büchenberg 252 Hohnehof Büchenberg Cattenstedt Teufelsmauer Windhausen Oderbrück 261 Schloss Timmenrode 251 Quedlinburg Buntenbock Warnstedt Badenhausen 840 Stieglitzecke -

K1b L Ö SUNG 1. in Welcher Stadt Wurde
K1b L Ö S U N G 1. In welcher Stadt wurde Heinrich IV. geboren? Goslar Am 11. November 1050 wurde der erste männliche Nachfahre (Heinrich IV.) und heißersehnter Thronfolger des Sachsenkaisers Heinrich III. und Agnes von Poitou aus Aquitanien in Goslar geboren. 2. Welche beiden Persönlichkeiten spielten beim Kniefall von Chiavenna die entscheidenden Rollen? Heinrich der Löwe Friedrich I. Barbarossa Der Kniefall von Chiavenna 1176 Kaiser Friedrich Barbarossa wollte die frühere Macht des Römerreiches wiederherstellen, stieß jedoch auf den erbitterten Widerstand der oberitalienischen Städte, die von Papst Alexander III. unterstützt wurden. Für seine Hilfe hatte er dem Braunschweiger Fürsten, „Heinrich, der Löwe“, das Herzogtum Bayern als Lehen zugesprochen. Als Friedrich erneut Hilfe erbat, verlangte sein Vetter Heinrich dafür Goslar und den Rammelsberg; der Kaiser lehnte ab. Heinrich war daraufhin nicht zur Heerfolge bereit. Später wurde der mächtige Heinrich verbannt und ging zu seinem Schwiegervater, dem König von England. Auch das bayrische Lehen wurde ihm wieder abgenommen. So endete der Streit der beiden überragenden politischen Figuren des 12. Jahrhunderts zugunsten des Kaisers. 3. Welche beiden großen Persönlichkeiten der damaligen Zeit trafen sich in Goslar zur Weihe der Stiftskirche St. Simon und Judas Thaddäus (Goslarer Dom)? Papst Victor II. Heinrich III. Kaiser Heinrich III. aus dem Hause der Salier empfing Papst Viktor II., der mit großem Gefolge anreiste. In Anwesenheit vieler Bischöfe wurde die Weihe des Domes vorgenommen. Heinrich III. residierte damals in der Kaiserpfalz und befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Reich umfasste Deutschland, Italien und Burgund, und sein Einfluss reichte weit in die östlichen Länder. Wenige Wochen später jedoch starb er auf einer Jagd im Harz.