„Franz Von Papen Als Reichskanzler“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reichspräsident Paul Von Hindenburg 1930-1934. Eine Studie Über Die Bedeutung Der Persönlichkeit Beim Übergang Von Der Weimarer Republik Zum Dritten Reich
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB):... RWTH Aachen Historisches Institut Masterarbeit Dozent: Priv.-Doz. Dr. phil. Matthias Pape Semester: SS 2015 Reichspräsident Paul von Hindenburg 1930-1934. Eine Studie über die Bedeutung der Persönlichkeit beim Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich Die vorliegende Arbeit folgt der neuen Orthografie und der neuen Interpunktion. Vorgelegt am 17. August 2015 von: Lars Voßen 1. HF: Geschichte Matrikelnummer: 282047 2. HF: Philosophie Am Ginsterberg 24, 52477 Alsdorf Master of Arts [email protected] Telefon: 02404 / 67 16 69 Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite 1. Einleitung 1 1.1 Die öffentliche Kontroverse um Paul von Hindenburg 1 1.2 Hindenburg in der Forschung 4 1.3 Fragestellung, Forschungsstand und Quellenlage 9 2. Biografische und verfassungsrechtliche Voraussetzungen 17 2.1 Die Persönlichkeit Paul von Hindenburg 18 2.1.1 Vom Preußen Friedrich Wilhelms IV. bis zum vorläufigen Ende der militärischen Laufbahn unter Wilhelm II. 18 2.1.2 Der Erste Weltkrieg als Beginn des politischen Aufstiegs 26 2.2 Das Amt des Reichspräsidenten in der Weimarer Reichsverfassung 35 2.2.1 Das verfassungsrechtliche Verhältnis des Reichspräsidenten zum Reichstag 35 2.2.2 Stellung und Bedeutung des Reichspräsidenten innerhalb der Exekutive 37 2.2.3 Der Reichspräsident und die Legislative 41 2.2.4 Verfassungsrechtliche Handlungsspielräume des Reichspräsidenten – eine Beurteilung 45 3. Hindenburgs Rolle in der Endphase der Weimarer Republik 49 3.1 Von der Reichspräsidentenwahl 1925 bis zum Ende der Großen Koalition 1930 49 3.2 Brünings Reichskanzlerschaft 53 3.3 Papens Reichskanzlerschaft 64 3.4 Schleichers Reichskanzlerschaft 73 3.5 Hitlers Reichskanzlerschaft 78 4. -

150 Jahre Sozialdemokratie Im Heutigen Sachsen-Anhalt
Beiträge zur Geschichte der Sozialdemokratie in Sachsen-Anhalt Heft 6 Historische Kommission des SPD-Landesverbandes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 150 Jahre Sozialdemokratie im heutigen Sachsen-Anhalt Inhalt Geleitwort (Katrin Budde) .................................................................................... 2 Vorwort (Dr. Rüdiger Fikentscher) ....................................................................... 4 Geschichte (der SPD Sachsen-Anhalt für den Wikipedia-Internetauftritt) ........... 6 Anfänge der Arbeiterbewegung und Vorgeschichte der SPD in Sachsen-Anhalt (Prof. Dr. Mathias Tullner) ................................................................................... 8 Seit 1890 den selben Namen: SPD (Dr. Rüdiger Fikentscher) ........................... 15 Sozialdemokratie und Gewerkschaften 1890-1914 in Magdeburg (Prof. Dr. Klaus-Erich Pollmann) ........................................................................................ 23 Gustav Stollberg (1866 – 1928) – Burgs Sozialdemokrat der ersten Stunde (Udo Krause) ................................................................................................................ 32 Die verfeindeten Brüder im einstigen SPD-Parteibezirk Magdeburg (Dr. Beatrix Herlemann) .......................................................................................................... 36 Karl Mödersheim (1888 – 1952) - Ein erfolgreicher Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Stadt Leuna (Dr. Ralf Schade) .............................................. 56 Willi Brundert - ein Sozialdemokrat -

Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History
Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History Edited by Cornelia Wilhelm Volume 8 Jews and Germans in Eastern Europe Shared and Comparative Histories Edited by Tobias Grill An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-048937-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-049248-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-048977-4 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Grill, Tobias. Title: Jews and Germans in Eastern Europe : shared and comparative histories / edited by/herausgegeben von Tobias Grill. Description: [Berlin] : De Gruyter, [2018] | Series: New perspectives on modern Jewish history ; Band/Volume 8 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2018019752 (print) | LCCN 2018019939 (ebook) | ISBN 9783110492484 (electronic Portable Document Format (pdf)) | ISBN 9783110489378 (hardback) | ISBN 9783110489774 (e-book epub) | ISBN 9783110492484 (e-book pdf) Subjects: LCSH: Jews--Europe, Eastern--History. | Germans--Europe, Eastern--History. | Yiddish language--Europe, Eastern--History. | Europe, Eastern--Ethnic relations. | BISAC: HISTORY / Jewish. | HISTORY / Europe / Eastern. Classification: LCC DS135.E82 (ebook) | LCC DS135.E82 J495 2018 (print) | DDC 947/.000431--dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2018019752 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de. -

Reflexionen Über Das Ende Der Weimarer Republik. Die
Diskussion ANDREAS RÖDDER REFLEXIONEN ÜBER DAS ENDE DER WEIMARER REPUBLIK Die Präsidialkabinette 1930-1932/33. Krisenmanagement oder Restaurationsstrategie? Das Scheitern der parlamentarisch-demokratischen Republik von Weimar und der folgen de Machtantritt der Nationalsozialisten werfen nach wie vor die Frage nach Zwangsläu figkeiten und Alternativen in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts auf: Ließ sich die Entwicklung des politischen Systems überhaupt steuern? Welche Lösungen der ,,deutsche[n] Staatskrise 1930-1933"1 wurden erwogen und vorbereitet? Zugespitzt: Stand die Regierungspolitik der Präsidialkabinette im Zeichen von „Restaurationsstrategie oder Krisenmanagement"? Unter diesem Titel diskutierten erfahrene Kenner und jüngere Hi storiker im Rahmen eines von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Kolloquiums vom 24. bis 26. September 1997 im Historischen Institut der Universität Stuttgart Ergebnisse und Perspektiven der Forschung2. Erinnerung und Politik: Heinrich Brüning Die entscheidende Quelle für Motive, Ziele und Potentiale seiner Reichskanzlerschaft sind Heinrich Brünings Memoiren. Aufgrund quellenkritischer Untersuchungen hält A. Rödder die Memoiren jedoch insbesondere in den zentralen und nicht anderweitig Überlieferten Aussagen, die allein die These eines Restaurationsprogramms der Regierung Brüning zur Wiederherstellung der Monarchie tragen, für unglaubwürdig3. Bei dem Ver- 1 Heinrich August Winkler (Hrsg.), Die deutsche Staatskrise 1930-1933. Handlungsspielräume und Alternativen, München 1992. 2 Anläßlich der Emeritierung von Eberhard Jäckel kamen unter der wissenschaftlichen Leitung von Eberhard Kolb (Köln) zusammen: Knut Borchardt (München), Karl Dietrich Bracher (Bonn), Christian Hartmann (München),-Johannes Hürter (Bonn), Eberhard Jäckel (Stuttgart), Tilman Koops (Koblenz), Klaus A. Lankheit (München), Rudolf Morsey (Speyer), Wolfram Pyta (Köln), Ludwig Richter (Köln), Andreas Rödder (Stuttgart), Gerhard Schulz (Tübingen), Gabriel Seiberth (Berlin), Henry A. Turner (Yale), Udo Wengst (München) und Andreas Wirsching (Tübingen). -
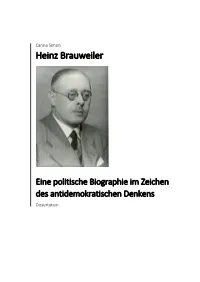
Dissertationcarinasimon.Pdf (3.051Mb)
Carina Simon Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades der Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) eingereicht im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel vorgelegt von Carina Simon 2016 Disputation am 22.5.2017 Danksagung Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, einigen Menschen meinen Dank auszusprechen, ohne deren Hilfe die Abgabe meiner Doktorarbeit nur schwer vorstellbar gewesen wäre. An erster Stelle danke ich meinen Betreuern Professor Dr. Winfried Speitkamp und Professor Dr. Jens Flemming. Letzterer hat mich von Beginn meines Studiums an begleitet. Ohne Professor Dr. Flemming wäre meine Begeisterung für das Studium der Geschichte und die Entscheidung für eine Dissertation nie in dem Maße vorstellbar gewesen. Er hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mir geholfen, auch wenn es einmal schwerere Phasen gab. Darüber hinaus danke ich Herrn Professor Dr. Dietmar Hüser und Herrn Professor Dr. Friedhelm Boll sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Geschichte der Universität Kassel, hier ganz besonders Silke Stoklossa-Metz. Darüber hinaus möchte ich mich bei Dr. Christian Wolfsberger (✝) und Gerd Lamers vom Stadtarchiv Mönchengladbach für ihre Hilfe bedanken; sowie bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Archive und Bibliotheken, die ich zu Recherchezwecken aufgesucht habe. Weiterhin danken möchte ich der B. Braun Melsungen AG für ihre finanzielle Unterstützung im Rahmen meines Stipendiums, was mir über einen langen Zeitraum ein sorgenfreies Arbeiten ermöglichte. Danken möchte ich vor allem meiner Familie, hier vor allem meinen Eltern, Hella und Alexander Simon und meinem Bruder Christopher Simon. -

INT Gossweiler 24/04/06 14:01 Page 1
INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 1 Hitler, l’irrésistible ascension? Essais sur le fascisme INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 2 LES EDITIONS ADEN Les Editions Aden Titre original: Aufsätze zum édition Gilles Martin 44 rue A. Bréart Faschismus © Pahl-Rugenstein Verlag, Köln, graphisme Atelier 1060 Bruxelles 1988 des grands pêchers Belgique ([email protected]) Tél.00 32 2 5344661 Traduit de l'allemand par Bruno assistance éditoriale Fax. 00 32 2 5344662 Vannechel et Fabien Rondal Marie David, Julie Matagne [email protected] © Kurt Gossweiler et Éditions et Patrick Moens www.aden.be Aden, 2006 impression EPO (www.epo.be) En collaboration avec l'Institut d'Etudes Marxistes (INEM asbl) Études Marxistes n°67-68 Rue de la Caserne 68, 1000 Bruxelles Tel: 32 (0)2/504 01 44 Fax: 32 (0)2/513 98 31 www.marx.be INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 3 Kurt Gossweiler Préface d’Annie Lacroix-Riz HITLER L’IRRESISTIBLE´ ASCENSION? Essais sur le fascisme collection epo aden INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 4 INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 5 Préface Pourquoi faut-il lire ou relire Kurt Gossweiler? Par Annie Lacroix-Riz, professeur d’histoire contemporaine, université Paris 7 On ne peut que saluer la décision de livrer au public fran- cophone quelques travaux de Kurt Gossweiler couvrant près de trois décennies (de 1953 à 1980) et consacrés à l’analyse du fascisme allemand. L’historien marxiste est- allemand y traite des conditions de son installation depuis les années vingt, recensant ses soutiens de classe préco- ces, des Junkers au grand capital, de l’industrie lourde à l’IG Farben, tous secteurs de l’économie confondus. -

Heft 1 Januar 1999
VIERTELJAHRSHEFTE FÜR Zeitgeschichte Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von KARL DIETRICH BRACHER HANS-PETER SCHWARZ HORST MÖLLER in Verbindung mit Theodor Eschenburg, Rudolf v. Albertini, Dietrich Geyer, Hans Mommsen, Arnulf Baring und Gerhard A. Ritter Redaktion: Manfred Kittel, Udo Wengst, Jürgen Zarusky Chefredakteur: Hans Woller Stellvertreter: Christian Hartmann Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstr. 46 b, 80636 München, Tel. 1268 80, Fax 12317 27 47. Jahrgang Heft 1 Januar 1999 INHALTSVERZEICHNIS AUFSATZE Heinrich August Demokratie oder Bürgerkrieg. Die russische Winkler Oktoberrevolution als Problem der deutschen Sozialdemokraten und der französischen Sozialisten . 1 Bogdan Musial NS-Kriegsverbrecher vor polnischen Gerichten ... 25 Hubert Zimmermann Franz Josef Strauß und der deutsch-amerikanische Währungskonflikt in den sechziger Jahren 57 DISKUSSION Andreas Rödder Reflexionen über das Ende der Weimarer Republik. Die Präsidialkabinette 1930-1932/33. Krisen management oder Restaurationsstrategie? 87 II Inhaltsverzeichnis DOKUMENTATION Bernd Stöver Der Fall Otto John. Neue Dokumente zu den Aus sagen des deutschen Geheimdienstchefs gegenüber MfS und KGB 103 NOTIZ Die 5. Internationale Konferenz der Herausgeber diplomatischer Akten. Eine Tagung des Auswärti gen Amts und des Instituts für Zeitgeschichte am 1./2. Oktober 1998 in Bonn (Ilse Dorothee Pautsch/ Rainer A. Blasius) 137 ABSTRACTS 145 MITARBEITER DIESES HEFTES 147 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte im Internet http://www.oldenbourg.de Verlag und Anzeigenverwaltung: R. Oldenbourg Verlag GmbH, Rosenheimer Straße 145, 81671 München. Für den Inhalt verantwortlich: Horst Möller; für den Anzeigenteil: Suzan Hahnemann. Erscheinungsweise: Vierteljährlich. Jahresabonnement: Inland DM 101,- (DM 85,-+DM 16,- Versandspesen); Ausland DM 106,60 (DM 85,- +DM 21,60 Versandspesen). Studentenabonnement (nur Inland) DM 82,- (DM 66,- + DM 16,- Versandspesen); Einzelheft DM 29,- zzgl. -

Ghostwriter' Des ‚Herrenreiters'. Der Diskurs Edgar Julius Jungs Und Die Für Den Vizekanzler Papen Verfasste Marburger Rede Vom 17. Juni 1934
Reiner Küpper Der ‚Ghostwriter’ des ‚Herrenreiters’. Der Diskurs Edgar Julius Jungs und die für den Vizekanzler Papen verfasste Marburger Rede vom 17. Juni 1934 Ein Beitrag zur Analyse der Sprache im frühen Nationalsozialismus Series A: General & Theoretical Papers ISSN 1435-6473 Essen: LAUD 2010 Paper No. A767 Universität Duisburg-Essen Reiner Küpper Universität Duisburg – Essen, Germany Der ‚Ghostwriter’ des ‚Herrenreiters’. Der Diskurs Edgar Julius Jungs und die für den Vizekanzler Papen verfasste Marburger Rede vom 17. Juni 1934 Copyright by the author Reproduced by LAUD 2010 Linguistic Agency Series A University of Duisburg-Essen General and Theoretical FB Geisteswissenschaften Paper No. A767 Universitätsstr. 12 D- 45117 Essen Order LAUD-papers online: http://www.linse.uni-due.de/linse/laud/index.html Or contact: [email protected] ii Reiner Küpper Der ‚Ghostwriter’ des ‚Herrenreiters’. Der Diskurs Edgar Julius Jungs und die für den Vizekanzler Papen verfasste Marburger Rede vom 17. Juni 1934 Ein Beitrag zur Analyse der Sprache im frühen Nationalsozialismus i Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis.....................................................................................................................................ii Vorwort......................................................................................................................................................... 1 0 Theoretische Vorbemerkung ........................................................................................................ 2 1 Einleitende -
Ausschluss Von Ausgleichsleistungen Stellen Ergangener Entscheidungen Nicht in Einem Umfang, 2
Aufsatz | Körner - Ausschluss von Ausgleichsleistungen stellen ergangener Entscheidungen nicht in einem Umfang, 2. Die Ausgestaltung des Kostenrechts baut auf der Ausge- welcher über die anerkannten Folgen einer (offenen oder staltung des Verfahrensrechts auf, weshalb die Auslegung verdeckten) Teilklage hinausgeht. des Kostenrechts das Primat des Verfahrensrechts zu beach- ten hat. Als (vermeintlich) unangemessen empfundene Kos- tenfolgen rechtfertigen dagegen keine bestimmte Auslegung IV. Ergebnisse des Verfahrensrechts. 3. Sog. uneigentliche Hilfsanträge sind bei der Bemessung des 1. Sog. uneigentliche Hilfsanträge sind ohne Rücksicht auf Gebührenstreitwerts unabhängig davon zu berücksichtigen, das Vorliegen eines besonderen Klägerinteresses zulässig. ob über sie entschieden wird. Dies ergibt sich aus § 39 GKG. Abweichendes gilt auch für eine entsprechende Verbindung § 45 GKG trifft hierzu keine Aussage. Damit entfällt ein we- von denselben Anspruch betreffenden Teilklagen nicht. Eine sentlicher Anreiz, sog uneigentliche Hilfsanträge zu stellen. solche ist auch nicht in sich widersprüchlich. Ausschluss von Ausgleichsleistungen – Aktuelle Rechtsprechung zum Unwürdigkeitstatbestand des § 1 Abs. 4 AusgLeistG Regierungsdirektorin Gabriele Körner, Berlin* Das Ende vergangenen Jahres verkündete, inzwischen Handeln der Unternehmensleitung selbst sondern auch das rechtskräftige Urteil des VG Dresden und das bereits 2016 Handeln der Personen im Unternehmen, die befugt und da- verkündete Urteil des VG Gera, das mit der Ablehnung der mit verantwortlich -

Księga Śladami Mistrza
Śladami Mistrza Publikacje Instytutu Historii 116 Śladami Mistrza Prace z historii najnowszej dedykowane Profesorowi Antoniemu Czubińskiemu Pod redakcją Stanisława Sierpowskiego Poznań 2013 © Copyright by Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2013 Publikacja sfinansowana przez Fundusz im. Profesora Antoniego Czubińskiego oraz Instytut Historii UAM Recenzenci prof. dr hab. Halina Parafianowicz dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG Indeks sporządził Tomasz Karpiński Redakcja Ewa Dobosz Projekt okładki Piotr Namiota Skład Małgorzata Nowacka ISBN 978-83-63047-34-4 Instytut Historii UAM Święty Marcin 78 61-809 Poznań tel./fax 61 829 47 25 e-mail: [email protected] www.historia.amu.edu.pl DRUK Zakład Graficzny UAM ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań Pamięci Profesora Antoniego Czubińskiego zmarłego przed 10 laty wybitnego historyka Człowieka o wielkim sercu i ogromnej życzliwości dla każdego; ciepłych, serdecznych uczuciach na ogół skrywanych, któremu nieobca była radość i gromki śmiech, a także uczucie żalu, łzy wzruszenia, zachwyt nad pięknem i nostalgia nad przemijającym czasem. Uczył nas pracowitości, naukowej dociekliwości i staranności, uczciwości wobec siebie i innych, nawet mniej znanych. Wielu, bardzo wiele Mu zawdzięcza, a obecni w tomie autorzy także to, że być może nie byliby tu, gdzie są. Zachowamy na zawsze w naszych sercach dobre wspomnienia i wdzięczność. Spis treści Ad perpetuam rei memoriam (St a n i S ł a w Si e r p o w S k i )........................... 7 Ma r i a n ol S z e w S k i , Antoni Czubiński ....................................... 15 an d r z e j Ch o n i a w k o , Antoniego Czubińskiego potyczki nie tylko z cenzurą ........ -

„Die Nationalsozialistische Propaganda in Sachsen 1921-1945“
„Die nationalsozialistische Propaganda in Sachsen 1921-1945“ Von der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität Leipzig angenommene D I S S E R T A T I O N zur Erlangung des akademischen Grades DOCTOR PHILOSOPHIAE (Dr. phil.) vorgelegt von Stephan Dehn geboren am 14. Juni 1986 in Grimma Gutachter: Prof. Dr. Günther Heydemann PD. Dr. Thomas Schaarschmidt Tag der Verteidigung: 7. Juni 2016 I. Einleitung S. 5 II. Einführung in die Problematik 1. Forschungsstand 1.1 Studien zum Nationalsozialismus in Sachsen S. 10 1.2 Propaganda – Begriff und Funktion 1.2.1 Definitionen und Theorien S. 17 1.2.2 Forschungsüberblick zur nationalsozialistischen Propaganda S. 23 1.3 Quellenlage 1.3.1 Gedruckte Quellen und Literatur bis 1945 S. 30 1.3.2 Spezifische Archivbestände S. 34 1.3.3 Datenbank S. 36 2. Sachsen zwischen 1918 und 1945 2.1 Der „gespaltene Freistaat“ in der Weimarer Republik S. 39 2.2 Entwicklung der sächsischen NSDAP bis 1933 S. 44 2.3 Die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur S. 57 III. Die Propaganda der sächsischen NSDAP zwischen 1921 und 1933 1. Organisationsstrukturen 1.1 Propaganda der Ortsgruppen bis zum Verbot 1921-1922 S. 63 1.2 Verbotszeit und Völkisch-Sozialer Block 1923-1925 S. 66 1.3 Wiederaufbau der Propagandaorganisation und Etablierung 1925-1929 S. 68 1.4 Propaganda einer Massenpartei 1929-1933 S. 74 2. Propagandapraxis der NSDAP in Sachsen 2.1 Versammlungspropaganda 2.1.1 Definitionen der Versammlungspropaganda S. 78 2.1.2 Nationalsozialistische Versammlungen in Sachsen S. 83 2.1.3 Aufmärsche im Propagandakanon der NSDAP S. -

Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History
Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History Edited by Cornelia Wilhelm Volume 8 Jews and Germans in Eastern Europe Shared and Comparative Histories Edited by Tobias Grill An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-048937-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-049248-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-048977-4 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Grill, Tobias. Title: Jews and Germans in Eastern Europe : shared and comparative histories / edited by/herausgegeben von Tobias Grill. Description: [Berlin] : De Gruyter, [2018] | Series: New perspectives on modern Jewish history ; Band/Volume 8 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2018019752 (print) | LCCN 2018019939 (ebook) | ISBN 9783110492484 (electronic Portable Document Format (pdf)) | ISBN 9783110489378 (hardback) | ISBN 9783110489774 (e-book epub) | ISBN 9783110492484 (e-book pdf) Subjects: LCSH: Jews--Europe, Eastern--History. | Germans--Europe, Eastern--History. | Yiddish language--Europe, Eastern--History. | Europe, Eastern--Ethnic relations. | BISAC: HISTORY / Jewish. | HISTORY / Europe / Eastern. Classification: LCC DS135.E82 (ebook) | LCC DS135.E82 J495 2018 (print) | DDC 947/.000431--dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2018019752 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de.