NEVA 32 0009-0024.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
The multiple strategies of an insect herbivore to overcome plant cyanogenic glucoside defence Pentzold, Stefan; Zagrobelny, Mika; Roelsgaard, Pernille Sølvhøj; Møller, Birger Lindberg; Bak, Søren Published in: PLOS ONE DOI: 10.1371/journal.pone.0091337 Publication date: 2014 Document version Publisher's PDF, also known as Version of record Citation for published version (APA): Pentzold, S., Zagrobelny, M., Roelsgaard, P. S., Møller, B. L., & Bak, S. (2014). The multiple strategies of an insect herbivore to overcome plant cyanogenic glucoside defence. PLOS ONE, 9(3), [e91337]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091337 Download date: 23. sep.. 2021 The Multiple Strategies of an Insect Herbivore to Overcome Plant Cyanogenic Glucoside Defence Stefan Pentzold, Mika Zagrobelny, Pernille Sølvhøj Roelsgaard, Birger Lindberg Møller, Søren Bak* Plant Biochemistry Laboratory and Villum research center ‘Plant Plasticity’, Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark Abstract Cyanogenic glucosides (CNglcs) are widespread plant defence compounds that release toxic hydrogen cyanide by plant b- glucosidase activity after tissue damage. Specialised insect herbivores have evolved counter strategies and some sequester CNglcs, but the underlying mechanisms to keep CNglcs intact during feeding and digestion are unknown. We show that CNglc-sequestering Zygaena filipendulae larvae combine behavioural, morphological, physiological and biochemical strategies at different time points during feeding and digestion to avoid toxic hydrolysis of the CNglcs present in their Lotus food plant, i.e. cyanogenesis. We found that a high feeding rate limits the time for plant b-glucosidases to hydrolyse CNglcs. Larvae performed leaf-snipping, a minimal disruptive feeding mode that prevents mixing of plant b-glucosidases and CNglcs. -

Redalyc.New and Interesting Portuguese Lepidoptera Records from 2007 (Insecta: Lepidoptera)
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Marabuto, E.; Maravalhas, E.; Pires, P.; Cardoso, J. P. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2007 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 36, núm. 143, septiembre, 2008, pp. 283-300 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45512164002 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 283-300 New and interesting Po 4/9/08 17:37 Página 283 SHILAP Revta. lepid., 36 (143), septiembre 2008: 283-300 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267 New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2007 (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, E. Marabuto, E. Maravalhas, P. Pires & J. P. Cardoso Abstract 38 species are added to the Portuguese Lepidoptera fauna and two species deleted, mainly as a result of fieldwork undertaken by the authors in the last year. In addition, second and third records for the country and new food-plant data for a number of species are included. A summary of papers published in 2007 affecting the Portuguese fauna is included. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, geographical distribution, Portugal. Novos e interessantes registos portugueses de Lepidoptera em 2007 (Insecta: Lepidoptera) Resumo Como resultado do trabalho de campo desenvolvido pelos autores principalmente no ano de 2007, são adicionadas 38 espécies de Lepidoptera para a fauna de Portugal e duas são retiradas. -

El Género Heterogynis Rambur, 1837 En Catalunya (Lepidoptera: Zygaenoidea: Heterogynidae)(*)
Heteropterus Revista de Entomología 2009 Heteropterus Rev. Entomol. 9(2): 123-129 ISSN: 1579-0681 El género Heterogynis Rambur, 1837 en Catalunya (Lepidoptera: Zygaenoidea: Heterogynidae)(*) J.J. PÉREZ DE-GREGORIO, M. RONDÓS, I. ROMAÑÁ Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona; Passeig Picasso s/n; Parc de la Ciutadella; E-08003 Barcelona Resumen Dos de las cuatro especies ibéricas del género Heterogynis Rambur, 1837 han sido halladas hasta la fecha en Catalunya: H. penella (Hübner, 1819) y H. canalensis Chapman, 1904. Se exponen los caracteres morfológicos que permiten la identificación de las cuatro, su biología y su distribución actualmente conocida en la Península Ibérica y en Catalunya en particular. Palabras clave: Heterogynis, Heterogynidae,Península Ibérica, Catalunya, faunística. Laburpena Heterogynis Rambur, 1837 generoa Katalunian (Lepidoptera: Zygaenoidea: Heterogynidae) Heterogynis Rambur, 1837 generoaren lau iberiar espezieetako bi aurkitu izan dira gaurdaino Katalunian: H. penella (Hübner, 1819) eta H. canalensis Chapman, 1904. Lau espezieen identifikaziorako balio duten ezaugarri morfolo- gikoak azaltzen dira, bai eta haien biologiari buruzko zenbait datu eta gaur egun ezaguna den banaketa ere, Iberiar Penintsulakoa baina bereziki Kataluniakoa. Gako-hitzak: Heterogynis, Heterogynidae, Iberiar Penintsula, Katalunia, faunistika. Abstract The genus Heterogynis Rambur, 1837 in Catalonia (Lepidoptera: Zygaenoidea: Heterogynidae) Two of the four Iberian species belonging to the genus Heterogynis Rambur, 1837 have been found hitherto in Catalonia: H. penella (Hübner, 1819) and H. canalensis Chapman, 1904. The morphological characters allowing identification of those four species together with some data on their biology and Iberian distribution are given, and particularly the Catalonian distribution of the two species mentioned. Key words: Heterogynis, Heterogynidae, Iberian Peninsula, Catalonia, faunistics. -

A New Taxon of the Family Heterogynidae Latreille (Hym., Aculeata) 299-303 ©Zoologisches Museum Hamburg, 299 7
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg Jahr/Year: 1965 Band/Volume: 3 Autor(en)/Author(s): Nagy Carol G. Artikel/Article: A New Taxon of the Family Heterogynidae Latreille (Hym., Aculeata) 299-303 ©Zoologisches Museum Hamburg, www.zobodat.at 299 7 Ent. Mitt. Zool. Staatsinst. Zool. Mus. Hamburg Nr. 64 (1969) A New Taxon of the Family HeterogynidaeL atreille (Hym., Aculeata) by Carol G. N agy 1) (with 6 figures) The genera included by L atreille in his 3-me Famille Hétérogy- nes-Heterogyna appear as a group of Hymenoptera with winged males and wingless females. According to L atreille 1825 (Familles na turelles du Règne Animal, p. 451) two tribes belonging in this family: Formicariae and Mutillariae. The latter are component by a Dorylus, Apterogyna, Mutilla, Psammotherma, Myrmosa, Scleroderma, Methoca and Myrmecodes. K lug 1840, used this familial name only for the second tribus. G erstaecker 1855, 1863 introduced here the Scolia and Sapyga. M ocsâry 1881 established the correct name as Heterogynidae, including here the Pristocerinae, Mutillinae, Scoliinae, Myzininae, Tiphiinae, Methocinae, Myrmosinae and Sapyginae. H andlirsch 1936 adopted this division, classifying here all major categories as subfamilies. Since M ocsâry not designated nominative genus as type of his family. From this standpoint we now select the new species described below to be type-species of genus Heterogyna. The species described below appear to be distinct from any of the families previously described in Aculeata. This type designation causes no alte ration in the use of generic names, but would cause a most unfortunate alteration between the familiar names Heterogynidae L atreille 1825 (Hymenoptera) and Heterogynidae K irby 1892 (Lepidoptera). -

Rote Listen Von Rheinland-Pfalz
Naturschutz und Landschaftspflege Rote Listen von Rheinland-Pfalz Quelle: Standardartenliste vom 08.11.2006 (Ref. 41) Herausgeber: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz Kaiser-Friedrich-Str. 7 55116 Mainz Ansprechpartner: Standardartenliste und Redaktion: Claudia Röter-Flechtner Tel.: 06131 / 6033 - 1428 [email protected] : Rote Listen: Ludwig Simon Tel.: 06131 / 6033 - 1434 [email protected] Dr. Dieter Rühl Tel.: 06131 / 6033 - 1430 [email protected] Auflage: 1. Auflage, Dezember 2006 2. erweiterte Auflage, September 2007 Einleitung...................................................................................................................................... 1 Kategorien der Rote Listen........................................................................................................... 2 Rote Liste Krebse – Crustacea .................................................................................................... 3 Rote Liste Libellen – Odonata...................................................................................................... 4 Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen ................................................................... 4 Sortierung nach deutschen Artnamen ................................................................................ 6 Rote Liste Geradflügler – Orthoptera ........................................................................................... 8 Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen .................................................................. -
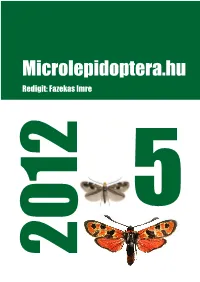
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize
Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

Official Lists and Indexes of Names in Zoology
Official Lists and Indexes of Names in Zoology Names placed on the Official Lists and Indexes in Opinions and Directions published in Volumes 43 (1986) to 63 (2006) of the Bulletin of Zoological Nomenclature This section lists in alphabetic order every family-group, generic and specific name placed on the Official Lists and Indexes; specific names are given in their original binomen. Names on the Official Lists are in bold type and those on the Official Indexes in non-bold type.The Direction or Opinion number under which each name was placed on the Official List or Index is given at the end of that entry. aalensis, Loligo, Schübler in Zieten, 1832, Die Versteinerungen Württembergs, Expeditum des Werkes ‘Unsere Zeit’, part 5, p. 34 (specific name of the type species of Loligosepia Quenstedt, 1839) (Cephalopoda, Coleoidea). Op. 1914 abbreviatus, Carabus, Fabricius, 1779, Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Naturhistorie und Oekonomie, p. 263, ruled under the plenary power not to be given priority over Lesteva angusticollis Mannerheim, 1830 whenever they are considered to be synonyms (Coleoptera). Op. 2086 abbreviatus, Carabus, Fabricius, 1779, Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Naturhistorie und Oekonomie, p. 263, ruled under the plenary power not to be given priority over Lesteva angusticollis Mannerheim, 1830 whenever they are considered to be synonyms (Coleoptera). Op. 2086 aberrans, Philonthus, Cameron, 1932, The fauna of British India including Ceylon and Burma. Coleoptera. Staphylinidae, vol. 3, p. 111, ruled under the plenary power to be not invalid by reason of being a junior primary homonym of P. aberrans Sharp, 1876 (Coleoptera). -

Parasitoids of Heterogynis Rambur (Lepidoptera: Zygaenoidea, Heterogynidae)
Arch Biol Sci. 2018;70(4):749-755 https://doi.org/10.2298/ABS180709039Z Parasitoids of Heterogynis Rambur (Lepidoptera: Zygaenoidea, Heterogynidae) Vladimir Žikić1, Saša S. Stanković1,*, Hans-Peter Tschorsnig2, Yeray Monasterio León3 and Josef J. De Freina4 1 Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, University of Niš, Višegradska 33, 18000 Niš, Serbia 2 Staatliches Museum fur Naturkunde, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart, Germany 3 Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA) Madre de Dios, 14-7D. 26004. Logroño, La Rioja, Spain 4 Museum Witt, Tengstraße 33, 81541 Munchen, Germany *Corresponding author: [email protected] Received: July 9, 2018; Revised: August 28, 2018; Accepted: August 31, 2018; Published online: September 26, 2018 Abstract: Nine parasitoids of the moth genus Heterogynis are presented: six species of Hymenoptera from the families Chalcididae, Eulophidae and Ichneumonidae (Agrothereutes hospes (Tschek), Baryscapus endemus (Walker), Brachymeria inermis (Fonscolombe), Diplazon laetatorius (F.), Itoplectis maculator (F.) and Trichomalopsis heterogynidis Graham), and three Diptera, family Tachinidae (Compsilura concinnata (Meigen), Exorista segregata (Rondani) and Phryxe hirta (Bigot)). Two of these species, Trichomalopsis heterogynidis and Phryxe hirta, are oligophagous parasitoids specialized on the genus Heterogynis. We also identified two newly recorded parasitoids of Heterogynis: Brachymeria inermis (Chalcididae) and Diplazon laetatorius (Ichneumonidae). Key words: Heterogynis, parasitoids, Chalcidoidea, Ichneumonidae, Tachinidae. INTRODUCTION However, most Heterogynis parasitoid communities have not been studied yet in detail. Heterogynis Rambur is the only genus within the Herein we present all known parasitoids that have family Heterogynidae Hampson and it comprises been reared from Heterogynis species, revealing rel- about 15 species [1-3], distributed in Europe and the evant information on their biology, other hosts and Maghreb region of North Africa. -

Gratuita Para Socios De La SEA Número 67. Fecha
Publicación semestral (dos volúmenes al año), gratuita para socios de la S. E. A. Número 67. Fecha: 31 de Diciembre de 2020/ 2º semestre 2020 BOLN. S.E.A.: Avda. Francisca Millán Serrano, nº 37 (antigua Radio Juventud), 50012 Zaragoza (España). Tef. 976-324415.– [email protected] – [email protected] PUBLICA: SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARAGONESA (S.E.A.) wwww.sea-entomologia.org g IMPRIME: GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - Zaragoza. I. S. S. N.: 1134-6094 DEP. LEGAL: Z-1118-93 PORTADA: Emmelina argoteles (Meirick, 1922). Lepidoptera: Pterophoridae. Dibujo de Enrique Murria. COMITÉ EDITORIAL: EDITOR: Antonio Melic (Zaragoza). EDITORES TEMÁTICOS: Coleoptera: Lucía Arnaiz (León), Pablo Bercedo Páramo (León), Jorge Lobo (Madrid), José Ignacio López-Colón (Madrid), Ignacio Pérez (La Rioja), Ignacio Ribera (†), Antonio Sánchez Ruiz (Albacete), José Zapata De la Vega (Madrid). Diptera: Miguel Carles-Tolrá (Barcelona). Escorpiones: Rolando Teruel (Cuba). Hemiptera (Heteroptera): Marta Goula (Barcelona). Hemiptera (Sternorrhyncha, Clypeorrhycha y Archaeorrhyncha): Nicolás Pérez (Valencia). Hymenoptera: Leopoldo Castro (Teruel). Hymenoptera (Formicidae): Xavier Espadaler (Barcelona). Lepidoptera: Joaquin Baixeras (Valencia), Enrique García-Barros (Madrid), Sergio Montagud (Valencia). Neuroptera: Daniel Grustán Isabela (Zaragoza). Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera: Antonio Torralba (Huesca). Orthoptera: David Llucià Pomares (Barcelona). Quilopoda: Andrés García Ruiz (Madrid). Crustacea: LLuc García (Palma). Conservación: Andrés Millán (Murcia), Ignacio Ribera (†). Ecología: Jorge Lobo (Madrid), Marcos Méndez (Madrid). Entomología Aplicada: Ignacio Pérez (La Rioja). Etnoentomología: Eraldo Medeiros Costa-Neto (Brasil). Phoron: Nicolás Pérez (Valencia). MAQUETACIÓN DEL VOLUMEN: Denis Melic & Antonio Melic. NUEVAS NORMAS DE PUBLICACIÓN: VER ver página 480-481 y http://sea-entomologia.org/normas.htm SUSCRIPCION: Ver página 482 y http://sea-entomologia.org/asociarsecompras.htm Correspondencia y contactos relacionados con la revista: Avda. -

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE Montclar (04)
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE Montclar (04) Volet Naturel d’Etude d’Impact Réalisé pour le compte de Chef de projet Marielle TARDY 06 61 36 84 14 [email protected] Approbation Silke HECKENROTH ECO-MED Ecologie & Médiation S.A.R.L. au capital de 150 000 euros TVA intracommunautaire FR 94 450 328 315 | SIRET 450 328 315 000 38 | NAF 7112 B Tour Méditerranée 13ème étage, 65 avenue Jules Cantini 13298 MARSEILLE Cedex 20 +33 (0)4 91 80 14 64 +33 (0)4 91 80 17 67 [email protected] www.ecomed.fr Référence du rapport : 1611-EM-2343-RP-VNEI-PV-VOLTALIA-MONTCLAR04-2B Remis le 28/11/2016 Référence bibliographique à utiliser ECO-MED 2016 – Volet naturel d’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque – VOLTALIA – Montclar (04) – 132 p. Suivi de la version du document 27/07/2016 – Version 1 (A) 28/11/2016 – Version 2 (B) Porteur du projet VOLTALIA EUROPARC PICHAURY – Bât. C2 1330 rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière 13852 AIX-EN-PROVENCE Contact Projet : Albin GARRIGUE Coordonnées : 04 42 53 53 80, [email protected] Equipe technique ECO-MED Marielle TARDY – Chef de projet – Entomologiste Maxime AMY - Ornithologue Martin DALLIET - Botaniste Julie JAIL - Mammalogue Sandrine ROCCHI – Géomaticienne Erwann THEPAUT - Mammalogue Le présent rapport a été conçu par l’équipe ECO-MED selon les normes mises en place dans le cadre de son Projet de Certification ISO 9001 et a été soumis à l’approbation de Silke HECKENROTH. ECO-MED Ecologie & Médiation S.A.R.L. au capital de 150 000 euros TVA intracommunautaire FR 94 450 328 315 | SIRET 450 328 315 000 38 | NAF 7112 B Tour Méditerranée 13ème étage, 65 avenue Jules Cantini 13298 MARSEILLE Cedex 20 +33 (0)4 91 80 14 64 +33 (0)4 91 80 17 67 [email protected] www.ecomed.fr Table des matières Résumé non technique ............................................................................................................................... -

Official Lists and Indexes of Names and Works in Zoology
OFFICIAL LISTS AND INDEXES OF NAMES AND WORKS IN ZOOLOGY Supplement 1986-2000 Edited by J. D. D. SMITH Copyright International Trust for Zoological Nomenclature 2001 ISBN 0 85301 007 2 Published by The International Trust for Zoological Nomenclature c/o The Natural History Museum Cromwell Road London SW7 5BD U.K. on behalf of lICZtN] The International Commission on Zoological Nomenclature 2001 STATUS OF ENTRIES ON OFFICIAL LISTS AND INDEXES OFFICIAL LISTS The status of names, nomenclatural acts and works entered in an Official List is regulated by Article 80.6 of the International Code of Zoological Nomenclature. All names on Official Lists are available and they may be used as valid, subject to the provisions of the Code and to any conditions recorded in the relevant entries on the Official List or in the rulings recorded in the Opinions or Directions which relate to those entries. However, if a name on an Official List is given a different status by an adopted Part of the List of Available Names in Zoology the status in the latter is to be taken as correct (Article 80.8). A name or nomenclatural act occurring in a work entered in the Official List of Works Approved as Available for Zoological Nomenclature is subject to the provisions of the Code, and to any limitations which may have been imposed by the Commission on the use of that work in zoological nomenclature. OFFICIAL INDEXES The status of names, nomenclatural acts and works entered in an Official Index is regulated by Article 80.7 of the Code.