Definitive Version
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2006-05-24.Pdf
Mercredi 24 mai 2006 Fr.s. 2.- / € 1,30 No 39300 JA 2300 La Chaux-de-Fonds L’autre Mondial Petite mise au point Gérard Castella arrive Après celui d’Espacité, voici le pro- Des fidèles du vallon de Saint-Imier ont L’ancien entraîneur du Lausanne-Sport gramme du deuxième écran géant du mal vécu les restructurations de l’Eglise et apposera ce matin sa signature sur le con- Mondial d’Eté Tchaux. Les autres anima- le partenariat avec Espace noir. Le pasteur trat qui le lie pour les deux prochaines tions sont abandonnées. page 5 Matteo Silvestrini s’explique. page 11 saisons à Neuchâtel Xamax. page 23 LA CHAUX-DE-FONDS PAROISSES RÉFORMÉES FOOTBALL CINDY La peur La facture a fondu du vide DÉNEIGEMENT L’opération «entretien hivernal réduit» a porté ses fruits: 800.000 francs ont été économisés de novembre à avril. L’effort se concentre sur l’entretien des routes Et si Cindy ne devenait pas la «Nouvelle Star» 2006? Et si aucune maison de disques ne s’approchait d’elle? La chanteuse neu- châteloise parle de ces éventualités. page 32 ÀLAUNE COL-DES-ROCHES L’eau va couler aux Moulins page 6 DOMBRESSON Le grand raout des chanteurs Sur les 8 à 10 millions de francs consacrés chaque année au déneige- hiver qui a été particulièrement rigoureux et long. L’effort se poursuivra, page 8 ment des routes, les restrictions budgétaires décidées par le Conseil notamment sur l’entretien des routes. PHOTO LEUENBERGER d’Etat ont permis d’économiser près de 800.000 francs. Malgré un page 3 SOMMAIRE Combattre les causes OPINION Par François Nussbaum Cinés-loisirs 14 Météo 16 de la violence Refus du simplisme Feuilleton 20 acriminalitédes tés à mener seront efficaces lides barrières sociales, psy- Bourse 21 SOCIAL Le phénomène n’est pas jeunes, c’est la et agiront sur les causes. -

Die Täufer Des Erguels Im 18. Jahrhundert*
Die Täufer des Erguels im 18. Jahrhundert* von MARTIN MEZGER Die Ansländerpolitik am Ende des 17.Jahrhunderts In einem Schreiben an den Fürstbischof1 beklagten sich am 27. Januar 1693 die fünf Gemeinden der Kirchgemeinde St-Imier2, eine ganze Anzahl von fremden Familien und Personen aus Bern, Neuenburg, Valangin und anderen Orten hätte sich im Erguel niedergelassen und die besten Plätze, sei es durch Kauf, sei es durch Pacht, besetzt, sehr zum Nachteil der Bür ger. Diese Ausländer bezahlten keine Steuern und ließen sich zu keinen Dienstleistungen beiziehen. Sie exportierten Frucht und Futter, was eine Knappheit im Lande zur Folge habe. Sie bezahlten zu hohe Pachtzinse und führten fremdes Vieh ein, das Seuchen mit sich bringe. Und weiter, sie zäunten Weideland ein, das die Gemeinden als Allmend für ihren Vieh stand beanspruchten. Die Gemeinden bitten den Bischof, diesem Zustand Abhilfe zu schaffen und zu verbieten daß in Zukunft Land an Ausländer verkauft oder verpachtet werde. In diesem Schreiben werden noch keine Täufer erwähnt, aber man darf vermuten, daß sich unter den genannten Ausländern aus Bern auch Täu fer befanden; vor allem unter den erwähnten Pächtern von Sennereien. Das Schreiben ist für uns hauptsächlich deshalb aufschlußreich, weil es zeigt, daß das Ausländerproblem im Erguel älter ist als die Einwanderung der Täufer. Denn das ist sicher, daß es sich nicht bei allen erwähnten Aus ländern um Täufer handelte, weil erstens Täufer kein Land kaufen, son dern nur pachten konnten, und weil zweitens auch Fremde aus Neuen burg, Valangin und anderswoher erwähnt sind. Bereits in diesem Schrei ben werden Argumente angeführt, die später gegen die Täufer verwendet werden: keine Steuern, Einfuhr von Vieh, Einzäunung von Allmend. -

Les Ruines Du Château D'erguël À Sonvilier
Les ruines du château d'Erguël à Sonvilier Author(en): Gutscher, Daniel Objekttyp: Article Zeitschrift: Mittelalter : Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins = Moyen Age : revue de l’Association Suisse Châteaux Forts = Medioevo : rivista dell’Associazione Svizzera dei Castelli = Temp medieval : revista da l’Associaziun Svizra da Chastels Band(Jahr): 1(1996) Heft 4 Erstellt am: 08.02.2013 Persistenter Link: http://dx.doi.org/10.5169/seals-164555 Nutzungsbedingungen Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als akzeptiert. Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre, Forschung und für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und unter deren Einhaltung weitergegeben werden. Die Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken möglich. Die Rechte für diese und andere Nutzungsarten der Inhalte liegen beim Herausgeber bzw. beim Verlag. SEALS Ein Dienst des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken c/o ETH-Bibliothek, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz [email protected] http://retro.seals.ch palizzata lignea?), mentre la costru¬ Resumaziun Anmerkungen è zione attuale 1 stata eretta sicura- Die damaligen Arbeiten lagen in der örtli¬ mente nel XIII sec, rinforzata dalla Grondas exchavaziuns dal 1990 chen Verantwortung von Ebbe Nielsen. - Daniel Gutscher, Ebbe Nielsen, Rei- possente muraglia di metri 1,5 di enfin il 1996 han gidà a localisar e Vgl. chenbach-Mülenen: Burg und Letzi. e di metri 5 di altezza. E rescuvrir il mir da defensiun ed il spessore archäologie der Schweiz 16, 1993/2, 105f a dei della chaste a 2 posta chiusura varco gola Mülenen Reichenbach BE. -

Bibliographie Jurassienne - 2015
Bibliographie Jurassienne - 2015 0. GENERALITES 00/02 Prolégomènes - Bibliographie - Bibliothéconomie 1 3e Salon international du livre et de la presse à Genève, 1989 / Editions Pro Jura. – [Moutier] : [Pro Jura], 1989. – 12 p. Sur la p. de titre : Jurassiennes éditions 2 Amstutz, Patrick, 1967-. – Werner Renfer, une aventure éditoriale : les oeuvres complètes : de l'édition SJE à l'édition AEPOL / Patrick Amstutz Tiré-à-part: Actes de la Société jurassienne d'émulation. – Porrentruy. - 2010, 2011, 2012, 25 p. 3 Bibliographie des Montagnes neuchâteloises, 1966-1970 / [réd. par Marie-Claude Liengme]. – La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la Ville, 1975. – XII, 203 p. ; 30 cm Multigr 4 Brutsch, Marguerite. – Bibliothèque de l'Ecole cantonale de Porrentruy : réorganisation et cataloguement des sections de sciences morales / Marguerite Brutsch, Claire Périer, Christiane Thompson-Suss. – Genève : Ecole de bibliothécaires, 1956. – 28 f. ; 30 cm Travail présenté à l'Ecole de bibliothécaires de Genève pour l'obtention du diplôme 5 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements / Ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes. 56, Colmar. – Paris : Bibliothèque nationale, 1969. – XXXV, 363 p. ; 25 cm 6 Fallet, Marius. – Die Berner Bauern in der früheren Herrschaft Erguel (St. Immertal und Tramlingen) und in der Herrschaft Ilfingen : Beiträge zur Geschichte der Berner Bauern im ehemaligen Fürstbistum Basel, dem heutigen Berner Jura : erster Beitrag / von M. Fallet-Scheurer Existe aussi sous forme de tiré à part In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde. – Bern. - 1949/2 ; S. 69-81 7 Gerster, Alban. – Restauration et transformation de la bibliothèque paroissiale de Saint-Ursanne / A. -
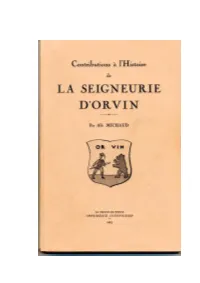
Jean Jacques Cellier.Pdf
Contributions à l’Histoire de LA SEIGNEURIE D’ORVIN refusa formellement en sa qualité de pasteur de le reconnaître, ayant lui seul le droit d’établir les régents, que ceux d’Evilard durent lui présenter l’élu afin qu’il l’examinât, que l’ayant trouvé à son gré, il l’ordonna comme maître d’école à Evilard. Il demande à S. A. l’autorisation de publier en chaire, dans l’église d’Orvin, que désormais ceux d’Evilard aient à baptiser leurs enfants à Orvin comme du passé et qu’on adjoigne au Consistoire d’Orvin un assesseur pris à Evilard. Enfin, il propose de remettre les armoiries de la Communauté d’Evilard dans le temple ; le tableau existant encore, cela leur ferait plaisir et ce serait une marque qu’Evilard dépend d’Orvin. François Faigaux quitta la cure d’Orvin en 1732. Il fut ensuite pasteur à Breda, professeur à Marbourg en 1742, puis pasteur et professeur à Cassel où il mourut en 1752. En 1732, à la suite d’intrigues ourdies contre le ministre Faigaux, le bruit court que la cure d’Orvin deviendra vacante, et à ce sujet, deux concurrents, les ministres Cellier et Prêtre, font le marché suivant : « Comme ainsi soit que nous les soussignés, Jean Jacques Cellier, diacre de St-Imier, et Jean Henri Prêtre, suffragant de Courtelary, ayant prévu qu’il pourrait arriver quelque difficulté et mésintelligence entre nous à raison de la concurrence dans laquelle nous pourrions nous rencontrer à la première vacation d’une église dans le pays..... En conséquence de quoi nous sommes respectivement convenus et avons promis : Premièrement qu’au cas d’une pareille vacature, moi, Jean Henri Prêtre, me dèsiste et me dèsisterai totalement en faveur du dit spectable Cellier, de toutes prétentions et concurrences sur cette église me contentant et rèservant uniquement à cet ègard mes prètentions pour le diaconnat au cas qu’il devint vacant. -

Les Armoiries De L'erguel
Les armoiries de l'Erguel Autor(en): Chatelain, Roger Objekttyp: Article Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation Band (Jahr): 61 (1957) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-558724 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch LES ARMOIRIES DE L'ERGUEL par ROGER CHATELAIN, Tramelan Introduction Entre Saint-Imier et Sonvilier, sur le versant nord du Chasserai, se dresse une tour ruinée, dernier vestige d'un ancien château, celui d'Erguel, appelé autrefois Arguel (prononcez Er-ghu-el, Ar-ghu-el). Ce château et la famille noble qui l'habitait, les sires d'Arguel, ont donné leur nom à la région circonvoisine b L'Erguel devint un des Etats de l'Evêché de Bâle, c'est-à-dire une seigneurie ou châtellenie, appelée ensuite bailliage, dont l'adminis- tration fut placée à Courtelary. -

Les Ruines Du Château D'erguël À Sonvilier
Les ruines du château d'Erguël à Sonvilier Autor(en): Gutscher, Daniel Objekttyp: Article Zeitschrift: Mittelalter : Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins = Moyen Age : revue de l'Association Suisse Châteaux Forts = Medioevo : rivista dell'Associazione Svizzera dei Castelli = Temp medieval : revista da l'Associaziun Svizra da Chastels Band (Jahr): 1 (1996) Heft 4 PDF erstellt am: 08.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-164555 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch palizzata lignea?), mentre la costruzione Resumaziun Anmerkungen attuale è 1 stata eretta sicura- Die damaligen Arbeiten lagen in der örtlichen mente nel XIII sec, rinforzata dalla Grondas exchavaziuns dal 1990 Verantwortung von Ebbe Nielsen. -

« Pour Une Histoire De L'eglise »
CERCLE D'ÉTUDES HISTORIQUES DE LA SOCIETE JURASSIENNE D'ÉMULATION Numéro 38 - Juin 2007 __________________________________ « Pour une histoire de l’Eglise » 2 3 CERCLE D'ÉTUDES HISTORIQUES DE LA SOCIETE JURASSIENNE D'ÉMULATION Numéro 38 - Juin 2007 _____________________________________________ Pour une histoire de l’Eglise Sommaire Francis PYTHON, Editorial : Histoire de l’Eglise, des églises ou des réalités religieuses ?................................................................................................................. 4 Pierre-Olivier LECHOT, Quelques notes à propos de l’histoire du protestantisme dans l’ancien Évêché de Bâle ..................................................................................... 6 Noëlle-Laetitia PERRET, L’histoire de l’Eglise réformée en terre jurassienne : entre diversité et unité. Bref aperçu historiographique............................................... 8 Michel UMMEL, L’ « Année anabaptiste 2007 » .................................................... 18 Lionel JEANNERAT, La pensée religieuse du curé révolutionnaire du Noirmont, Louis François Zéphirin Copin (1723-1804) ............................................................ 24 Anne BEUCHAT-BESSIRE, Une source précieuse pour l’histoire de l’Eglise dans le Jura : Le fonds de l’Eglise réformée jurassienne déposé à Mémoires d’Ici . 27 Petra ZIMMER, Der Kanton Jura und der Berner Jura in der Helvetia Sacra ......... 34 Laurent AUBERSON, Le canton du Jura et le Jura bernois dans l’ Helvetia Sacra (traduction)............................................................................................................... -

La Tête De Moine Fête Les 20 Ans De Son AOP
JGA 2608 Courtelary 98e année Vendredi 30 avril 2021 No16 Tirage : 12 000 exemplaires distribués chaque vendredi dans tous les ménages de l’ancien district de Courtelary. Imprimerie Bechtel SA Délais de remise des publications Tarif des annonces Bellevue 4 Sport, utile et paroisses : lundi soir sur demande 2608 Courtelary Rédac. et annonces : mercredi 9 h ou sur www.bechtel-imprimerie.ch 032 944 18 18 Officiel : mardi 12 h FAC : 032 944 17 56 [email protected] Abonnement annuel : 98 fr. Réclame Vos partenaires régionaux pour des solutions informatiques et de télécommunication Contient la Feuille Officielle d’Avis du District de Courtelary Journal d’annonces et d’information Rue Francillon 25, 2610 St-Imier 032 941 11 30 www.tlms-it.ch / www.tlms.ch Officiel pour les communes de Romont, Sauge, Orvin, Péry-La Heutte, Sonceboz-Sombeval, Corgémont, Cortébert, Courtelary, Cormoret, Villeret, Saint-Imier, Sonvilier, Renan, La Ferrière, Tramelan et Mont-Tramelan La Tête de Moine fête les 20 ans de son AOP Le fromage de Bellelay, Olivier Isler de faire ses adieux à dont l’origine remonterait au la Tête de Moine, après 22 ans XIIe siècle, bénéficie d’une de bons et loyaux services en appellation d’origine protégée tant que gérant de l’interpro- depuis exactement 20 ans. Ces fession, puisqu’il va quitter ce deux décennies correspondent poste pour rejoindre l’Office à l’histoire à succès de l’inter- fédéral de l’agriculture. Il sera profession de la Tête de Moine. remplacé dès le 1er juin par Mardi, une conférence de Martin Siegenthaler, un froma- presse célébrait l’événement à ger de formation, mais aussi Bellelay, faute d’une véritable un agro-ingénieur avec une fête, impossible en ce moment expérience d’acheteur dans le en raison des mesures sani- domaine des produits laitiers taires en vigueur. -

Notice Historique Sur Le Chapitre De Saint-Imier Dans L'erguel
Notice historique sur le chapitre de Saint-Imier dans l'Erguel Autor(en): Mulinen, Egbert-Frédéric de Objekttyp: Article Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation Band (Jahr): 19 (1868) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-555217 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch - 107 — NOTICE HISTORIQUE SUR LE CHAPITRE DE SAINT-IMIER DANS L'ERGUEL Par Egbert-Frébéric de Mulinen membre de plusieurs sociétés historiques en Suisse et à l'étranger. Mémoire lu dans h séance de la Société jurassienne d'émulation qui eut lieu à Saint-Imier mercredi le 2 octobre 1867. -

Les Troubles En Erguel, La Déclaration Souveraine De S.A. Le Prince-Evêque Jacques- Sigismond De Reinach-Steinbrun Du 23 Juin 1742 Et Ses Conséquences
Les troubles en Erguel, la déclaration souveraine de S.A. le Prince-Evêque Jacques- Sigismond de Reinach-Steinbrun du 23 juin 1742 et ses conséquences Autor(en): Voumard, Ch.-D. Objekttyp: Article Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation Band (Jahr): 32 (1927) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-685095 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch — 223 — LES TROUBLES EN ERGUEL, LA DÉCLARATION SOUVERAINE de S. A. le Prince-Evêque Jacques-Sigismond de Rei- nach-Steinbrun du 23 juin 1742 eZ ses conséquences par le Pasteur CA.-D.FcmmanZ, Diacre du Jura à Courtelary. -

Les Armoiries Du District De Courtelary (Jura Bernois)
Les armoiries du district de Courtelary (Jura bernois) Autor(en): Rais, André Objekttyp: Article Zeitschrift: Archives héraldiques suisses : Annuaire = Schweizer Archiv für Heraldik : Jahrbuch = Archivio araldico svizzero : Annuario Band (Jahr): 69 (1955) PDF erstellt am: 30.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-745992 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Les armoiries du district de Courtelary (Jura bernois) par André Rais Introduction. Le Pays d'Erguel, ou l'Erguel, est le nom du Vallon de Saint-Imier à l'époque °u il formait une seigneurie de l'ancien Evêché de Bâle. Cette dénomination lui Vlnt des nobles d'Arguel, puis d'Erguel, qui gouvernèrent la contrée au moyen âge.