Naturpark Almenland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bgbl. Nr. 477/1995
6411 Jahrgang 1995 Ausgegeben am 21. Juli 1995 151. Stück 477. Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention) samt Anlage (NR: GP XVm RV 1022 AB 1344 S. 150. BR: AB 4719 S. 579.) 477. Der Nationalrat hat beschlossen: 1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlage wird genehmigt. 2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassune von Gesetzen zu erfüllen. ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER sind im Gefolge der Ergebnisse der ersten ALPEN (ALPENKONVENTION) Alpenkonferenz der Umweltminister vom 9. bis l I.Oktober 1989 in Berchtesgaden wie folgt Die Bundesrepublik Deutschland, übereingekommen : die Französische Republik, die Italienische Republik, das Fürstentum Liechtenstein, Artikel l die Republik Österreich, Anwendungsbereich die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Republik Slowenien sowie (1) Gegenstand dieses Übereinkommens ist das die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Gebiet der Alpen, wie es in der Anlage beschrieben im Bewußtsein, daß die Alpen einer der größten und dargestellt ist. zusammenhängenden Naturräume Europas und ein (2) Jede Vertragspartei kann bei der Hinterle- durch seine spezifische und vielfältige Natur, Kultur gung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Geneh- und Geschichte ausgezeichneter Lebens-, Wirt- migungsurkunde oder jederzeit danach durch eine schafts-, Kultur- und Erholungsraum im Herzen an die Republik Österreich als Verwahrer gerichtete Europas sind, an dem zahlreiche Völker und Länder Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens' teilhaben, auf weitere Teile -

MOTORIKPARK KOGLHOF Hütte
An einen Haushalt! Nordoststeirer Österreichische POST AG RM 01A021005 K Verlagspostamt 8190 Birkfeld, Gasenerstraße 1 Ausgabe B3 Juni 2020 Die Zeitung für: Alpl, Anger, Baierdorf, Birkfeld, Ebersdorf, Feistritz, Feistritzwald, Fischbach, Floing, Gasen, Gschaid, Haslau, Heilbrunn, Kain- dorf, Koglhof, Lebing, Miesenbach, Mönichwald, Naintsch, Piregg, Pöllau- berg, Pöllau, Puchegg, Rabenwald, Ratten, Rettenegg, Riegersberg, Saifen- Boden, Schachen bei Vorau, Schönegg b. Pöllau, Sebersdorf, Sonnhofen, Stanz i. Mürztal, St. Jakob/Breitenau, St. Jakob/W., St. Johann/Herberstein, St. Kathrein/H., Strallegg, Vorau, Vornholz, Waisenegg, Waldbach, Wenigzell www.heimatblick.at Die Wildwiesenhütte hat für Sie geöffnet!!! Jeden Montag 3. Juli bis 11. September: ab 11.00 bis 14.00 Uhr: Jeden Freitag ab 17.00 Uhr Hüttenschnitzel mit Erdäpfelsalat € 6,90 Spezialitäten vom Holzkohlegrill Jeden Mittwoch ab 14.00 Uhr: Sonntag & Feiertag Häferlkaffee & 1 Stk. hausgemachter Mittagsbuffet von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr € 14,50 Mehlspeise vom Buffet € 5,00 Kinderermäßigung p.P. Öffnungszeiten: Hüttenbetrieb ab 10.00 Eiszeit auf Uhr | DI & DO Ruhetag Zufahrt bis zur der Alm s Hütte möglich | Tel.: 03174/8222 der r.an www.wildwiesen.at miliä lich.fa e ursprüng tt Hü ch Wildwiesenhof sen nba ldWie iese täglich geöffnet! Wi M SOMMER Sommerrodelbahn Koglhof Weizerstraße 47 A-8191 Koglhof www.sommerrodelbahn-koglhof.at KOGLHOF 0664 / 28 34 180 Erlebnis für die MOTORIKPARK KOGLHOF ganze Familie 22 Nordoststeirischer Heimatblick Wandern, Genuss und Erholung Sommerrodelbahn und am Stanzer Sonnenweg Motorikpark Koglhof geöffnet! Die Sommerrodelbahn Kogl- Sommerrodelbahn ist zu einem hof bietet ein rasantes Erlebnis, Besuchermagnet geworden. In Spaß und Abwechslung für Jung 13 verschiedenen Stationen in si- und Alt. -
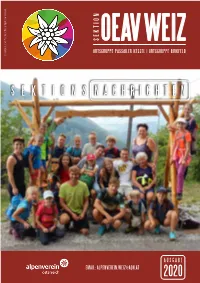
Email: [email protected] 2020 Vorwort
Österreichische Post AG / Postentgelt bar bezahlt / Postentgelt AG Post Österreichische EMAIL: [email protected] 2020 VORWORT Liebe Vereinsmitglieder! 2019 in der Phase des Ausklangs, lässt uns wieder auf hen und einzulassen, sich austauschen und mit Freude ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken – auf gemeinsame Unternehmungen erleben. Auch das ist ausschließlich positive Ereignisse. Kein Misstrauens- Alpenverein! antrag, keine Fake News störten unsere Begeisterung für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Ein aufrichtiger Dank gilt unseren Sponsoren, deren Treue und Unterstützung uns Auftrag ist, trotz zahlrei- Zeitig im Frühjahr, vor Beginn der Wandersaison, er- cher Gipfeltreffen, auch nicht auf unsere Hauptaufga- richteten wir mit unserem Passailer Brückenkünstler- ben zu vergessen: Die Erhaltung unserer Wanderwege, Team den südlichen Zustieg zum Lehbauersteg neu. der Schutz der Natur, die Ausbildung für Bergsportin- Somit haben wir in den letzten acht Jahren alle Brü- teressierte und die Interressenserweckung der Jugend cken und Stege in der Großen Raabklamm erneuert. zu Natur- und Bergerlebnissen. Ein großer Dank gilt unseren beiden Ortsgruppen Birk- feld und Passail, die zum 35-jährigen Jubiläum unse- Allen Helfern und Mitverantwortlichen gilt mein inni- res Familien- und Jugendstützpunktes Wittgruberhof ger Dank für eure Bereitschaft und für euren Einsatz, Großartiges beigetragen haben. die ein erfolgreiches Gelingen ermöglichen. So wurde von unseren Birkfeldern der Gastraum einla- Siegfried Pirkheim dend und behaglich umgestaltet, und unsere Passailer Obmann verschafften dem Innenhof einen einfühlsam ange- passten Abstellplatz. Pünktlich zum Jubiläumsfest erstrahlte der Wittgru- berhof mit seinen gelungenen Adaptierungen. Noch- mals herzlich gratulieren möchte ich der Ortsgruppe Passail zu ihrem 40-jährigen Bestehen und ihrer stim- mungsvollen Ausrichtung der feierlichen Bergmesse zeitgemäße Küchen am Buchkogel. -

Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Amtliche Mitteilung
Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Amtliche Mitteilung. An einen Haushalt. Zugestellt durch Post.at GERSDORFER Gemeindeblatt’l NACHRICHTEN AUS DER GEMEINDE GERSDORF AN DER FREISTRITZ Vorzeigekindergarten eröffnet LH Hermann Schützenhöfer ist Automationstechnik Grübl 20 Jahre Schützenverein Ehrenbürger der Gemeinde kommt nach Gersdorf SV Feistritztal Gersdorfer Gemeindeblattl Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Inhalt Wichtige Gemeinderatsbeschlüsse 4 Liebe Gemeindebürgerinnen Haushaltsvoranschlag 2019 12 Kindergarteneröffnung 14 Aus der Volksschule 17 und Gemeindebürger, Schuljahr 2017/2018 18 Baugeschehen 22 Falsche Abfalltrennung ist teuer! 26 liebe Jugendliche und Kinder! Fa. Grübl kommt nach Gersdorf 28 Firma TeLo 29 50 Jahre Firma Egger-Glas 30 neue Haus konnte rechtzeitig zum Be- 100 Jahre Elektro Schafler Gersdorf 32 Der neue Kindergarten, eine ginn des Kindergartenjahres in Betrieb FF-freundlicher Betrieb Loidl 33 Investition in die Zukunft genommen werden. Kirchliches 34 Gratulation an unsere leistungsstarken Pilgerwanderungen 38 Ich freue mich vor allem riesig darüber, heimischen Betriebe, die die Bauarbeiten Branddienstleistungsprüfung 39 dass heuer mit dem Zu- und Umbau des reibungslos und unfallfrei ausgeführt ha- Blackout-Vorsorge 40 Gersdorfer Gemeindekindergartens mit ben. Ein Dankeschön auch an die Nach- Botschafter aus der Slowakei 41 Kinderkrippe ein wichtiger Meilenstein barn für das Verständnis während der Bau- Nina Heyer beim Forum Alpbach 42 auf dem Gebiet der Bildungs- und Be- zeit. Besonders erfreulich ist zu erwähnen, Kernölprämierung 2018 42 treuungseinrichtungen in der Gemein- dass für den neuen Vorzeigekindergarten Kulmkelten 43 de rasch und kostengünstig umgesetzt durch die großzügige Unterstützung von Oberrettenbach 33 44 werden konnte. Ein sehr gelungenes Landeshauptmann Hermann Schützenhö- Dorffest 45 Bauwerk, ein Generationenprojekt, das fer hohe, nicht rückzahlbare Fördermittel Parkfest 2018 46 die Gemeinde familienfreundlicher, le- in Anspruch genommen und so das Ge- Schülertreffen in Gschmaier 47 benswerter und attraktiver macht. -

PTS Birkfeld Tel: 03174/3040-11 Fax: 03174/3040-14 Birkengasse 1 8190 Birkfeld [email protected]
PTS Birkfeld Tel: 03174/3040-11 Fax: 03174/3040-14 Birkengasse 1 www.pts-birkfeld.at 8190 Birkfeld [email protected] Branche Firma PLZ Ort Anschrift Telefonnummer Lehrberuf Holz ADA GmbH 8184Anger Baierdorf 61 03175/71000 Tischler/in, Polsterer Holz Berger Peter 8673Ratten Filzmoos 35 03173/22180 Tischler/in Holz Dengg Adolf 8183Floing Unterfeistritz 3 03177/2237 Tischler/in Holz Fadenberger Konrad 8162Passail Nr. 179 03179/23336 Tischler/in Holz Göbel Josef 8163Fladnitz/T. Nr. 119 03179/6161 Tischler/in Holz Hofbauer Peter 8190Birkfeld Waisenegg 127 03174/4530 Tischler/in, Zimmerer/in Holz Höfler Manfred 8184Anger Roseggerstraße 17 03175/2269 Tischler/in Holz Holzbau Weiz 8160Weiz Birkfelderstr. 40 03172/2417 Tischler/in, Zimmerer/in Holz Hutter GmbH 8190Birkfeld Weizerstr. 9 03174/4472 Tischler/in Holz Kletzenbauer Hans 8160Weiz Schützenweg 14 03172/2604 Tischler/in Holz Edelseer Tischlerei 8190Birkfeld Gschaid 157 03174/4486 Tischler/in Holz Königshofer Rudolf 8673Ratten KV. 121 03173/2229 Tischler/in Holz Mauthner GmbH 8160Weiz Offenburgergasse 12 03172/3920 Tischler/in Holz Peßl Blasius 8616Gasen Sonnleitberg 85 03171/217 Tischler/in Holz Pirchheim OHG 8183Floing Lebing 47 03177/2223 Tischler/in Holz Schlemmer Alfred 8182Puch Klettendorf 54 03177/2304 Tischler/in Holz Trattner Walter 8163Fladnitz/T. Fladnitzberg 20 03179/23683 Tischler/in Holz Weber Horst 8672St.Kathrein/H. Nr. 99 03173/2273 Tischler/in Holz Wegerer 8674Rettenegg GV.31 03173/8025 Tischler/in Holztechniker/in, Metalltechniker/in, Elektrotechniker/in, Holz Weitzer Parkett 8160Weiz Klammstraße 24 03172/2372-0 Großhandelskaufmann/frau, Finanz- und Rechnungswesenassistenz Holz Willenshofer Herbert 8672St.Kathrein/H. Nr. 86 03173/2279 Tischler/in Holz Ziegerhofer Peter 8673Ratten Grubbauerv. -

Umsetzungskonzept Klimafreundlicher Naturpark Almenland
Umsetzungskonzept Klimafreundlicher Naturpark Almenland Klima- und Energie-Modellregion Klimafreundlicher Naturpark Almenland A-8616 Gasen 3 Modellregionsmanager Mag. Martin Auer Tel. +43(0)664/8514441 [email protected] www.almenland.at/kem Naturpark Almenland, Dezember 2016 Umsetzungskonzept – Klimafreundlicher Naturpark Almenland Seite 1 von 100 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung ......................................................................................................................................... 4 2 Standortfaktoren ............................................................................................................................. 4 2.1 Charakterisierung der Region .................................................................................................. 4 2.2 Gemeinden und Einwohner/innen .......................................................................................... 6 2.3 Bevölkerungsstruktur .............................................................................................................. 9 2.4 Verkehrssituation .................................................................................................................. 11 2.5 Wirtschaftliche Ausrichtung der Region ................................................................................ 12 2.6 Deckungsgrad der Region und bestehende Strukturen ........................................................ 14 2.6.1 Naturpark Almenland ................................................................................................... -

Lgbl. Nr. 22/2015 - Ausgegeben Am 17
1 von 3 Jahrgang 2015 Ausgegeben am 17. März 2015 22. Verordnung: Stmk. Maiswurzelbohrerverordnung 2015 elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 22. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 12. März 2015 betreffend die Bekämpfung des Maiswurzelbohrers (Stmk. Maiswurzelbohrerverordnung 2015) Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Steiermärkischen Pflanzenschutzgesetzes, LGBl. Nr. 82/2002 zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 8/2013, wird verordnet: § 1 Regelungsgegenstand Die Bestimmungen dieser Verordnung regeln die Bekämpfung des Schadorganismus Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera Le Conte) in der Steiermark. s Ausdrucks finden Sie unter: § 2 Wirtspflanzen Wirtspflanzen im Sinne dieser Verordnung sind insbesondere Pflanzen der Art Mais (Zea mays L.). § 3 Überwachung Zur Feststellung des Auftretens und zur Beobachtung des Maiswurzelbohrers sind von der https://as.stmk.gv.at Landesregierung in Gebieten, in denen Mais angebaut wird, geeignete Maßnahmen (z. B. das Aufstellen von Pheromon-Fallen) durchzuführen. Dabei sind die topografischen Gegebenheiten und die anderen angebauten Kulturen zu berücksichtigen. § 4 Kontrollen Die Landesregierung hat durch regelmäßige stichprobenartige Kontrollen die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen gemäß § 6 zu überprüfen. § 5 Maßnahmengebiet (1) Das Maßnahmengebiet I umfasst folgende Bezirke, politischen Gemeinden und Katastralgemeinden: Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ausgenommen: die Gemeinden Breitenau am Hochlantsch, Krieglach, Langenwang, Mariazell, Marktgemeinde Aflenz, Marktgemeinde Thörl, Neuberg an der Mürz, Pernegg an der Mur, Spital am Semmering, Stadtgemeinde Mürzzuschlag und Turnau sowie die Katastralgemeinden Oberort, Schattenberg und Sonnberg der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein; Bezirk Deutschlandsberg: Stadt Graz: Bezirk Graz Umgebung ausgenommen: die Gemeinde Sankt Radegund bei Graz; www.ris.bka.gv.at Stmk. LGBl. Nr. 22/2015 - Ausgegeben am 17. -

Administrative Units of the Alpine Convention Alpine the of Units Administrative Alpine Signals 1 Signals Alpine 21
Administrative Units of the Alpine Convention Administrative Units Alpine signals 1 21 Scope of application of the Alpine Convention Administrative Units LIST OF ADMINistrative UNITS OF THE ALPINE CONVENTION IN 1) According to the Federal Official Journal (of the Republic of Austria) THE REPUBLIC OF AUSTRIA III vol. 18/1999 from 01.28.1999. Federal state of Strobl Weißpriach VORARLBERG Thalgau Zederhaus all municipalities Wals-Siezenheim District of Zell am See F e d e r a l s t a t e o f T Y R O L District of Sankt Johann im Pongau Bramberg am Wildkogel all municipalities Altenmarkt im Pongau Bruck an der Großglockner- straße Bad Hofgastein Federal state of Dienten am Hochkönig CARINTHIA Badgastein Bischofshofen Fusch an der Großglockner- all municipalities straße Dorfgastein Hollersbach im Pinzgau Eben im Pongau Federal state of Kaprun SALZBURG Filzmoos Flachau Krimml Lend Salzburg (town area) Forstau Goldegg Leogang District of Hallein Großarl Lofer Hüttau Maishofen Abtenau Maria Alm am Steinernen Adnet Hüttschlag Kleinarl Meer Annaberg im Lammertal Mittersill Golling an der Salzach Mühlbach am Hochkönig Pfarrwerfen Neukirchen am Großvene- Hallein diger Krispl Radstadt Sankt Johann im Pongau Niedernsill Kuchl Piesendorf Oberalm Sankt Martin am Tennen- gebirge Rauris Puch bei Hallein Saalbach-Hinterglemm Rußbach am Paß Gschütt Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Saalfelden am Steinernen Sankt Koloman Meer Scheffau am Tennengebirge Untertauern Sankt Martin bei Lofer Vigaun Wagrain Stuhlfelden District Werfen Taxenbach Salzburg/Surrounding -

JSV Jahresbericht 2014.Indd
Jahresbericht 2014 Einladung zu der am Sonntag, den 8. März 2015 mit Beginn um 09.00 Uhr im Gasthof Mosbacher in Strallegg VWDWW¿QGHQGHQ Jahresversammlung mit Trophäenschau für den Gerichtsbezirk Birkfeld Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 2. Totengedenken 3. Berichte der Ämterführer 4. Referat von Vzpräs. Ing. Hans Hafellner 5. Bericht der Bewertungskommission 6. Bericht des Bezirksjägermeisters 7. Ehrung verdienter Mitglieder 8. Anträge und Allfälliges An alle Mitglieder ergeht die Bitte, an der Jahresversammlung verläss- lich teilzunehmen. Angehörige und Freunde sind herzlich willkommen. Der Schriftführer: Der Obmann: Ernst Neuhold e.h. Franz Häusler e.h. Seite 2 Der Obmann sentation auf die Tätigkeiten und Aufgaben des Jagdschutzvereins in der heutigen Zeit ein. Geschätzte Unter dem TOP „Ehrung verdienter Mitglieder“ Zweigstellenmitglieder! durften wir wieder zahlreiche Jubiläumsabzei- chen für langjährige Vereinszugehörigkeit über- Das Jahr 2014 ist zu Ende und es reichen. Für 25 Jahre erhielten das Jubiläums- wird wohl als eines der arbeitsin- abzeichen in Silber Johann Gaugl aus Piregg, tensivsten in die Vereinsgeschich- Martin Klauber, Willibald Maier jun. und Micha- te eingehen. In einer beispielhaf- el Nistelberger aus Baierdorf, Franz Müller aus ten und bemerkenswerten Art haben sich viele Feistritzwald und Johann Reindl aus Gasen. Mitglieder und auch andere Personen mit gro- ßem persönlichen Einsatz an der Neugestaltung unseres Wurfscheibenstandes Hödl in Fischbach verdient gemacht. Aus diesem Grunde haben wir nicht nur das Titelbild so gewählt, sondern auch einen ausführlichen Bericht darüber gestaltet. Das neue Jahr hat mit dem Jägerball am 5. Jän- ner einen schwungvollen Auftakt genommen und ich wünsche, dass es schwungvoll weiter- geht, aber trotzdem nicht hektisch wird. -

43 Rizon Separates the Semriach Formation from the St. Ra- Degund
rizon separates the Semriach Formation from the St. Ra- Weizbauer Member: Black argillaceous shales with inter- degund Crystalline. In the area of St. Kathrein the Hoch- calated beds of limestones and quartzites; probably be- schlag Formation underlies the Semriach Formation. tween 100 and 200 m in thickness. Overlying unit(s): Schönberg Formation and Schöckel Pfaffenkogel Member: White biolaminated dolomites with Formation (tectonic contact). birdseye-structures, thick bedded dolomites; up to 200 m in thickness. Lateral unit(s): Not known because of tectonic boundaries. Underlying unit(s): Presumably Semriach Formation and Geographic distribution: Styria, highland in the surround- Taschen Formation. ings of Graz; ÖK50-BMN, map sheets 134 Passail, 135 Birkfeld, 164 Graz, 165 Weiz. Overlying unit(s): Schöckel Formation (tectonic contact). Remarks: - Lateral unit(s): - Complementary references: - Geographic distribution: Styria, highland in the surround- ings of Graz; ÖK50-BMN, map sheets 133 Leoben, 134 Passail, 135 Birkfeld, 163 Voitsberg, 164 Graz, 165 Weiz. Schönberg-Formation / Schönberg Formation Remarks: - BERNHARD HUBMANN Complementary references: RANTITSCH et al. (1998), EB- Validity: Valid; re-nomination of “Arzberg Schichten” (see NER et al. (2000). FLÜGEL, 2000: p. 39), formalized by FLÜGEL (2000: p. 39). Type area: ÖK50-UTM, map sheet 4223 Weiz (ÖK50- Hochschlag-Formation / Hochschlag Formation BMN, map sheet 134 Passail). BERNHARD HUBMANN Type section: No type section defined, but FLÜGEL (2000) selected a type region at Schönberg, northeast of Arz- Validity: Valid; first description by E. FLÜGEL (1957: “Hoch- berg; ÖK50-BMN, map sheet 164 Graz (N 47°15’53” / schlagserie” and “Hochschlagkalke”); formalized by FLÜ- E 15°31’58”). GEL (2000: p. -

Jahresbericht 2016 Einladung Zu Der Am Sonntag, Den 12
Jahresbericht 2016 Einladung zu der am Sonntag, den 12. März 2017 mit Beginn um 09.00 Uhr im Gasthof Mosbacher in Strallegg VWDWW¿QGHQGHQ Jahresversammlung mit Trophäenschau für den Gerichtsbezirk Birkfeld Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 2. Totengedenken 3. Berichte der Ämterführer 4. Referat von Vzpräs. Franz KESSELSTATT 5. Bericht der Bewertungskommission 6. Bericht des Bezirksjägermeisters 7. Ehrung verdienter Mitglieder 8. Neuwahl der Zweigstellenleitung 9. Wahl der Kassaprüfer 10. Wahl der Delegierten zur Hauptversammlung 11. Anträge und Allfälliges =X ,QJ-RKDQQ6FKDIÀHU%DLHUGRUI'RUI(PDLOMRKDQQVFKDIÀHU#PHFRPZXUGH]XP:DKO leiter bestellt. Wahlvorschläge sind spätestens 24 Stunden vor Beginn der oa Jahresversammlung bei ihm einzubringen und müssen von mindestens 20 Mitgliedern der Zweigstelle unterschrieben sein. An alle Mitglieder ergeht die Bitte, an der Jahresversammlung verlässlich teilzunehmen. Angehörige und Freunde sind herzlich willkommen. Der Obmann: Der Schriftführer: Franz HÄUSLER e.h. Ernst NEUHOLD e.h. Seite 2 Der Obmann So ähnlich erscheint mir auch der Versuch einer QHXHQ *UXSSLHUXQJ 8QHLQLJNHLW LQ GLH -lJHU Geschätzte schaft zu bringen. Es ist nicht zielführend, die Zweigstellenmitglieder! -DJGPLWGHIWLJHQ6FKODJZ|UWHUQQHX]XHU¿QGHQ Erfolgversprechend ist es, die Kräfte zu bündeln Jagd vorbei? XQGGLH1RWZHQGLJNHLWGHU-DJGLQHLQHQWVSUH Ä'HUDOWH-lJHUYRP6LOEHUWDQQHQ FKHQGHV/LFKW]XUFNHQ:HQQGHU%H]LUNVVWHO WDO³ZLUG]ZDUQRFKKLHXQGGDEH lenleiter dieser Gruppierung als Beweggrund für sungen, aber er hat ausgedient. seine Aktivitäten angibt, dem Jagdschutzverein Er gehört zur Asche und nicht zur Glut, die wir VFKDGHQ]XZROOHQREZRKOHUQDFKZLHYRUGHV weitertragen müssen. Durch das Aufkommen sen Mitglied ist, dann ist zu befürchten, dass aus YRQ 7LHUUHFKWVEHZHJXQJHQ JHUlW GLH -DJG LP dem „Weidwerk mit Zukunft“ bald ein „Streitwerk mer mehr unter Druck. Wir Jäger stehen diesen mit Zukunft“ wird. -
Weiz KUNDMACHUNG
Bezirkswahlbehörde Weiz KUNDMACHUNG Die Bezirkswahlbehörde Weiz für die Landwirtschaftskammerwahlen 2021 veröffent- licht gemäß § 33 der Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005, LGBl. Nr. 90, idgF., nachstehend die Namen der von den Wählergruppen vorgeschlagenen KandidatInnen für die Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Weiz Liste 1 Steirischer Bauernbund STBB 1 Wumbauer Josef, 1969, Landwirt, 8171 St. Kathrein am Offenegg 2 Hütter Rupert, 1984, Landwirt, 8181 St. Ruprecht an der Raab 3 Höller Peter, 1969, Landwirt, 8190 Birkfeld 4 Loidl Richard, 1983, Landwirt, 8321 St. Margarethen an der Raab 5 Lammer Andrea, 1968, Landwirtin, 8160 St. Ruprecht an der Raab 6 Glatzer Günter, 1973, Landwirt, 8261 Sinabelkirchen 7 Straußberger Maria, 1979, Landwirtin, 8172 Birkfeld 8 Harrer Stefan, 1967, Landwirt, 8163 Fladnitz an der Teichalm 9 Haubenwallner Sofie, 1986, Landwirtin, 8616 Gasen 10 Nistelberger Kurt, 1968, Landwirt, 8211 Ilztal 11 Eder Hannes, 1994, Jungbauer, 8160 Mortantsch 12 Narnhofer Norbert, 1965, Landwirt, 8190 Miesenbach bei Birkfeld 13 Reiter Orsolya, 1973, Landwirtin, 8200 Gleisdorf 14 Loidolt Martin, Ing., 1977, Landwirt, 8162 Passail 15 Gruber Ingrid, 1978, Landwirtin, 8183 Floing 16 Heinz Gottfried, 1971, Landwirt, 8160 Thannhausen 17 Wagner Johann, 1962, Landwirt, 8311 Markt Hartmannsdorf 18 Schwab Helmut, 1972, Landwirt, 8181 Mitterdorf an der Raab 19 Sitka Engelbert, 1977, Landwirt, 8190 Miesenbach bei Birkfeld 20 Hütter Hannes, 1975, Landwirt, 8200 Hofstätten an der Raab 21 Kern Karl-Heinz, 1981, Landwirt, 8192 Strallegg 22 Tunst Maria, 1958, Pensionistin, 8311 Markt Hartmannsdorf 23 Reisinger Johann, 1973, Landwirt, 8160 Naas 24 Wild Hubert, 1983, Landwirt, 8162 Passail 25 Zaunschirm Hans Peter, 1959, Landwirt, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf 26 Weber Birgit, 1991, Jungbäuerin, 8160 Thannhausen 27 Schweighofer Johannes, 1974, Landwirt, 8673 Ratten 28 Lang Paul, 1966, Landwirt, 8171 St.