Prof. Michael Maul an Den Thomanerchor
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Biography Thomaskantor Gotthold Schwarz As of March 2018
Thomaskantor Gotthold Schwarz Gotthold Schwarz is the 17 th Thomaskantor after Johann Sebastian Bach. On 9 June 2016 he has been appointed as Thomaskantor and has been officially inaugurated on 20 August 2016. Born in Zwickau as a son of a cantor he gained his musical education at the “Hochschule für Kirchenmusik Dresden” (University for Church Music Dresden) and also at the “Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig” (University of Music and Theatre „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig) after having been a member of Thomanerchor Leipzig for s short time in his childhood. He studied singing with Gerda Schriever, playing the organ with former St. Thomas Organist Hannes Kästner and Wolfgang Schetelich, as well as conducting with Max Pommer and Hans-Joachim Rotzsch. Furthermore he has worked with, amongst others, Hermann Christian Polster, Peter Schreier and Helmuth Rilling in masterclasses and academies. Gotthold Schwarz, who began to work as vocal trainer for the Thomanerchor Leipzig in 1979, stood in for the Thomaskantor for several times since the 1990's. On this position he led the motets, performances of cantatas and oratorios with the Thomanerchor Leipzig; moreover he was entrusted with other duties as an interim officiating cantor. Together with the world-famous boys’ choir he has been on numerous tours in Germany, Europe and overseas (Japan, China, USA, Canada), several together with the Gewandhausorchester Leipzig. Furthermore Gotthold Schwarz is initiator and leader of “Concerto vocale”, “Saxon Baroque Orchestra”, “Leipziger Cantorey” and “Bach Consort Leipzig”. In recognition of his special merits the versatiled singer and conductor was awarded with the Cross of Merit of the Federal Republic of Germany (1 st class) on 4 October 2017. -

DIE MUSIKWELT SCHAUT AUF UNS Er Steht an Einer Der Bedeutendsten Positionen Nicht Allein Des Leipziger Musiklebens: Gotthold Schwarz Ist Seit Drei Jahren Thomaskantor
DIE MUSIKWELT SCHAUT AUF UNS Er steht an einer der bedeutendsten Positionen nicht allein des Leipziger Musiklebens: Gotthold Schwarz ist seit drei Jahren Thomaskantor. Wir sprachen mit ihm in seinem Amtssitz, dem Alumnat des Thomanerchors. 32 Interview © Gewandhaus−Magazin© Gewandhaus−Magazin Herr Professor Schwarz, was machen Sie Schwarz: Manchmal denke ich schon in Sonnabend der Fall ist, singen wir in der in den Sommerferien? den Ferien: Wie soll das gehen, wenn Stimmung von 443 Hertz. Es wäre aller- Gotthold Schwarz: Meine Ferien sind we- jetzt die Abiturienten und damit die er- dings für die Reputation Leipzigs als gen des alljährlichen Konzerts zu Johann fahrensten Sänger weg sind? Aber oft Bach-Stadt gut, hätten wir innerhalb des Sebastian Bachs Todestag am 28. Juli ein entwickeln diejenigen, die vorher in der Gewandhausorchesters auch Instrumen- wenig geteilt. Aber das stört mich nicht. zweiten Reihe gestanden haben, plötz- te, mit denen man in der Stimmung von Nach Möglichkeit fahre ich mit der Fami- lich große Energien und übernehmen 415 Hertz musizieren könnte. lie zum Wandern. In diesem Jahr geht es die Rolle der Ausgeschiedenen. Wir nut- nach Südtirol. Danach gibt es auch schon zen ja das letzte Ferienwochenende be- Ist das Wechseln von einer Stimmung in viel für das neue Schuljahr vorzuberei- reits für ein zweieinhalbtägiges Chorla- die andere nicht schwierig, wenn ein Ge- ten. ger auf Schloss Colditz, wo auch schon wandhausmusiker beispielsweise nach- die Neuaufgenommenen dabei sind. Dort mittags in der Thomaskirche und abends Sind Sie im Sommer verstärkt als Sänger wird jeder Thomaner kurz überprüft, in der Oper zu spielen hat? aktiv? damit ich weiß, wo er stimmlich steht. -
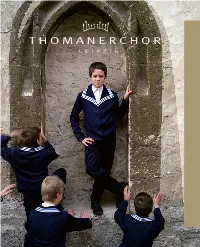
T H O M a N E R C H
Thomanerchor LeIPZIG DerThomaner chor Der Thomaner chor ts n te on C F o able T Ta b l e o f c o n T e n T s Greeting from “Thomaskantor” Biller (Cantor of the St Thomas Boys Choir) ......................... 04 The “Thomanerchor Leipzig” St Thomas Boys Choir Now Performing: The Thomanerchor Leipzig ............................................................................. 06 Musical Presence in Historical Places ........................................................................................ 07 The Thomaner: Choir and School, a Tradition of Unity for 800 Years .......................................... 08 The Alumnat – a World of Its Own .............................................................................................. 09 “Keyboard Polisher”, or Responsibility in Detail ........................................................................ 10 “Once a Thomaner, always a Thomaner” ................................................................................... 11 Soli Deo Gloria .......................................................................................................................... 12 Everyday Life in the Choir: Singing Is “Only” a Part ................................................................... 13 A Brief History of the St Thomas Boys Choir ............................................................................... 14 Leisure Time Always on the Move .................................................................................................................. 16 ... By the Way -

Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio
JOHANN Thomanerchor Leipzig SEBASTIAN Gewandhausorchester BACH Gotthold Schwarz CHRISTMAS ORATORIO WEIHNACHTS ORATORIUM JOHANNJOHANN SEBASTIANSEBASTIAN BACHBACH (1685(1685 – – 1750) 1750) CHRISTMASCHRISTMAS ORATORIOORATORIO WEIHNACHTSWEIHNACHTS ORATORIUMORATORIUM BWVBWV 248 248 THOMANERCHORTHOMANERCHOR LEIPZIG LEIPZIG GEWANDHAUSORCHESTERGEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG LEIPZIG GOTTHOLDGOTTHOLD SCHWARZ SCHWARZ (Thomaskantor) (Thomaskantor) 4 DOROTHEEDOROTHEE MIELDS MIELDS soprano soprano ELVIRAELVIRA BILL BILL alto alto PATRICKPATRICK GRAHL GRAHL tenor tenor (Evangelist) (Evangelist) MARKUSMARKUS SCHÄFER SCHÄFER tenor tenor (arias) (arias) KLAUSKLAUS HÄGER HÄGER bass bass CLEMENSCLEMENS SOMMERFELD SOMMERFELD echo echo JANNESJANNES ARNDT ARNDT angel angel ANDREASANDREAS BUSCHATZ BUSCHATZ solo solo violin violin KATALINKATALIN STEFULA STEFULA flute flute HANNAHANNA RZEPKA RZEPKA flute flute PHILIPPEPHILIPPE TONDRE TONDRE oboe oboe d∆amore d∆amore THOMASTHOMAS HIPPER HIPPER oboe oboe d∆amore d∆amore GUNDELGUNDEL JANNEMANN_FISCHER JANNEMANN_FISCHER cor cor anglais anglais MARIE_CHRISTINEMARIE_CHRISTINE GITMANN GITMANN cor cor anglais anglais RALFRALF GÖTZ GÖTZ horn horn JULIANJULIAN SCHACK SCHACK horn horn JONATHANJONATHAN MÜLLER MÜLLER trumpet trumpet MICHAELMICHAEL SCHLABES SCHLABES trumpet trumpet GUNTERGUNTER NAVRATIL NAVRATIL trumpet trumpet MAREKMAREK STEFULA STEFULA timpani timpani DANIELDANIEL PFISTER PFISTER cello cello MICHAILMICHAIL PAVLOS PAVLOS SEMSIS SEMSIS double double bass bass RICCARDORICCARDO TERZO TERZO bassoon bassoon ULLRICHULLRICH -

Thomanerchor), of the St
Click here for Full Issue of Fidelio Volume 7, Number 1, Spring 1998 MUSIC n Feb. 7, the St. will depend on the success of OThomas Boys’ Choir the few.” (Thomanerchor), of the St. Thomanerchor Brings In contrast to the Rees- Thomas Church of Leipzig, Mogg/Post notion of a “cog- Germany, the world’s oldest The Spirit of J.S. Bach nitive elite” destined to rule and foremost boys’ choir, over the disadvantaged, the performed in Washington, view of the concert organiz- D.C. before an overflow To the Poor ers was that expressed by the audience at the Basilica of Czech composer Antonin the National Shrine of the Dvorˇák, who lived in the Immaculate Conception (the United States from 1892 to Basilica is the largest Roman 1895: “It is to the poor that I Catholic Church in the turn for musical greatness. Western Hemisphere). The poor work hard: They Estimates of the crowd study seriously. Rich people attending the free concert are apt to apply themselves varied from 7,000 to 9,000, lightly to music, and to aban- and at least half, if not more, don the painful toil to which of those in attendance were every strong musician must young people under the age submit without complaint of sixteen. For most of these, and without rest.” This was it was their first concert of also the perspective of the Classical music. Sources Brotherhood of the Common close to the Thomanerchor Life, the teaching order reported that this was not founded at the end of the only their best performance, Fourteenth century, which but also the largest audience was dedicated to the educa- before which they have ever tion of the poor, an effort performed. -

Kantaten · Cantatas BWV 22, 23, 182
Thomanerchor Leipzig Das Kirchenjahr mit Johann Sebastian Bach Passion No 4/10 Passiontide Kantaten · Cantatas BWV 22, 23, 182 Thomanerchor Leipzig Gewandhausorchester Thomaskantor Georg Christoph Biller Das Kirchenjahr mit Johann Sebastian Bach Passion No 4/10 Passiontide Kantaten · Cantatas BWV 22, 23, 182 Thomaner Paul Bernewitz, Sopran Thomaner Stefan Kahle, Altus Thomaner Jakob Wetzig, Alt Patrick Grahl, Tenor Tobias Hunger, Tenor Porträt von Gotthold Schwarz, Bass Johann Sebastian Bach; Matthias Weichert, Bass Gemälde (1746) von Elias Gottlob Haußmann Thomanerchor Leipzig (1695–1774) Gewandhausorchester Thomaskantor Georg Christoph Biller Portrait of Johann Sebastian Bach; made in 1746 by Elias Gottlob Haußmann (1695–1774) ROP4044 · , 2014 1 Huc me sidereo Hymnus 7 Eheu, quam scelerum Hymnus Hymnus »De Passione Christi« aus dem »Florilegium selectissimorum Hymnorum« . 1:01 Hymnus »De Passione Christi« aus dem »Florilegium selectissimorum Hymnorum« . .1:16 Ensemble Florilegium Ensemble Florilegium Johann Sebastian Bach (1685−1750) Cantata BWV 22 Johann Sebastian Bach Cantata BWV 23 Jesus nahm zu sich die Zwölfe Du wahrer Gott und Davids Sohn Anlass: Estomihi / composed for Estomihi Sunday (Quinquagesima Sunday) Anlass: Estomihi / composed for Estomihi Sunday (Quinquagesima Sunday) Erstaufführung: 7. Februar 1723 / first performance: 7 February 1723 Erstaufführung: 7. Februar 1723 / first performance: 7 February 1723 (Fassung in h-Moll) 2 1 . Arioso e Coro Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach . .4:50 8 1. Aria (Duetto) Du wahrer Gott und Davids Sohn . .6:23 Tenore, Basso Oboe, Violino I/II, Viola, Basso continuo Soprano, Alto Oboe d’amore I/II, Basso continuo 3 2. Aria Mein Jesu, ziehe mich nach dir . .5:27 9 2. -

PRESS RELEASE Performance of the St
As of April 2020 PRESS RELEASE Performance of the St. John Passion in Leipzig's St. Thomas Church With an extraordinary performance of the St. John Passion, the Leipzig Bachfest will be bringing the world together on Good Friday in Johann Sebastian Bach’s church of St. Thomas – and the global Bach community is invited to sing along. In many places it is a tradition – sometimes going back more than 100 years – to perform a Bach Passion during the week before Easter. Many people all over the world regard it as an indispensable ritual to listen to or actually sing Bach’s settings of the story of Jesus’ Passion during Passiontide. This year, it is overshadowed by the Covid-19 pandemic. Hundreds, perhaps thousands of performances of Bach’s Passions worldwide have been cancelled owing to the restrictions on movement. To give the global Bach community a chance to actively participate in a Bach Passion in spite of this, the artistic director of the Leipzig Bachfest had an extraordinary idea: On Good Friday, 10 April, at the hour of Jesus’ death (3pm, CEST), a chamber music version of Johann Sebastian Bach’s famous St. John Passion will be performed at his tomb, and the global Bach community is invited to sing along. Prominent musicians from countries like the US, Canada and Malaysia will perform by video link. The concert will be livestreamed via the Bach Archive’s Facebook channel. Prof. Dr. Michael Maul, Artistic Director of the Leipzig Bachfest is excited: At this year’s Bachfest in June entitled BACH – We are FAMILY!, nearly 50 Bach choirs from all continents were to celebrate the greatest Bach family festival of all time in Leipzig and make music together in all kinds of ways. -

Travel Information Bach by Bike 2021
Bach by Bike 2021 New: bookable only via Bach by Bike! EXCLUSIVE BIKE JOURNEY ON THE TRAIL OF JOHANN SEBASTIAN BACH TRAVEL INFORMATION 2021 Dear friends of music and cycling, Johann Sebastian Bach (1685-1750) lived all his life in what is today Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt. As a world-famous composer, it is extraordinary that his life and work took place almost entirely within this limited area. Mareike Neumann and Anna-Luise Oppelt, two young Bach- and bike-enthusiasts, took the opportunity to develop a unique journey from Bach's birthplace Eisenach to his place of death, Leipzig. Come with us and “experience” Bach by Bike! The tour includes not only Eisenach and Leipzig, but also Mühlhausen, Wechmar, the Bach family's ancestral hometown, and Gotha, Ohrdruf, Arnstadt, Dornheim, Erfurt, Weimar, Naumburg, Weißenfels, Halle and Köthen. On long-distance bike paths, you will discover the charming landscapes of the Thuringian Forest, Ilm Valley, the wine-producing area Saale/Unstrut and the Saxonian Burgenland. You will explore museums, memorials and many original, preserved places, such as Dornheim Church, Bach's wedding church. In addition, you will meet people who, often on voluntary basis, protect Bach's heritage. Guided tours of organs, exclusive visits, intimate concerts and - for those who enjoy singing – sight-reading of Bach chorales during breaks will round off the trip. In 2021 every tour includes a festival; you will listen to top-class concerts in the end or during the tour (Bachfest Leipzig, Bach Biennale Weimar, Bach places of MDR Music Summer, Köthen Autumn Festival - Köthener Herbst). -

REVIEW: Remarkable Young Voices of World Famous Thomanerchor Fill Central Moravian Church at Bach Choir Gala Concert
REVIEW: Remarkable young voices of world famous Thomanerchor fill Central Moravian Church at Bach Choir gala concert By Steve Siegel Special to The Morning Call On Saturday afternoon, the Bach Choir of Bethlehem welcomed 50 singers from the world-famous Thomanerchor of Leipzig to Central Moravian Church in Bethlehem for its 2017 Gala Concert. Hardly had the boys started singing at the sold-out performance when it became obvious how perfectly the transparency and crispness of their remarkable young voices complemented the clear, bracing air outside. Led by Gotthold Schwarz, the 17th Saint Thomas Cantor after Bach, the program featured motets by Bach in addition to works by Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn, and Johann Hermann Schein. Accompanying the choir was a simple basso continuo of organ and cello. Surely this must have been what it was like to hear a cantata or motet in Bach’s own time, sung with such purity and minimalistic accompaniment. The boys, aged 9 to 18, presented an impressive visual spectacle, with the sopranos and altos dressed in natty dark blue blazers embellished with white stripes on the lapels, while the older tenors, baritones, and basses wore suits and ties. The distinct sound of this choir, with its history of more than 800 years of sacred music, was evident from the first work on the program, a setting of Psalm 100 by Schütz. Totally unlike the more ethereal sound of a British boy choir, here was unsentimental directness without a trace of vibrato. The voices of the younger singers seemed to be projected forward, launched from a solid platform established by the older tenors and basses. -

Veranstaltungen 2017–2018
VERANSTALTUNGEN 2017–2018 INHALT Grußworte Seite 4 Veranstaltungen Thomanerchor Seite 6 Thomaner werden Seite 37 Anna-Magdalena-Bach-Schule Leipzig Seite 38 Grundschule forum thomanum Seite 39 Veranstaltungen Thomaneranwärter Seite 40 Thomasschule Leipzig Seite 47 Thomanerchor Leipzig Seite 49 Thomaskantor Gotthold Schwarz Seite 51 Hinweise zu regelmäßigen Veranstaltungen | Information on events Seite 53 Stiftung Thomanerchor Seite 54 Förderkreis Thomanerchor Leipzig e. V. Seite 55 Thomaner im Schuljahr 2017/2018 Seite 56 Mitarbeiter-/innen Seite 57 Kontakte Seite 58 Impressum Seite 59 Seite 3 GRUSSWORTE Liebe Hörer und Freunde des Thomanerchores, so wie das vergangene wird auch das Chor- und In diesem Sinne möge unser Singen und Musizieren zur Ehre Gottes Schuljahr 2017/18 inspiriert sein vom Jubiläum geschehen und allen Hörern und Ausführenden zu Herzen gehen. der Reformation. Reformation bedeutet, sich auf Wurzeln zu besinnen und aus diesen Freude und Energie für die vor uns liegenden Aufgaben zu bekommen. Martin Luther hat „besonders die Musik gerne In herzlicher Verbundenheit, Ihr sehen (wollen) im Dienste dessen, der sie Gotthold Schwarz geschaffen hat…, (so) dass ein jeder fromme Christ sich das gefallen Thomaskantor lassen wolle“. Wunderbare Werke der Kirchenmusik werden in den Gottesdiensten, Motetten und Konzerten mit den Thomanern zu hören sein. Dabei stehen Musik und textliche Aussage in unmittelbarem Zusammenhang, ihre Verbindung ist die Voraussetzung für beste künstlerische Qualität. Ja, die zu hörende Musik (solle) „nicht bloß gefallen und ergötzen, wie das bloß Schöne und Angenehme in der Kunst…, sondern, dass sie in ihren Wirkungen immer stärker werde, je öfter wir sie hören“, so der erste Bachbiograf Forkel über die Musik von Johann Sebastian Bach. -

Bach-Konzerte Rund Um Die Wartburg
Detailprogramm: Thüringen Bach-Konzerte rund um die Wartburg © Tayte Campbell Shutterstock Das reizvolle Eisenach, von Martin Luther »meine liebe Stadt« genannt, liegt am Fuße der Wartburg und ist über die Jahrhunderte mit Musik verbunden wie kaum eine zweite Stadt. Hier kämpften schon im 12. Jahrhundert die Minnesänger um den Preis der Musen, hier war Georg Philipp Telemann als Hofkapellmeister tätig und hier verortete Richard Wagner seinen »Tannhäuser«. 1685 wurde in Eisenach Johann Sebastian Bach geboren. In den nahe gelegenen Städten Arnstadt und Mühlhausen erhielt er seine ersten längerfristigen Anstellungen als Organist. Seien Sie dabei, wenn im Rahmen des MDR-Musiksommers berühmte Interpreten wie Dorothee Oberlinger, die Thomaner und der MDR-Rundfunkchor in drei der schönsten Kirchen der Gegend musizieren, die für Bachs frühe Entwicklung prägend waren. Besuchen Sie das Bachhaus und die Wartburg, und begeben Sie sich bei Stadtspaziergängen auf geistesgeschichtliche und musikalische Spurensuche durch die Bach-Städte Arnstadt, Mühlhausen und Eisenach. Vielfältige Kostproben der thüringischen Küche runden das Programm ab. Unser Musikexperte Gregor Lütje begleitet Sie fachkundig! Termin: 16.07.2021 Dauer: 4 Tage | Code 812 Preis: 1.290 € 1 Detailprogramm: Thüringen Höhepunkte der Reise • Drei Konzerte mit Chor bzw. Orchester und Solo-Flöte in den drei Bach-Kirchen in Eisenach, Arnstadt und Mühlhausen • Exklusive Besichtigung der Wartburg • Privatführung im Bach-Museum mit kleinem Konzert an diversen Tasteninstrumenten • Führungen und Stadtspaziergänge durch Eisenach, Arnstadt und Mühlhausen Ihre Reiseleitung Gregor Lütje ist seit früher Kindheit in der Opern- und Konzertwelt zu Hause: Nach einer Karriere als 1. Solist im Tölzer Knabenchor, die ihn an führende europäische Opernhäuser und zur Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Herbert von Karajan, James Levine, Wolfgang Sawallisch und Nikolaus Harnoncourt geführt hat, war er später u.a. -

The Very Best of Saxony 1 Saxony?
the very best of saxony 1 SAXONY? “Why Saxony?” No one would have But since German reunification more asked this in the time before the and more people are discovering that Second World War, when Saxony the things that attracted people to was the economically strongest and Saxony earlier are still there: specta- most prosperous region in Germany. cular architecture, art collections of Business people came to Chemnitz, world renown, a deeply rooted love of the city with the highest industrial music, living traditions, and locations production in Germany, or to Leipzig, of world history, the strong attachment the center of commerce in Europe, a of the Saxons to their home, precious cosmopolitan city like London and skills and their love for life. But what Paris. And tourists came to Dresden, does Saxony have that other places do the richest and most beautiful city in not have? We will try to explain that Germany. But then Saxony fell behind on the following pages. We will not the Iron Curtain. For many people all present everything, but just the best, over the world, 1000 years of history the unique, the special, the things that fell into oblivion, 829 years of which make a trip to Saxony an authentic and saw Saxony ruled by a single family eye-opening experience. Welcome to and playing a leading role in Europe. the world of Saxony! 2 FIFTEEN REASONS TO VISIT SAXONY: THE GREATEST MUSICIAN OF ALL TIME 17 THE MOST UNUSUAL CAR FACTORY IN THE WORLD 35 THE FIRST PROTESTANT CHURCH BUILDING 50 A Paradise for Music Lovers Adventures on Four Wheels