David Oder Salomon?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prudentius of Troyes (D. 861) and the Reception of the Patristic Tradition in the Carolingian Era
Prudentius of Troyes (d. 861) and the Reception of the Patristic Tradition in the Carolingian Era by Jared G. Wielfaert A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by Jared Wielfaert 2015 Prudentius of Troyes (d. 861) and the Reception of the Patristic Tradition in the Carolingian Era Jared Gardner Wielfaert Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2015 ABSTRACT: This study concerns Prudentius, bishop of Troyes (861), a court scholar, historian, and pastor of the ninth century, whose extant corpus, though relatively extensive, remains unstudied. Born in Spain in the decades following the Frankish conquest of the Spanish march, Prudentius had been recruited to the Carolingian court under Louis the Pious, where he served as a palace chaplain for a twenty year period, before his eventual elevation to the see of Troyes in the 840s. With a career that moved from the frontier to the imperial court center, then back to the local world of the diocese and environment of cathedral libraries, sacred shrines, and local care of souls, the biography of Prudentius provides a frame for synthesis of several prevailing currents in the cultural history of the Carolingian era. His personal connections make him a rare link between the generation of the architects of the Carolingian reforms (Theodulf and Alcuin) and their students (Rabanus Maurus, Prudentius himself) and the great period of fruition of which the work of John Scottus Eriugena is the most widely recogized example. His involvement in the mid-century theological controversy over the doctrine of predestination illustrates the techniques and methods, as well as the concerns and preoccupations, of Carolingian era scholars engaged in the consolidation and interpretation of patristic opinion, particularly, that of Augustine. -

3. Texte, Identitäten Im Frankenreich 150 RUDOLF SCHIEFFER
3. Texte, Identitäten im Frankenreich 150 RUDOLF SCHIEFFER KARL DER GROSSE, EIRENE UND DER URSPRUNG DES WESTLICHEN KAISERTUMS Die Frage nach den Ursprüngen, die den roten Faden dieses Bandes ausmacht, stellt sich auch beim westlichen Kaisertum, das am Weihnachtstag 800 ins Leben trat und durch das Jubiläumsjahr 2000 erst jüngst wieder besondere Beachtung gefunden hat.1 Trotz vieler gelehrter Bemühungen in älterer und neuerer Zeit besteht durchaus keine hinreichende Klarheit darüber, woher der Gedanke kam und was den konkreten Anlaß abgab, eine solche feierliche Rangerhöhung des Frankenkönigs durch den Papst zu vollziehen, deren langfristige historische Tragweite ohnehin den Beteiligten schwer- lich vor Augen gestanden haben wird. Die vermißte Klarheit zu schaffen, traue auch ich mir in diesem kurzen Beitrag nicht zu; vielmehr habe ich nichts weiter anzubieten als einige Randbemerkungen zu den teilweise verblüffenden Wendungen, die die For- schungsdiskussion in den letzten Jahren genommen hat. Wer nach dem Ursprung des karolingischen Kaisertums sucht, kommt kaum umhin, zunächst Karl den Großen (samt seiner gelehrten Umgebung) in den Blick zu fassen, stand er doch im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in St. Peter und gewann dabei einen Zuwachs an Respekt und Selbstvertrauen, den er in den folgenden Jahren spürbar zur Geltung gebracht hat.2 Ein unmißverständliches Zeugnis für seinen Drang nach dem Kaisertum aus der Zeit vor 800 fehlt allerdings, und so wirkt seit jeher die Suggestion, die von Einhards Behandlung des Vorgangs ausgeht. Der Biograph, -
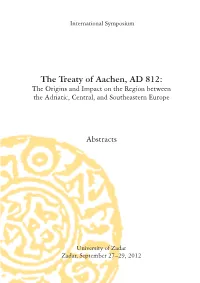
Borna's Polity Attested by Frankish Sources in the Territory of the Former
International Symposium The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Abstracts University of Zadar Zadar, September 27–29, 2012 Abstracts of the International Symposium The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Zadar, September 27–29, 2012 University of Zadar Department of History 2012 Frankish ducatus or Slavic Chiefdom? The Character of Borna’s Polity in Early-Ninth-Century Dalmatia Denis Alimov Borna’s polity, attested by Frankish sources on the territory of the former Roman province of Dalmatia in the first quarter of the 9th century, is traditionally considered to be the cradle of early medieval Croatian state. Meanwhile, the exact character of this polity and the way it was linked with the Croats as an early medieval gens remain obscure in many respects. I argue that Borna’s ducatus consisted of two political entities, the Croat polity proper, with its heartland in the region of Knin, and a small chiefdom of the Guduscani in the region of Gacka. Borna was the chief of the Croats, a group of people that gradually developed into an ethnic unit under the leadership of a Christianized military elite.. For all that, the process of the stabilization of the Croats’ group identity originally connected with the social structures of Pax Avarica and its transformation into what can be called gentile identity was very durable, the rate of the process being considerably slower than the formation of supralocal political organization in Dalmatia. -

Approaches to Community and Otherness in the Late Merovingian and Early Carolingian Periods
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by White Rose E-theses Online Approaches to Community and Otherness in the Late Merovingian and Early Carolingian Periods Richard Christopher Broome Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds School of History September 2014 ii The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The right of Richard Christopher Broome to be identified as Author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. © 2014 The University of Leeds and Richard Christopher Broome iii Acknowledgements There are many people without whom this thesis would not have been possible. First of all, I would like to thank my supervisor, Ian Wood, who has been a constant source of invaluable knowledge, advice and guidance, and who invited me to take on the project which evolved into this thesis. The project he offered me came with a substantial bursary, for which I am grateful to HERA and the Cultural Memory and the Resources of the Past project with which I have been involved. Second, I would like to thank all those who were also involved in CMRP for their various thoughts on my research, especially Clemens Gantner for guiding me through the world of eighth-century Italy, to Helmut Reimitz for sending me a pre-print copy of his forthcoming book, and to Graeme Ward for his thoughts on Aquitanian matters. -

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Die Franken und der Norden. Über die Schwierigkeit der Interpretation von frühmittelalterlichen Quellen zur Geschichte Dänemarks“ Verfasserin Sandra Polzer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im August 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 394 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte (Stzw) Betreuer: Doz. Klaus Lohrmann Inhaltsverzeichnis 1. Danksagung......................................................................................................................................... 4 2. Einleitung ............................................................................................................................................ 5 3. Ad Fontes – Die Herausforderungen im Umgang mit frühmittelalterlichen Texten ......................... 13 3.1. Die Begrifflichkeit in den fränkischen Quellen und das Problem der „doppelten Theoriebildung“ ....................................................................................................................... 13 3.2. Die Bedeutung von Schriftlichkeit im Frühmittelalter............................................................... 18 3.3. Ungeschriebene Gesetze – Die Auswirkungen von Oralität auf die Wahrnehmung von sozialen und politischen Zusammenhängen ........................................................................................... 22 3.4. Die Grundregeln des politischen Systems der Franken ............................................................. 32 4. Die Auseinandersetzung -

'Continuations' and the 'ARF'
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Memorable crises: Carolingian historiography and the making of Pippin’s reign, 750-900 Goosmann, F.C.W. Publication date 2013 Link to publication Citation for published version (APA): Goosmann, F. C. W. (2013). Memorable crises: Carolingian historiography and the making of Pippin’s reign, 750-900. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:01 Oct 2021 CHAPTER TWO Down the Rabbit Hole The Continuations and the ARF The modern perception of the reign of Pippin the Short is firmly grounded in the narratives of the Continuations to the Chronicle of Fredegar and the Annales Regni Francorum (ARF). Both texts, at least with regard to their description of Pippin’s reign, date to the second half of the eighth century. -

Conquest and Colonization in the Early Middle Ages: the Carolingians and Saxony, C
Conquest and Colonization in the Early Middle Ages: The Carolingians and Saxony, c. 751–842 by Christopher Thomas Landon A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright by Christopher Thomas Landon 2017 Conquest and Colonization in the Early Middle Ages: The Carolingians and Saxony, c. 751–842 Christopher Thomas Landon Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto 2017 Abstract This thesis reconsiders longstanding questions regarding the economic and ideological forces that drove Frankish expansion into Saxony in the late eighth and early ninth centuries, Frankish strategies of rule in the newly conquered region, and the effects of conquest and cultural disposession on the Saxons themselves. Specifically, the dissertation seeks to present a new interpretation of this critical historical episode as a process of colonization. After an introduction that briefly outlines various conceptions and definitions of colonization and how these apply to the early medieval period, chapter one provides an overview of the main Latin and Old Saxon sources regarding Saxony and the Saxons in the Carolingian period from the coronation of Pippin III to the suppression of the Saxon Stellinga uprising in 842. The chapter emphasizes the tendentious nature of these sources and the ways in which they reflect the perspective of the colonizer while obscuring the experiences of the colonized. Chapter two looks at the ideological justifications for the conquest advanced in the Frankish primary sources, arguing that the Franks’ forcible Christianization of the Saxons was driven in part by the Carolingian dynasty’s increasingly close ties with the papacy and by ancient imperial prerogatives regarding the extension of the faith. -
Scandinavian Way of Communication with the Carolingians and the Ottonians
Scandinavian way of communication with the Carolingians and the Ottonians Minoru OZAWA Nagoya University 1. Problems in determining the methods used to communicate between continental Europe and Scandinavia in the early Middle Ages The Spoleto Symposium, held in 2004, was remarkable for the fact that attending historians discussed certain problems of communication in the early middle ages.1 Since the 19th century, linguists and philologists have expanded our knowledge of medieval forms of communication,2 but the proceedings of the Symposium were still able to shed new light on some aspects of how languages functioned in a historical context. Regrettably, however, no articles devoted to Scandinavian cases were published in the proceedings. Why were Scandinavian cases excluded whenever any problems of communication in the early middle ages were discussed? Some reasons are immediately obvious. First, the Scandinavians communicated with each other in a different language from many other European cultures at this time. What we now call ‘Old Norse’ was the common language throughout Scandinavia at that time.3 Since it is one of the North Germanic languages, the Scandinavians could—by and large— make themselves understood to those who used Old English or Old German, whereas they had more difficulty in communicating with those who used Romance languages. Second, the Scandinavians used a different script to the Latin alphabet. Their own alphabet was runic, and is now known as the ‘futhark’. According to a recent study, the runes were created in the territory between the Roman world and the Germanic one somewhere around the first or second century CE.4 The futhark consisted of 24 letters up until the eighth century, when the number of the letters drastically decreased to 16.5 Third, no contemporary written documents have been transmitted to the present day. -

Chronicon Moissiacense Maius
Chronicon Moissiacense Maius A Carolingian World Chronicle From Creation until the First Years of Louis the Pious On the basis of the manuscript of the late Ir. J.M.J.G Kats Prepared and revised by D. Claszen Volume I: Introduction 2 D. Claszen MPhil Thesis S0438170 Prof. Dr. P.C.M. Hoppenbrouwers Verlengde Wassenaarseweg 12H Oegstgeest, 25 September 2012 2342 BG Oegstgeest Tel.: 06-36180791 E-mail: [email protected] 3 Table of Contents Abbreviations ............................................................................................................................. 6 Sigla ........................................................................................................................................... 7 Preface........................................................................................................................................ 9 Introduction .............................................................................................................................. 13 Chapter One: The manuscripts................................................................................................. 21 1.1 – Paris, Bibliothèque Nationale lat. 4886 ....................................................................... 21 1.2 – Paris, Bibliothèque Nationale lat. 5941 ....................................................................... 33 1.3 – The codices of the ‘Waitz group’ ................................................................................ 38 1.3.1 – Leiden, Universiteitsbibliotheek, -

The People at the Edge of the Empire
THE PEOPLE AT THE EDGE OF THE EMPIRE The representation of the Breton and Lombard identities in Carolingian historiography, 751 - 901 Course: Master’s thesis, Eternal Rome (LET-GESM4300) Student: Joppe Snellen Number: s4484940 Supervisor: Dr. Sven Meeder Date: 15 – 06 - 2019 Contents List of abbreviations ................................................................................................................................ 3 Bibliography:.......................................................................................................................................... 40 Sources .............................................................................................................................................. 40 Literature ........................................................................................................................................... 40 List of abbreviations AB - Annales Bertiniani AF - Annales Fuldenses ARF - Annales Regni Francorum AV - Annales Vedastini AX - Annales Xantenses Introduction Brittany and Lombardy, nowadays these are two regions at the edges of respectively France and Italy. One enclosed by the rough Atlantic ocean and the other overshadowed by the Alps. However, both are home to proud people with their own languages, a culture and identity distinct from their national culture and identity, and both know independency movements. Both the Bretons and the Lombards claim a history that can be traced back to the early middle ages. In that period they did not live on the borders -

Der Dynastiewechsel Von 751
Der Dynastiewechsel von 751 Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung Herausgegeben von Matthias Becher und jörg jarnut Scriptorium Münster 2004 ('J c:; ( -r 'i' ~ - ~--~~--~--_.-~. -~--~~~~-----------~ OLAF SCHNEIDER Die Königserhebung Pippins 751 in der Erinnerung der karolingischen Quellen: Die Glaubwürdigkeit der Reichsannalen und die Verformung der Vergangenhett" »[ ...] Bischof Burkhard von Würzburg und der Kaplan Folrad wurden zu Papst Zacha- rias gesandt, um wegen der Könige in Francien zu fragen, die damals keine Macht als Könige hatten, ob das gut sei oder nicht. Und Papst Zacharias gab Pippin Bescheid, es sei besser, den als König zu bezeichnen, der die Macht habe, statt den, der ohne königliche Macht blieb. Um die Ordnung nicht zu stören, ließ er kraft seiner aposto- lischen Autorität den Pippin zum König machen. [...] Pippin wurde nach der Sitte der Franken zum König gewählt und gesalbt von der Hand des Erzbischofs Bonifatius heiligenAndenkens und von den Franken in Soissons zum König erhoben. Hilderich aber, der Scheinkönig, wurde geschoren und ins Kloster geschickt. "1 Mit diesem viel zitierten Text berichtet der Verfasser der Reichsannalen bei deren erster und zugleich rückwirkender Abfassung um 790 über Pippins Königserhebung 751. Er datiert sie allerdings auf749 und 750. Und dieser Bericht prägt bis heute unser Bild vom damaligen Geschehen, wird immer wieder als Hauptquelle angeführt.s Bei den folgenden Überlegungen handelt es sich um eine erste Zusammenfassung der Thesen, die der Verfasser in seiner 1. Staatsarbeit für das Lehramt an Gymnasien entwickelt hat: O. SCHNEIDER,Die Reichs- annalen im Spannungsfeld ZWischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Königserhebungen von Pippin zu Karl dem Großen, Frankfurt a.M. 1998. 1 Die Reichsannalen, ed. -

Scandinavian History in the Viking Age: a Select Bibliography
Scandinavian History in the Viking Age A Select Bibliography Martin Syrett 3rd edition, revised by Haki Antonsson and Jonathan Grove Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic University of Cambridge 2004 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE DEPARTMENT OF ANGLO-SAXON, NORSE, AND CELTIC 9 West Road, Cambridge CB3 9DP Telephone: (01223) 335079 www.asnc.cam.ac.uk ASNC GUIDES, TEXTS, AND STUDIES Further information on this series will be found on the website of the Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic ISSN 1475-8520 1 Simon Keynes, Anglo-Saxon England: a Bibliographical Handbook for Students of Anglo-Saxon History, 5th ed. (2004) ISBN 0 9532172 8 0 2 Martin Syrett, Scandinavian History in the Viking Age: a Select Bibliography, 3rd ed., revised by Haki Antonsson and Jonathan Grove (2004) ISBN 0 9532172 9 9 3 Paul Russell, A Bibliography of Medieval Welsh Literature, 2nd ed., (2004) ISBN 0 9532697 3 6 4 Martin Syrett, The Vikings in England: the Evidence of Runic Inscriptions (2002) ISBN 0 9532697 4 4 5 Simon Keynes, An Atlas of Attestations in Anglo-Saxon Charters, c. 670 –1066, I: Tables (2002) ISBN 0 9532697 6 0 6 Rebecca Rushforth, An Atlas of Saints in Anglo-Saxon Calendars (2002) ISBN 0 9532697 7 9 Further volumes are in preparation Cover The ‘Jelling beast’ from the larger runestone at Jelling in Jutland, on which king Harald bluetooth proclaimed his sovereignty over Denmark and Norway as well as observing that he ‘made the Danes Christian’. Variously interpreted as a symbol of either pagan mythology or royal authority, the art-work reflects the Mammen style and is possibly to be dated to the 960s.