Endversion Vom 10.05.2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reviews of This Artist
Rezension für: Hertha Klust Pilar Lorengar: A portrait in live and studio recordings from 1959-1962 Vincenzo Bellini | Giacomo Puccini | Georg Friedrich Händel | Enrique Granados | Alessandro Scarlatti | Wolfgang Amadeus Mozart | Giuseppe Verdi | Joaquín Rodrigo | Joaquín Nin | Jesús García Leoz | Jesús Guridi | Eduardo Toldrà | _ Anonym | Jacobus de Milarte | Esteban Daza | Juan Bermudo | Luis de Narváez | Juan Vásquez | Alonso Mudarra | Luis de Milán | Diego Pisador | Enríquez de Valderrábano 3CD aud 21.420 operafresh.blogspot.de Tuesday, May 20, 2014 ( - 2014.05.20) Pilar Lorengar Live and Studio Recordings 1959-1962 Berlin In addition to the live opera recordings on this release, is the famous studio recording of songs with guitar featuring Siegfried Behrend available for the first time on CD outside of Japan. Full review text restrained for copyright reasons. Das Opernglas Juni 2014 (J. Gahre - 2014.06.01) CD News Ihre Stimme [strahlt] in diesen um 1960 gemachten Aufnahmen Wärme und Weiblichkeit aus, die den modernen Hörer durchaus gefangen nehmen können. Full review text restrained for copyright reasons. page 1 / 96 »audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • [email protected] • www.audite.de http://theaterpur.net Juni 2014 (Christoph Zimmermann - 2014.06.01) Tenorales Gruppenbild mit Damen Pilar Lorengars klares, sonnenhelles Organ lässt nirgends falsche Sentimentalität aufkommen. [...] Neuerlich bezaubert die Natürlichkeit der Darstellung ohne ein demonstratives Ausstellen vokaler Raffinessen. Full review text restrained for copyright reasons. Der Tagesspiegel 22.07.2014 (Frederik Hanssen - 2014.07.22) Klassik-CD der Woche: Pilar Lorengar Spanische Nächte Die Norma wie auch „Piangerò la sorte mia“ aus Händels „Giulio Cesare“ meistert sie mit Eleganz, jugendlicher Strahlkraft und schier endlosem Atem Full review text restrained for copyright reasons. -

Eberhard Waechter“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Eberhard Waechter“ Verfasserin Mayr Nicoletta angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl: A 317 Studienrichtung: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof.Dr. Hilde Haider-Pregler Dank Ich danke vor allem meiner Betreuerin Frau Professor Haider, dass Sie mir mein Thema bewilligt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich danke der Familie Waechter und Frau Anneliese Sch. für die Bereitstellung des Materials. Ich danke meiner Schwester Romy und meiner „Seelenverwandten“ Sheila und all meinen Freunden für ihre emotionale Unterstützung und die zahlreichen motivierenden Gespräche. Ich danke meinem Bruder Florian für die Hilfe im Bereich der Computertechnik. Ein großer Dank gilt meiner Tante Edith, einfach dafür, dass es dich gibt. Außerdem danke ich meinen Großeltern, dass sie meine Liebe zur Musik und zur Oper stets enthusiastisch aufgenommen haben und mit mir Jahr für Jahr die Operettenfestspiele in Bad Ischl besucht haben. Ich widme meine Diplomarbeit meinen lieben Eltern. Sie haben mich in den letzten Jahren immer wieder finanziell unterstützt und mir daher eine schöne Studienzeit ermöglicht haben. Außerdem haben sie meine Liebe und Leidenschaft für die Oper stets unterstützt, mich mit Büchern, Videos und CD-Aufnahmen belohnt. Ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis für eure oft komplizierte und theaterbessene Tochter. Ich bin glücklich und froh, so tolle Eltern zu haben. Inhalt 1 Einleitung .......................................................................................... -

17.2. Cylinders, Ed. Discs, Pathes. 7-26
CYLINDERS 2M WA = 2-minute wax, 4M WA= 4-minute wax, 4M BA = Edison Blue Amberol, OBT = original box and top, OP = original descriptive pamphlet. Repro B/T = Excellent reproduction Edison orange box and printed top. All others in clean, used boxes. Any mold on wax cylinders is always described. All cylinders not described as in OB (original box with generic top) or OBT (original box and original top) are boxed (most in good quality boxes) with tops and are standard 2¼” diameter. All grading is visual and refers to the cylinders rather than the boxes. Any major box problems are noted. CARLO ALBANI [t] 1039. Edison BA 28116. LA GIOCONDA: Cielo e mar (Ponchielli). Repro B/T. Just about 1-2. $30.00. MARIO ANCONA [b] 1001. Edison 2M Wax B-41. LES HUGUENOTS: Nobil dama (Meyerbeer). Announced by Ancona. OBT. Just about 1-2. $75.00. BLANCHE ARRAL [s] 1007. Edison Wax 4-M Amberol 35005. LE COEUR ET LA MAIN: Boléro (Lecocq). This and the following two cylinders are particularly spirited performances. OBT. Slight box wear. Just about 1-2. $50.00. 1014. Edison Wax 4-M Amberol 35006. LA VÉRITABLE MANOLA [Boléro Espagnole] (Bourgeois). OBT. Just about 1-2. $50.00. 1009. Edison Wax 4-M Amberol 35019. GIROLFÉ-GIROFLA: Brindisi (Lecocq). OBT. Just about 1-2. $50.00. PAUL AUMONIER [bs] 1013. Pathé Wax 2-M 1111. LES SAPINS (Dupont). OB. 2. $20.00. MARIA AVEZZA [s]. See FRANCESCO DADDI [t] ALESSANDRO BONCI [t] 1037. Edison BA 29004. LUCIA: Fra poco a me ricovero (Donizetti). -

Der Rosenkavalier by Richard Strauss
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2010 Octavian and the Composer: Principal Male Roles in Opera Composed for the Female Voice by Richard Strauss Melissa Lynn Garvey Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC OCTAVIAN AND THE COMPOSER: PRINCIPAL MALE ROLES IN OPERA COMPOSED FOR THE FEMALE VOICE BY RICHARD STRAUSS By MELISSA LYNN GARVEY A Treatise submitted to the Department of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Spring Semester, 2010 The members of the committee approve the treatise of Melissa Lynn Garvey defended on April 5, 2010. __________________________________ Douglas Fisher Professor Directing Treatise __________________________________ Seth Beckman University Representative __________________________________ Matthew Lata Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members. ii I’d like to dedicate this treatise to my parents, grandparents, aunt, and siblings, whose unconditional love and support has made me the person I am today. Through every attended recital and performance, and affording me every conceivable opportunity, they have encouraged and motivated me to achieve great things. It is because of them that I have reached this level of educational achievement. Thank you. I am honored to thank my phenomenal husband for always believing in me. You gave me the strength and courage to believe in myself. You are everything I could ever ask for and more. Thank you for helping to make this a reality. -

VOCAL 78 Rpm Discs Minimum Bid As Indicated Per Item
VOCAL 78 rpm Discs Minimum bid as indicated per item. Listings “Just about 1-2” should be considered as mint and “Cons. 2” with just the slightest marks. For collectors searching top copies, you’ve come to the right place! The further we get from the time of production (in many cases now 100 years or more), the more difficult it is to find such excellent extant pressings. Some are actually from mint dealer stocks and others the result of having improved copies via dozens of collections purchased over the past fifty years. * * * For those looking for the best sound via modern reproduction, those items marked “late” are usually of high quality shellac, pressed in the 1950-55 period. A number of items in this particular catalogue are excellent pressings from that era. * * * Please keep in mind that the minimum bids are in U.S. Dollars, a benefit to most collectors. * * * “Text label on verso.” For a brief period (1912-14), Victor pressed silver-on-black labels on the reverse sides of some of their single-faced recordings, usually with a translation of the text or similarly related comments. BESSIE ABOTT [s]. Riverdale, NY, 1878-New York, 1919. Following the death of her father which left her family penniless, Bessie and her sister Jessie (born Pickens) formed a vaudeville sister vocal act, accompanying themselves on banjo and guitar. Upon the recommendation of Jean de Reszke, who heard them by chance, Bessie began operatic training with Frida Ashforth. She subsequently studied with de Reszke him- self and appeared with him at the Paris Opéra, making her debut as Gounod’s Juliette. -

DIE LIEBE DER DANAE July 29 – August 7, 2011
DIE LIEBE DER DANAE July 29 – August 7, 2011 the richard b. fisher center for the performing arts at bard college About The Richard B. Fisher Center for the Performing Arts at Bard College The Richard B. Fisher Center for the Performing Arts, an environment for world-class artistic presentation in the Hudson Valley, was designed by Frank Gehry and opened in 2003. Risk-taking performances and provocative programs take place in the 800-seat Sosnoff Theater, a proscenium-arch space; and in the 220-seat Theater Two, which features a flexible seating configuration. The Center is home to Bard College’s Theater and Dance Programs, and host to two annual summer festivals: SummerScape, which offers opera, dance, theater, operetta, film, and cabaret; and the Bard Music Festival, which celebrates its 22nd year in August, with “Sibelius and His World.” The Center bears the name of the late Richard B. Fisher, the former chair of Bard College’s Board of Trustees. This magnificent building is a tribute to his vision and leadership. The outstanding arts events that take place here would not be possible without the contributions made by the Friends of the Fisher Center. We are grateful for their support and welcome all donations. ©2011 Bard College. All rights reserved. Cover Danae and the Shower of Gold (krater detail), ca. 430 bce. Réunion des Musées Nationaux/Art Resource, NY. Inside Back Cover ©Peter Aaron ’68/Esto The Richard B. Fisher Center for the Performing Arts at Bard College Chair Jeanne Donovan Fisher President Leon Botstein Honorary Patron Martti Ahtisaari, Nobel Peace Prize laureate and former president of Finland Die Liebe der Danae (The Love of Danae) Music by Richard Strauss Libretto by Joseph Gregor, after a scenario by Hugo von Hofmannsthal Directed by Kevin Newbury American Symphony Orchestra Conducted by Leon Botstein, Music Director Set Design by Rafael Viñoly and Mimi Lien Choreography by Ken Roht Costume Design by Jessica Jahn Lighting Design by D. -

Kulturelles Erbe“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Die Rezeption von Richard Wagners Opern in der Zwischenkriegszeit im Spannungsfeld österreichischer Identitäten.“ Verfasserin Elisabeth Gelinek angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Philipp Ther, MA DANKSAGUNG Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Prof. Ther für sein Interesse an meiner Diplomarbeit sowie für seine Geduld und konstruktiven Input während ihrer Entstehung. Bei meinen Eltern und Familie bedanke ich mich für den finanziellen Beistand und ihre liebevolle Unterstützung. Vor allem möchte ich meinem Vater Oskar danken, der während des Schreibens sehr viel Zeit und Geduld investiert hat und mir in vielen ideenreichen Gesprächen zur Seite stand. Bei Florian bedanke ich mich ganz besonders für seinen beständigen und aufbauenden Zuspruch. Inhalt 1 Einleitung ............................................................................................................................... 1 2 Österreichische Identität nach dem 1. Weltkrieg. Nationale Identitätskonstruktion durch kulturelle und musikalische Praxis ........................................................................... 10 2.1 Die Darstellung eines „Österreich“-Begriffes in der Parteiideologie der Sozialdemokraten und der Christlichsozialen Parteien und deren Vorläufer ...................... 13 2.1.1 Die Sozialdemokraten ............................................................................................ -

Central Opera Service Bulletin
CENTRAL OPERA SERVICE BULLETIN WINTER, 1972 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council Central Opera Service • Lincoln Center Plaza • Metropolitan Opera • New York, N.Y. 10023 • 799-3467 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council Central Opera Service • Lincoln Canter Plaza • Metropolitan Opera • New York, NX 10023 • 799.3467 CENTRAL OPERA SERVICE COMMITTEE ROBERT L. B. TOBIN, National Chairman GEORGE HOWERTON, National Co-Chairman National Council Directors MRS. AUGUST BELMONT MRS. FRANK W. BOWMAN MRS. TIMOTHY FISKE E. H. CORRIGAN, JR. CARROLL G. HARPER MRS. NORRIS DARRELL ELIHU M. HYNDMAN Professional Committee JULIUS RUDEL, Chairman New York City Opera KURT HERBERT ADLER MRS. LOUDON MEI.LEN San Francisco Opera Opera Soc. of Wash., D.C. VICTOR ALESSANDRO ELEMER NAGY San Antonio Symphony Ham College of Music ROBERT G. ANDERSON MME. ROSE PALMAI-TENSER Tulsa Opera Mobile Opera Guild WILFRED C. BAIN RUSSELL D. PATTERSON Indiana University Kansas City Lyric Theater ROBERT BAUSTIAN MRS. JOHN DEWITT PELTZ Santa Fe Opera Metropolitan Opera MORITZ BOMHARD JAN POPPER Kentucky Opera University of California, L.A. STANLEY CHAPPLE GLYNN ROSS University of Washington Seattle Opera EUGENE CONLEY GEORGE SCHICK No. Texas State Univ. Manhattan School of Music WALTER DUCLOUX MARK SCHUBART University of Texas Lincoln Center PETER PAUL FUCHS MRS. L. S. STEMMONS Louisiana State University Dallas Civic Opera ROBERT GAY LEONARD TREASH Northwestern University Eastman School of Music BORIS GOLDOVSKY LUCAS UNDERWOOD Goldovsky Opera Theatre University of the Pacific WALTER HERBERT GIDEON WALDKOh Houston & San Diego Opera Juilliard School of Music RICHARD KARP MRS. J. P. WALLACE Pittsburgh Opera Shreveport Civic Opera GLADYS MATHEW LUDWIG ZIRNER Community Opera University of Illinois See COS INSIDE INFORMATION on page seventeen for new officers and members of the Professional Committee. -

Chronology 1916-1937 (Vienna Years)
Chronology 1916-1937 (Vienna Years) 8 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe; first regular (not guest) performance with Vienna Opera Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Miller, Max; Gallos, Kilian; Reichmann (or Hugo Reichenberger??), cond., Vienna Opera 18 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Gallos, Kilian; Betetto, Hermit; Marian, Samiel; Reichwein, cond., Vienna Opera 25 Aug 1916 Die Meistersinger; LL, Eva Weidemann, Sachs; Moest, Pogner; Handtner, Beckmesser; Duhan, Kothner; Miller, Walther; Maikl, David; Kittel, Magdalena; Schalk, cond., Vienna Opera 28 Aug 1916 Der Evangelimann; LL, Martha Stehmann, Friedrich; Paalen, Magdalena; Hofbauer, Johannes; Erik Schmedes, Mathias; Reichenberger, cond., Vienna Opera 30 Aug 1916?? Tannhäuser: LL Elisabeth Schmedes, Tannhäuser; Hans Duhan, Wolfram; ??? cond. Vienna Opera 11 Sep 1916 Tales of Hoffmann; LL, Antonia/Giulietta Hessl, Olympia; Kittel, Niklaus; Hochheim, Hoffmann; Breuer, Cochenille et al; Fischer, Coppelius et al; Reichenberger, cond., Vienna Opera 16 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla Gutheil-Schoder, Carmen; Miller, Don José; Duhan, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 23 Sep 1916 Die Jüdin; LL, Recha Lindner, Sigismund; Maikl, Leopold; Elizza, Eudora; Zec, Cardinal Brogni; Miller, Eleazar; Reichenberger, cond., Vienna Opera 26 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla ???, Carmen; Piccaver, Don José; Fischer, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 4 Oct 1916 Strauss: Ariadne auf Naxos; Premiere -

Franz Schmidt
Franz Schmidt (1874 – 1939) was born in Pressburg, now Bratislava, a citizen of the Austro- Hungarian Empire and died in Vienna, a citizen of the Nazi Reich by virtue of Hitler's Anschluss which had then recently annexed Austria into the gathering darkness closing over Europe. Schmidt's father was of mixed Austrian-Hungarian background; his mother entirely Hungarian; his upbringing and schooling thoroughly in the prevailing German-Austrian culture of the day. In 1888 the Schmidt family moved to Vienna, where Franz enrolled in the Conservatory to study composition with Robert Fuchs, cello with Ferdinand Hellmesberger and music theory with Anton Bruckner. He graduated "with excellence" in 1896, the year of Bruckner's death. His career blossomed as a teacher of cello, piano and composition at the Conservatory, later renamed the Imperial Academy. As a composer, Schmidt may be seen as one of the last of the major musical figures in the long line of Austro-German composers, from Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner and Mahler. His four symphonies and his final, great masterwork, the oratorio Das Buch mit sieben Siegeln (The Book with Seven Seals) are rightly seen as the summation of his creative work and a "crown jewel" of the Viennese symphonic tradition. Das Buch occupied Schmidt during the last years of his life, from 1935 to 1937, a time during which he also suffered from cancer – the disease that would eventually take his life. In it he sets selected passages from the last book of the New Testament, the Book of Revelation, tied together with an original narrative text. -

Bruno Walter (Ca
[To view this image, refer to the print version of this title.] Erik Ryding and Rebecca Pechefsky Yale University Press New Haven and London Frontispiece: Bruno Walter (ca. ). Courtesy of Österreichisches Theatermuseum. Copyright © by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections and of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Sonia L. Shannon Set in Bulmer type by The Composing Room of Michigan, Grand Rapids, Mich. Printed in the United States of America by R. R. Donnelley,Harrisonburg, Va. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Ryding, Erik S., – Bruno Walter : a world elsewhere / by Erik Ryding and Rebecca Pechefsky. p. cm. Includes bibliographical references, filmography,and indexes. ISBN --- (cloth : alk. paper) . Walter, Bruno, ‒. Conductors (Music)— Biography. I. Pechefsky,Rebecca. II. Title. ML.W R .Ј—dc [B] - A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. For Emily, Mary, and William In memoriam Rachel Kemper and Howard Pechefsky Contents Illustrations follow pages and Preface xi Acknowledgments xv Bruno Schlesinger Berlin, Cologne, Hamburg,– Kapellmeister Walter Breslau, Pressburg, Riga, Berlin,‒ -
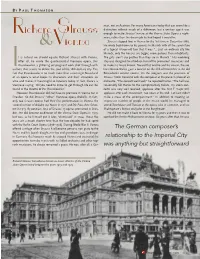
Richard Strauss and Vienna.Pdf
Arabella 2018 insert.qxp_Arabella 2018 10/3/18 3:36 PM Page 4 B Y P AUL T HOMASON man, not an Austrian. For many Americans today that can seem like a distinction without much of a difference, but a century ago it was ichard trauss enough to make Strauss’ tenure at the Vienna State Opera a night- R S mare, rather than the dream job he had hoped it would be. Strauss stepped foot in Vienna for the first time in December 1882. ienna He wrote back home to his parents in Munich with all the savoir faire &V of a typical 18-year-old boy that it was “… just an ordinary city like Munich, only the houses are bigger, more palaces than inhabitants. t is natural we should equate Richard Strauss with Vienna. The girls aren’t any prettier than they are in Munich.” His weeklong After all, he wrote the quintessential Viennese opera, Der stay was designed to introduce himself to prominent musicians and Rosenkavalier, a glittering yet poignant work shot through with to make his music known. Toward that end he and his cousin, the vio- waltzes that seems to define the soul of the 18th-century city. The linist Benno Walter, gave a concert on the fifth of December in the old Ifact that Rosenkavalier is so much more than a nostalgic Neverland Bösendorfer concert rooms. On the program was the premiere of of an opera is what keeps its characters and their situations so Strauss’ Violin Concerto with the composer at the piano in place of an alive and makes it meaningful to listeners today.