Kluger__Hochmeister Hermann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ursprung Und Entstehung Von NS-Verfolgungsbedingt
Ursprung und Entstehung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, die Anfänge der Restitution und ihre Bearbeitung aus heutiger Sicht am Beispiel der ULB Münster und der USB Köln Bachelorarbeit Studiengang Bibliothekswesen Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften Fachhochschule Köln vorgelegt von: Jan-Philipp Hentzschel Starenstr. 26 48607 Ochtrup Matr.Nr.: 11070940 am 01.02.2013 bei Prof. Dr. Haike Meinhardt Abstract (Deutsch) Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Restitution von NS- verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut. Während der Zeit des „Dritten Reichs“ pro- fitierten deutsche und österreichische Bibliotheken in hohem Maß von den Kulturgut- raubzügen der diversen NS-Organisationen. Millionen von Büchern gelangten aus dem In- und Ausland unrechtmäßig in ihre Bestände, wo sie lange unbeachtet verblieben. Erst in den 1980er Jahren begann man in Bibliothekskreisen mit einer kritischen Ausei- nandersetzung der NS-Vergangenheit, die in den 90er Jahren durch politische Erklärun- gen und erste Rechercheprojekte weiter forciert wurde. Seitdem wurden die Bemühun- gen, das NS-Raub- und Beutegut aufzuspüren, es an die rechtmäßigen Eigentümer oder Erben zurückzuerstatten und die Projekte umfassend zu dokumentieren, stetig intensi- viert. Dennoch gibt es viele Bibliotheken, die sich an der Suche noch nicht beteiligt ha- ben. Diese Arbeit zeigt die geschichtliche Entwicklung der Thematik von 1930 bis in die heutige Zeit auf und gewährt Einblicke in die Praxis. Angefangen bei der Vorstellung einflussreicher -

How to Get There Festivities and Fun Places of Interest Paderborn Today
Paderborn today Places of interest www.paderborn.de Walking through Paderborn is like In the city, there are also various walking through the centuries. examples of Baroque architecture. The cityscape unmistakably mir- Among the most significant build- rors the city’s eventful history of ings are the former Jesuitenkirche more than 1,200 years. The centre (16) with its reconstructed high alone contains more than twenty altar, the Franziskanerkirche (17) in historical buildings of all architec- the pedestrian area, the Michaels- tural epochs. kirche (9), the Archbishop’s Palace The reconstructed Ottonian-Salic (Erzbischöfliches Palais) (13), the imperial palace (Kaiserpfalz) (1) to Libori Chapel (18) on Liboriberg, the north of the cathedral was built the Kapuzinerkirche (19) as well in the Romanesque period. as the former Domdechanei (8), In front of it, the foundation walls today’s municipal library. of Charlemagne’s palace can be The recent past has also shaped seen. The Bartholomäuskapelle the cityscape significantly. The with its extraordinary acoustics Libori-Galerie next to the Arch- was built in 1017 and is con- bishop’s Palace (13), the Rathaus- sidered to be Germany’s oldest passage between Rathausplatz (4) : Richard Padzikowski hall church. The influence of the and Rosenstraße as well as a few s Romanic era can clearly be seen other buildings in the pedestrian on three churches: the octagonal area are successful examples of Photo tower of the Gaukirche (3), the architectural enhancements from Experience the pulsating life of a Abdinghofkirche (6) with its striking the past two decades. modern and upcoming city with a twin towers, and the Busdorfkirche In 2011, the group of buildings sur- wide offer of cutural activities and (12) with its remarkable cloister rounding Neuer Platz (20) with its leisure time facilities. -

Vorträge Im Sommersemester 2013
PUZ-1.2012-U1-4_PUZ 2_2010_1-4.0 29.05.12 11:34 Seite 2 DESIGN: WWW.KOMMA-DESIGN.DE GESAMTKONZEPT: REFERAT HOCHSCHULMARKETING UND UNIVERSITÄTSZEITSCHRIFT - RAMONA WIESNER - RAMONA HOCHSCHULMARKETING UND UNIVERSITÄTSZEITSCHRIFT REFERAT GESAMTKONZEPT: WWW.KOMMA-DESIGN.DE DESIGN: Dieses Plakat ist erhältlich im Referat Hochschulmarketing und Universitätszeitschrift – www.upb.de/hochschulmarketing p u z Editorial PADERBORNER UNIVERSITÄTSZEITSCHRIFT Ausgabe Sommersemester 2013 Nachrichten und Berichte aus der Universität Paderborn Titelseite: upb.de/abi-x-2 Die Universität Paderborn und der Ramona Wiesner Doppelabiturjahrgang im Jahr 2013. Leiterin des Referats Hochschulmarketing und Universitätszeitschrift Foto: Patrick Kleibold Liebe Leserinnen und Leser, Impressum in den letzten acht Jahren hat sich das Gesicht der Universität stark gewan- Paderborner Universitätszeitschrift (puz) Sommersemester 2013 delt: Viele neue Bauten sind entstanden, Verwaltung und Wissenschaft en- ger zusammengerückt. Das ist unter anderem auch ein Verdienst von Kanz- Herausgeber ler Jürgen Plato, der mit seinem Engagement seit Juni 2005 dazu beigetra- Der Präsident der Universität Paderborn gen hat, dass sich die Universität so erfolgreich entwickelt. Mitte Mai reich- Prof. Dr. Nikolaus Risch te er den Staffelstab an seine Nachfolgerin Simone Probst weiter. Im Inter- Redaktion view ab Seite 10 lässt er seine Amtszeit noch einmal Revue passieren. Ramona Wiesner Auf zu neuen Ufern heißt es ebenfalls beim Start des neuen Masterpro- Leiterin des Referats Hochschul marketing und gramms „Maschinenbau China: mb-cn“. Seit dem Wintersemester 2012/ Universitätszeitschrift 2013 können die Studierenden erstmals ergänzend zu ihrer ingenieurwis- Stabsstelle des Präsidenten senschaftlichen Ausbildung interkulturelle Kompetenzen erwerben und die Warburger Str. 100 chinesische Sprache lernen. Lesen Sie ab Seite 18, wie die Universität ihre 33098 Paderborn Studierenden mit diesem Programm für die Herausforderungen des chinesi- 05251 60-2553 schen Marktes fit macht. -

„Ich Mag: We Serve“ Der Friedensnobelpreisträger Und Lion Zeigt Sich in Einem Seiner Seltenen Interviews Top Informiert
Deutsche Ausgabe www.lions.de Mai – 2011 Das offizielle Magazin von Lions Clubs International – We Serve „Ich mag: We Serve“ Der Friedensnobelpreisträger und Lion zeigt sich in einem seiner seltenen Interviews top informiert 1980: Lech Walesa verkündet den Sieg der „Solidarnosc“´ ´ Seite 17 Start der Summer-University am 29. Juli | Nachwuchskräfte der Wirtschaft und Wissenschaft aus dem In- und Ausland können teilnehmen "'('( ##("$ )((&)(*%$$ .0#0./%*0)%!/!/((!.2. .!!*%) (/!-*#!*!$))$/%!6-$%*/!-.%$.$(%!8!* 0* %!-%1/.,$4-!%*!%*!-%* %1% 0!((!%*#!-%$ $ )('"$ /!/!*+$*0*##!*%!8!*9%)0#0./%*0)%./ ##&' %!.!-+)"+-/)%/ !-%$!-$!%/1!-0* !* .. )#-"#)& &! !-3!%/"6-((!.#!.+-#/%./ )$& %$ +)0)"*#-!%$!*0(/0-0* !-*./(/0*#.* %$$ #!+/!-./-!'!*.%$!-1%!0* !/-!00*#%.30- &)$'* 0* 0)1!-.+-#0*#%)-*'$!%/.0* ;!#!"(( (#%" 0- .0#0./%*0)%!/!/ %!5#(%$'!%/%.30- %&(#)$ $5$./!*;!#!./0"!%* !-!%#!*!*+$*0*# ''$ & )& 0-$ %!;!#!)%/-!%/!-"$(%$0* )!*.$(%$ #)& +,/%)(!/-!0/302!- !* "& ''" *"+-)%!-!*%!.%$!%!%*!-0."6$-0*#6!-!%* " $#$%* &" $ .!(./!./%))/!.!!*%)(/!- &')& $"$)$ ,""$ -$$ 7#0/!/-!0/2+$*!*:%)+*/ %( 7,-%1/!;!#!'+./!*0" :)+*/(%$!#-!*3/ * $)&( 70)"*#-!%$!.0(/0-0* !-1%!*#!+/ ()((&( +&" $$ )'-&)$$!$ ((*%'%* !$ &'($#'( #%$( & %-"-!0!*0*.0"$-!*!.0$ !$-*"+-)/%+*!*0*/!- 2220#0./%*0) !!(!"+* EDITORIAL Terminsache! Liebe Lions, wie Sie wissen, schlagen zwei Her- zen im meiner Brust. Einerseits das eines Lion, andererseits das eines Journalisten und Journa- listik-Dozenten. Umso erfreulicher, wenn sich die beiden Herzschläge synchonisieren, wenn Zucchi – erleben Sie es um -

Findbuch Als
Inhaltsverzeichnis Vorwort X Unsystematisiertes 1 01.01 Allgemein 2 01.02 Zeitschriften und Reihenwerke (Periodika und Serien über einzelne Sachgebiete unter den betreffenden Sachge- bieten) 3 01.02.01 Kalender (auch: Sekundärliteratur zu einzelnen Kalendern) 10 01.02.02 Zeitschriften und Zeitungen (Sekundärliteratur zu Zeitschriften und Zeitungen s. u. 08.08) 19 01.02.03 Schriftenreihen (auch: Sekundärliteratur zu einzel- nen Reihen) 32 01.03 Heimatforschung 37 01.03.01 Allgemeines (Heimatkundeunterricht s. u. 09.02.07 Schulfächer) 38 01.03.03 Vereine (auch: Wandervereine) 45 01.03.04 Veranstaltungen 56 01.04 Wörterbücher und Enzyklopädien 58 02.01 Allgemeine Landeskunde und Landesbeschreibung 69 02.01.02 Teilgebiete (hier: Begrenzte Gebiete, Teile von Lippe; Gebiete A-Z); Einzelne Ortschaften s. u. 11.02 und 02.02 Geographische Landeskunde 70 02.02 Geographische Landeskunde 71 02.03 Landesaufnahme 73 02.03.01 Vermessungen (hier keine Karten) 74 02.03.02 Kartenwerke 76 02.04 Bildwerke; Bildbände 79 02.05 Reiseführer 82 02.05.01 Gesamtgebiet und größere Gebietsteile (Gebiete A-Z) 82 02.05.02 Örtliche Führer und Prospekte (Ortschaften A-Z) 92 02.05.03 Reisebeschreibungen 99 02.06 Bodengestaltung 101 02.07 Gewässer 102 02.09 Pflanzen 102 02.10 Tiere 103 02.11 Natur- und Landschaftsschutz 104 03.00 Bevölkerung 105 03.01 Bevölkerung - Allgemeines 106 I 03.01.01 Bevölkerungsgeographie 107 03.01.02 Bevölkerungsstatistik (hier: Volkszählungen) 109 03.01.03 Adressbücher 109 03.01.04 Soziologische Aspekte 111 03.02 Bevölkerungsbewegung 112 03.02.02 Einwanderung 112 03.02.03 Auswanderung 117 03.03 Bevölkerungsgruppen (auch: Volkskunst) 118 03.04 Allgemeine Volkskunde 130 03.05 Siedlung (prähhistorische Siedlungen s.a. -
Mediævalia Textos E Estudos 35 (2016)
ÍNDICES MEDIÆVALIA TEXTOS E ESTUDOS 35 (2016) GABINETE DE DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA FILOSOFIA MEDIEVAL 1 00-Introdução.indd 1 19/01/19 16:58 ÍNDICES Mediaevalia. Textos e estudos is a double peer review journal with printed and online editions. Journal of the Gabinete de Filosofia Medieval / Medieval & Early Modern Philosophy thematic line of the Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, directed until 2013 by Professor Maria Cândida Pacheco. The journal was founded in 1992 with the support of the Fundação Eng. António de Almeida, and is published by the Faculdade de Letras da Universidade do Porto since 2000. DOI vol. 35 (2016): http://dx.doi.org/10.21747/21836884/med35 Editor / Diretor José Meirinhos (Universidade do Porto) Editorial Board / Secretariado editorial Celia López Alcalde — João Rebalde — Paula Oliveira e Silva (Universidade do Porto) Joana Matos Gomes, webmaster (Universidade do Porto) Scientific Board / Conselho Científico Alessandra Beccarisi (Università del Salento, Jacob Schmutz (Université Paris-Sorbonne) Lecce) Jeffrey Witt (Loyola University Maryland, Alexander Fidora (Universitat Autònoma de Baltimore) Barcelona) Maria Leonor Xavier (Universidade de Lisboa) Andrea Robiglio (Katholiek Universiteit Leuven) Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Catarina Belo (The American University in Cairo) Coimbra) Catherine König-Pralong (Albert-Ludwigs- Martin Pickavé (University of Toronto) Universität Freiburg) Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto) Cecilia Martini Bonadeo (Università degli studi di Nadja Germann -
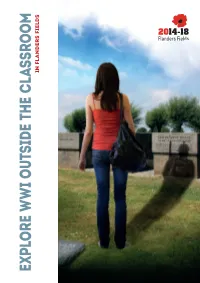
Explo Re W W I O Utside the C Lassro
Explore WWI outside the classroom in FLANDERS FIELDS - Explore with your class WWI 1 in FIELDS FLANDERS is booklet brings together inspiring initiatives in various counties and cities around the First World War. Use this guide to create your own WWI trip and wander o the beaten track. 2 - Explore with your class WWI Explore WWI outside the classroom WWI the outside Explore PREFACE This guide, produced by Visit Flanders in partnership with the Province of West Flanders, aims to help tour operators and teachers organise field trips to WWI sites for English-language primary and secondary school pupils. The guide provides dozens of ideas for enriching the experience for the children. You will find the most famous WWI memorials on the Western Front in Flanders listed in these pages but also many other locations in Flanders Fields and the wider area that tell the story of occupied Belgium. In other words, besides the ones we have all heard of, there are many smaller sites worthy of a visit. Moreover, this guide covers tips for visiting a memorial, teaching resources for preparing a trip, interesting websites, accommodation, alternative transport, how to organise a multi-day trip, and information on the cultural programme GoneWest, including the unique sculpture project ‘ComingWorldRememberMe’. We profoundly hope this information will inspire and help you to schedule trips to Flanders Fields with your school groups. They are most welcome – we consider it our duty to pass on the legacy of WWI by offering them a quality educational and visitor experience. 5 - Geert Bourgeois Minister-President of Flanders Flemish Minister for Foreign Policy and Immovable Heritage Myriam Vanlerberghe Commissioner for Culture, Province of West Flanders Explore with your class WWI PRACTICAL INFORMATION TABLE OF CONTENTS This guide provides you with an overview of the educational facilities for each 9 Introduction site. -

World Heritage and Arts Education
Ausgabe 5 Januar 2012 World Heritage and Arts Education Forschunsperspektiven Neue Zugänge zum und Methoden Weltnaturerbe. Daily Painting World Heritage Alte Buchenwälder Deutschland und Wattenmeer Welterbevermittlung und Schule Kulturelles Erbe Claude Monet Sonderteil Welterbe. Kinderseiten Kunst und MINT-Fächer Titelbild: Foto: Jutta Ströter-Bender Sabrina Zimmermann. Museumskoffer. Waldtiere malen. UNESCO Welterbe Alte Buchenwälder Deutschlands. 2011 Forschungsperspektiven und Methoden Arbeitskreis World Heritage Education am 11.11.2011 an der Universität Paderborn – Netzwerkbildungen und Kooperationen in der World Heritage Education (WHE) Diana Köckerling 4 Keynote zum 1. Arbeitskreistreffen World Heritage Education am 6. Mai 2011 Pädagogische Hochschule Heidelberg, Abteilung Geographie Jutta Ströter-Bender 5 Daily Painting World Heritage. Mit einer Welterbestätte in einen Dialog treten. Malerei als künstlerische Forschungsmethode. Jutta Ströter-Bender 9 Welterbevermittlung und Schule Verbindung von World Heritage Education und regionaler Kulturvermittlung im Kunstunterricht – eine Anknüpfungsmöglichkeit an die Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern Christine A. K. M. Flamme 14 Feuerstätten und Rauchhäuser in Quedlinburg Ilona Glade 20 Sonderteil Welterbe. Kunst und MINT-Fächer Welterbe. Kunst und MINT-Fächer Jutta Ströter-Bender 27 Schnittstellen zwischen der Naturwissenschaft Chemie und der Bildenden Kunst Andreas Flemig 28 Inhaltsverzeichnis Neue Zugänge zum Weltnaturerbe. Alte Buchenwälder Deutschland und Wattenmeer. Weltnaturerbe Alte Buchenwälder Deutschland Johanna Tewes 40 ARTcatching for World Heritage Sites - ein Konzept für die Vermittlung von Weltnaturerbe Impressum Corinna Pott 41 Welterbeforschung mit den Mitteln der Malerei World Heritage And Arts Education Ein Interview mit Valérie Dezes und Marlon von Rüden. 51 Ausgabe 5, Januar 2012 Mit künstlerischen Mitteln den Wald erkunden 54 „Natur und Naturdarstellungen in Kunst und Literatur Herausgeberin – Von Dürer zur Romantik“ - Ein Museumskoffer zum Wald Prof. -

Das Deutsche Schulgeschichtsbuch 1700
Eckert.Beiträge 2013/1 Wolfgang Jacobmeyer Das deutsche Schulgeschichtsbuch 1700 – 1945 Die erste Epoche seiner Gattungsgeschichte im Spiegel der Vorworte Band 3: Dokumentation der Vorworte und Lehrbücher 1871 - 1945 Jacobmeyer, Wolfgang. „Das deutsche Schulgeschichtsbuch 1700 – 1945: Die erste Epoche seiner Geistesgeschichte im Spiegel der Vorworte. Band 3: Dokumentation der Vorworte und Lehrbücher 1871 – 1945.“ Eckert.Beiträge 2013/1. http://www.edumeres.net/urn/urn:nbn:de:0220-2013-0001-0039. Diese Publikation wurde veröffentlicht unter der creative-commons-Lizenz: Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0); http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ INHALT DES DR I TTEN BANDES 2.0 Dokumentation der Vorworte und Lehrbücher 2.5 5. Periode: 1871-1889 .................................................................................... 947 2.6 6. Periode: 1890-1918 .................................................................................. 1109 2.7 7. Periode: 1919-1933 .................................................................................. 1391 2.8 8. Periode: 1933-1945 .................................................................................. 1483 5. Periode: 1871-1889 947 5. PER I ODE : 1871-1889 790 | Leopold Conrad1, Geschichte Preußens nebst einem Auszuge aus der brandenburgischen Geschichte, Ein Schul- und Volksbuch. Tilsit: Reyländer 41871. [1.Auflage nicht ermittelt, in deutschen Bibliotheken nicht vorhanden] 791 | Johann Georg Christian Wörle2, Die deutsche Geschichte bis zum Jahre -

Zum Band (PDF)
FORSCHUNGEN ZUR KAISER- UND PAPSTGESCHICHTE DES MITTELALTERS BEIHEFTE ZU J. F. BÖHMER, REGESTA IMPERII 34 HERAUSGEGEBEN VON DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN – REGESTA IMPERII – UND DER DEUTSCHEN KOMMISSION FÜR DIE BEARBEITUNG DER REGESTA IMPERII BEI DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR · MAINZ Heinrich V. in seiner Zeit Herrschen in einem europäischen Reich des Hochmittelalters Herausgegeben von Gerhard Lubich 2013 BÖHLAU VERLAG WIEN · KÖLN · WEIMAR Das Vorhaben Regesta Imperii: „Beiheft-Reihe“ der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur wird im Rahmen des Akademienprogramms von der Bundesrepublik Deutschland und vom Land Hessen gefördert Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. ISBN 978-3-412-21010-6 © 2013 by Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz Alle Rechte einschließlich des Rechts zur Vervielfältigung, zur Einspeisung in elektronische Systeme sowie der Übersetzung vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Akademie und des Verlages unzulässig und strafbar. Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier. Druck: betz-druck GmbH, Darmstadt Printed in Germany Inhalt Vorwort ....................................................................................................... 3 GERHARD LUBICH -

Deutschland Und Der Westen Europas Im Mittelalter
DEUTSCHLAND UND DER WESTEN EUROPAS IM MITTELALTER Herausgegeben von Joachim Ehlers JAN THORBECKE VERLAG STUTTGART 2002 O~j fr") G Die Reform der Christenheit Studium, Bildung und Wissenschaft als bestimmende Kräfte bei der Entstehung des mittelalterlichen Eieropa VON JOACHIM EHURS Die Diskussion wissenschafts- und bildungsgeschichtlicher Aspekte im Zusammenhang mit der Akkulturationsproblematik bedarf keiner eingehenden Begründung, denn jeder Sachkenner hat ein hinreichend deutliches Bild der großen Linien europäischer Bildungs- wege, Resultate, Institutionen, Organisationsformen und gesellschaftlich-politischer Kon- sequenzen vor Augen. Nicht allen aber ist ebenso klar bewußt, auf welch unsicherer und in mancher Hinsicht geradezu pointillistischer Befundlage eine noch wenig homogene For- schung bauen muß, deren Ergebnisse und Hypoehesen das erwähnte Bild bestimmen. Wenn das Stichwort .Reform. hier gewissermaßen als Oberbegriff erscheint, so des- halb, weil damit ein längst erkannter Zusammenhang" adäquat berücksichtigt werden soll und der unabweisbar gebotene Vergleich in einen Rahmen gestellt ist, der die Einstellungen und Urteilskategorien mittelalterlicher Zeitgenossen vielfältig bestimmt hat. Als Grundla- ge für das Erkennen und Verstehen ist diese Perspektive auch für uns nützlich, sofern ne- ben dem universalen Anspruch der Reform immer auch ihre regionalen Bedingtheiten ins Auge gefaSt werden. Die Aufgabe kann demnach nicht sein, einen epochal definierten Ausschnitt der euro- päischen Bildungsgeschichte ins Gedächtnis zu rufen, -

American Osler Society
42nd Annual Meeting of the AMERICAN OSLER SOCIETY Sunday, April 22 - Wednesday, April 25, 2012 The Carolina Inn at The First State University Chapel Hill, North Carolina On the Cover The central picture is of Sir William Osler in his maturity. Surrounding Osler and reflecting his wide impact are images of North Carolina connections to Osler. The upper part of the page presents icons of two major North Carolina educational institutions. On the left is the “Old Well”, serving originally as the main source of water for the few early students of the University of North Carolina-Chapel Hill in 1795, and a symbol of the university. On the right is the famous Duke Chapel, part of the splendid Gothic campus complex of Duke University in Durham. The lower part of the page is devoted to the two main personal relationships between Osler and these two universities. On the left is William deBerniere MacNider MD, who served as a faculty member at the University of North Carolina for 51 years. He spent the summer of 1904 working in the wards and clinics with Sir William in Baltimore. On the right is Wilburt C. Davison MD, first Dean at the Duke University School of Medicine. He knew Osler from his time at Oxford as a Rhodes scholar during World War I. Photo courtesy of Osler Library of the History of Medicine – McGill University Portrait of William Osler, circa 1889-1905 42nd Annual Meeting of the AMERICAN OSLER SOCIETY Sunday, April 22nd - Wednesday, April 25th, 2012 The Carolina Inn at The First State University Chapel Hill, North Carolina Officers and Board of Governors American Osler Society OFFICERS Michael Bliss President Sandra W.