Zeitenwende Beim Kulturellen Gedächtnis?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Widerstand Künstler Im Nationalsozialismus Von Klaus Kösters
25. Jahrgang – 1/2012 erscheint 6x jährlich HER H C EI IS M L A Ä T F B T U S N E D Heimatpflege W - - M R Ü N S T E in Westfalen Künstler im Neubesetzung Per Mausklick Nationalsozialismus im Fachbereich Wandern in die Vergangenheit Der Inhalt auf einen Blick Klaus Kösters neuerScheinungen Anpassung – Überleben – Widerstand 100 Jahre Blitzdorf im flüsseviertel . .34 Künstler im Nationalsozialismus . .1 geschichte selber erforschen . .34 liesborner geschichtshefte – Bäuerliches leben im umfeld der Benediktinerabtei . 35 Auf SchuSterS rAppen „Kulturlandschaft macht Schule“ . .35 Wanderwegezeichner trafen sich in Borghorst . .25 Biologische Vielfalt – ein thema für heimatmuseen . 36 neue personalbesetzung im fachbereich Wandern . .26 Buch über die Bärenwaldeiche in freudenberg-niederholzklau . .36 tAgungS- und VerAnStAltungSBerichte geschichte der westfälischen Vemegerichte . .37 herbsttagung der Ortsheimatpfleger des Kreises höxter . .26 perSönlicheS fachstelle geschichte befasste sich mit dem Kurt ernsting, coesfeld-lette . 38 neu entdeckten römerlager in Olfen . .27 heinz herkenrath, holzwickede . .38 ernst Wulfert, Bad Sassendorf . .39 MuSeen und AuSStellungen der Maler Max-Schulze-Sölde (1887-1967) . .28 BuchBeSprechungen interessengemeinschaft teutoburger Wald e .V . (hrsg .) nAchrichten und nOtizen naturführer teutoburger Wald – zwischen fund und dichtung . pflanzen – tier – fossilien . die Steinzeit in hattingen/ruhr . .29 (heinz-Otto rehage) . .39 Warum es lohnt, die hellebrücke zu erhalten . .30 eine starke dorfjugend . .30 paul Baehr chronik von Bad Oeynhausen . glasmuseum Alter hof herding – (horst-d . Krus) . .40 neuerwerbungen 2011 . 30 per Mausklick in die Vergangenheit . 85 .000 westfälische urkunden im internet . 31 heiMAtKAlender . .40 das Westfälische Wirtschaftsarchiv wurde 70 . .32 heiMAtKunde: Juden – nachbarn – Westfalen . .33 terMine Veranstaltungskalender Heimatpflege in Westfalen iSSn 0933-6346 . -

DGE-Jahresbericht-2011.Pdf
2 011 Jahresbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. IMPRESSUM Jahresbericht 2011 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), Godesberger Allee 18, 53175 Bonn Redaktion: Constanze Schoch, Silke Restemeyer Referat Öffentlichkeitsarbeit, DGE Bildnachweis: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.; © Fotolia.com – Umschlag: Anatoliy Samara (Familie); jacek_kadaj (Labor); Elenathewise (Getreide); S. 20: Jeremias Münch; S. 74: Sven Hoppe; oder wie angegeben Gestaltung und Produktion: emde gestaltung, Stuttgart www.emde-gestaltung.de Mintzel-Druck, Hof Art.-Nr.: 992023 Nachdruck – auch auszugsweise – sowie jede Form der Vervielfältigung oder die Weitergabe mit Zusätzen, Aufdrucken oder Aufklebern nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Herausgeber gestattet. © DGE Bonn, 2012 Wichtige Anmerkung zur Gleichstellung in der Sprachverwendung Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskulinum stehen, wird diese Form verallgemeinernd verwendet und bezieht sich auf beide Geschlechter. Die DGE geht selbstverständlich von einer Gleichstellung von Mann und Frau aus und hat ausschließlich zur besseren und schnelleren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. INHALT Vorwort 4 DIE DGE STELLT SICH VOR Wir über uns 6 Unsere Mitglieder 10 Unser Finanzhaushalt 10 AUS DER ARBEIT DER DGE 1. Medien und Veröffentlichungen der DGE 12 2. Kooperationen 20 3. Projekte und Kampagnen 22 4. Sektionen 34 5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 38 -

Tätigkeitsbericht 2017 1
Tätigkeitsbericht 2017 1 Inhaltsverzeichnis Baden-Württemberg (BL) ...................................... 5 Oldenburger Münsterland ................................. 180 Freiburg .................................................................. 6 Osnabrück .......................................................... 184 Karlsruhe .............................................................. 11 Ostfriesland ........................................................ 187 Konstanz ............................................................... 14 Nordrhein-Westfalen (BL) ................................. 189 Oberschwaben Sitz Ravensburg ........................... 23 Aachen ............................................................... 190 Rhein-Neckar ........................................................ 27 Bielefeld ............................................................. 194 Stuttgart ............................................................... 33 Bonn ................................................................... 199 Bayern (BL)........................................................... 37 Dortmund ........................................................... 202 Augsburg und Schwaben ...................................... 38 Duisburg-Mülheim-Oberhausen ........................ 211 Franken Sitz Nürnberg ......................................... 40 Düsseldorf .......................................................... 214 München .............................................................. 42 Gelsenkirchen ................................................... -

In This Issue Rvolume 59 | Issue 8Eflectorav/Elul 5771 | August 2011 Israel Focus Visiting Richmond Community Since 1975 Israeli Scouts Spread Friendship and Joy
Jewish Community Federation the OF RICHMOND in this issue RVolume 59 | Issue 8eflectorAv/Elul 5771 | August 2011 ISRAEL FOCUS Visiting Richmond Community Since 1975 Israeli Scouts Spread Friendship and Joy ince the summer of 1975, the “Pisgah” Israel Scouts shared their SRichmond community has wel- lives in Israel through song and mu- comed the Israeli Scouts Friendship sic, dance and stories. Each teen is a Nefesh B’Nefesh Caravan. part of the International Scouting Celebrates 10th Eddie Lapkin (OBM) planned Movement, some 60,000 strong. Summer and organized the logistics for the Representing the State of Israel, Israeli Scouts perform for residents and guests at Beth Sholom Home. PAGE 2 first Israeli Scout Caravan visit to they visit camps, schools, festivals, Richmond in 1975. He devoted Jewish community centers, hospitals, the next 27 years of his life to tak- nursing homes and also many public AGENCY NEWS ing care of the Israeli boys and girls gatherings. Since the early 1970’s, along with their American and Is- they have entertained thousands and raeli leaders. thousands from toddlers to those New scouts and leaders have 100 years of age. traveled to Richmond every summer Their performances are com- to entertain, teach about Israel and posed of songs and dances in He- become part of our families with brew and English that bring Israeli their love and devotion because of culture to North America. During Eddie’s love and devotion. He also the show the audience participates was instrumental in securing an Is- in the dances and cheers led by cara- “Burgers for the raeli Scout for Camp Hilbert every van members. -

Holocaust Lesson Plan France & the Holocaust- Survivors' Stories, Paths Through Europe and Genocide
La Shoah- Holocaust Lesson Plan France & the Holocaust- survivors' stories, paths through Europe and Genocide Teacher Name: Josh Schulhoff Collaborators: Greg Metcalf- ITRT & librarians Simon Sibelman- Richmond Holocaust Museum Lesson Title: France & the Holocaust- survivors' stories, paths through Europe and Genocide Target Grade/Subject: FRENCH levels 3, 4, AP Length: 5 classes spread out throughout the year to finish a total unit consisting of the 5 lesson components Summary: In an effort to take the French learning experience away from the walls of the classroom and relate it to the world in which we live, as well as support house bill HB2409 and Virginia Sol's, I venture to expose the French language students to the concepts found in the realm of the Holocaust. The five lessons within this unit take advantage of the 4 modes utilized in a foreign language classroom in order to achieve fluency in the target language. These modes include Reading, Writing, Listening, and Speaking. As this lesson is an ongoing unit being completed second semester of ’10-’11, as exemplars are completed by students, they will be located at this address: http://teachers.henrico.k12.va.us/deeprun/schulhoff_j/h21studentartifacts Essential questions or objectives: Guiding Questions: Lesson 1: What is the effect of tyranny on people? Lesson 2: How do laws affect a people's hate and tolerance? Lesson 4 is a mid unit culmination activity without a specific question. Lesson 3: How do life's experiences mold an individual? Lesson 5: What is the result of perfection? Resources: A copy of the book Yaourtu la tortue by Dr. -

Teaching the Holocaust Nonfiction Resources
TEACHING THE HOLOCAUST NONFICTION RESOURCES This list has been compiled to assist educators in their search for literature to use in teaching the Holocaust to children at all grade levels, K-12. This list is comprehensive but certainly not exhaustive. This research aid contains NONFICTION books whose primary topic is Jewish children who lived during or through the Holocaust. Comprising it is a mixture of literature about Jewish children who did survive the Holocaust and those who did not (most of which are in diary format). Although far fewer in number, books that tell of a person’s life after the War (i.e. in Eretz Israel or the United States) have also been included. Poetry can be found on the fiction resources list. A title’s inclusion herein was based solely upon whatever summary of a book could be found, which has been provided (copied-and-pasted) along with its source (as a website address). The author of this listing made very minor corrections to summaries where needed, including but not limited to: italicizing book titles; changing foreign words (to make spelling uniform throughout); editing for overall mechanics and spelling. Not included in this listing: • Any books whose title suggested appropriateness for inclusion on this list but for which a summary could not be found. • Books whose primary topic is of others (adults or children) who helped Jewish children (to hide, etc.) during the Holocaust or who helped to rescue them. • Books told from the perspective of a non-Jewish child who may have witnessed the mistreatment of Jews or assisted any Jewish person in some way. -

Tätigkeitsbericht 2018 1
Tätigkeitsbericht 2018 1 Inhaltsverzeichnis Baden-Württemberg (BL) ...................................... 5 Osnabrück .......................................................... 184 Freiburg .................................................................. 6 Ostfriesland ........................................................ 187 Heidelberg ............................................................ 11 Nordrhein-Westfalen (BL) ................................. 189 Karlsruhe .............................................................. 14 Aachen ............................................................... 190 Konstanz ............................................................... 18 Bielefeld ............................................................. 196 Oberschwaben Sitz Ravensburg ........................... 28 Bonn ................................................................... 200 Rhein-Neckar ........................................................ 33 Dortmund ........................................................... 203 Stuttgart ............................................................... 39 Duisburg-Mülheim-Oberhausen ........................ 212 Bayern (BL)........................................................... 43 Düsseldorf .......................................................... 215 Augsburg und Schwaben ...................................... 44 Gelsenkirchen .................................................... 221 Bayreuth ............................................................... 46 Hagen und -

Woche Der Brüderlichkeit 2018
Woche der RAHMENPROGRAMM Brüderlichkeit FÜR DAS JAHR 2018: Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Exkursionen Studienreisen, Theater, Vorträge, Filme, etc. 2018 ■ 11. bis 18. März ANGST überwinden – BRÜCKEN bauen IMPRESSUM Herausgeber: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kreis Recklinghausen e.V. Herzogswall 17, 45657 Recklinghausen Telefon 0 23 61 / 50 19 00 www.cjg-re.de E-Mail: [email protected] [email protected] V.i.S.d.P.: Gerda E.H. Koch KD-Bank Dortmund IBAN: DE16 3506 0190 2121 4740 10 BIC: GENODED1DKD Layout: Volker Koehn Druckerei Peters Schulstraße 17, 45665 Recklinghausen INHALT ■ AUSSTELLUNGEN Vorwort 4 Grußworte 5-12 ■ EXKURSIONEN Zentrale Eröffnungsveranstaltungen 13-34 Woche der Brüderlichkeit 2018 ■ FEIERN Rahmenprogramm 35-124 Spende oder Mitgliedschaft 125 ■ GEDENKEN Inhaltsverzeichnis 127-130 ■ GRUSSWORTE Bitte beachten: ■ LESUNGEN Programmänderungen vorbehalten www.cjg-re.de ■ KINO ■ KONZERTE ■ SEMINARE ■ THEATER ■ VORTRÄGE ■ WOCHE DER BRÜDERLICHKEIT VORWORT Vorwort der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kreis Recklinghausen e.V. Das vielfältige Programm, das wir Ihnen hiermit vorlegen, ist ein von links nach rechts, vordere Reihe: Christl Lewin (jüd. Vors.), Gisela Möhnke, Gerda E.H. Koch (ev. Vors.), Dr. Martina Leufert. Hintere Reihe: Ulrich Hempel (kath. Vors.), Herbert Spiegel unserer langjährigen Aktivitäten, Schwerpunkte und Ko- Hehemann, Peter Kitzol-Kohn, Pfr. Roland Wanke, Jörg Schürmann, Gregor Kortenjann operationen. Die Arbeit unserer Gesellschaft erstreckt sich über den gesamten Kreis Recklinghausen mit insgesamt zehn Städten. ten wie das Kennenlernen jüdischer Geschichte in Deutschland, Die Möglichkeit zur Beteiligung am Rahmenprogramm fand Europa und Israel. Erinnern und Gedenken z.B. durch Gedenk- schnell ein großes Echo bei städtischen und kirchlichen Einrich- veranstaltungen und Publikationen sind darüber hinaus ein tungen, bei jüdischen Gemeinden sowie bei Schulen im Kreis wichtiger Teil unserer Arbeit. -
The Virginia Holocaust Museum Newsletter Volume 17, Number 1 June 2016
The Virginia Holocaust Museum Newsletter Volume 17, Number 1 June 2016 Charles Coulomb Announced as New Interim Director PG 6 | VHM Rejoins the Jewish Federation PG 10 From Farms to Family Files PG 12 | Deadly Medicine Exhibit PG 14 New Partnership with Longwood University for T.E.I PG 16 | VHM Awarded Grant from Cabell Foundation PG 18 And All Other VHM Updates PG 6 Contents Welcome 5 Visitation Updates 5 DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM, BERLIN DEUTSCHES HISTORISCHES Charles Coulomb: New Interim Director 6 Re-visioning Core Exhibits 8 PG 18 VHM Rejoins JCFR 10 Events Recap 10 ANTHROPOLOGICAL CALIPERS. CALIPERS. ANTHROPOLOGICAL Countries at Risk for Genocide 11 Alive in the Killing Fields: Book Spotlight 11 From Farms to Family Files 12 Deadly Medicine: Creating the Master Race 14 LONGWOOD New Direction for TEI 16 UNIVERSITY Cabell Foundation Awards VHM a Grant 18 PG 16 Halina Zimm: Honoring Her Parents 20 Through Her Story Volunteer Spotlight: Murray Carton 21 PG 10 Penny Campaign Updates 21 A provocative exhibition Student Art Contest Winners 22 exploring the Nazi regime’s “science of race” and its implications for medical ethics and social responsibility today PG 12 What is a Malyene? June 6th–October 2nd, 2016 PG 14 In Yiddish, “de malyene” means a on view at the Virginia Holocaust Museum raspberry bush, but in the slang of Read more about the exhibit on Page 14 Eastern European Jews, it also meant “a hiding place.” “De malyene” is where you would protect your most precious PRESENTED BY PRODUCED BY SPONSORED BY valuables–gold, jewels, a small child or yourself. -

Dschule, Dresden • 6
47.Grundschule, Dresden • 6. Integrierte Sekundarschule Spandau, Berlin • 82. Grundschule Dresden \“Am Königswald\“, Dresden A A.v.Rantzau Gemeinschaftsschule/ Internat Schloss Rohlstorf, Rohlstorf • Abendrealschule Lahr, Rust • Abendrealschule Offenburg, Rust • Abendrealschule Remscheid, Remscheid • Abenteuer Lernen e.V., Bonn • Abtei-Gymnasium-Brauweiler, Pulheim-Brauweiler • Achental-Realschule, Marquartstein • act for transformation, gem.eG, Aalen • Adalbert-Stifter-Gymnasium, Castrop-Rauxel • Adolf Weber Gymnasium, München • Adolf-Clarenbach-Grundschule, Heiligenhaus • Adolf-Reichwein-Schule-Schloss Pretzsch, Pretzsch • Adolph-Diesterweg-Schule, Hamburg • ADS Gerd Lausen Haus, Sylt-Rantum • Agenda 21 - Lüneburg e.V., Lüneburg • Agenda 21-Koordinationsbüro GRÜNE LIGA Thüringen e.V., Suhl • Agendabüro, Umwelt- und Arbeitsschutz, Karlsruhe • Agenda-Büro. Amt für Umweltschutz, Heidelberg • Aggertal-Gymnasium, Engelskirchen • Ahornschule Großropperhausen, Frielendorf-Großropperhausen • Aktive Naturschule Templin, Templin • Albert-Einstein-Gymnasium München, München • Albert-Einstein-Schule, Remscheid • Albert-Schweitzer Duale Oberschule Koblenz, Koblenz • Albert-Schweitzer Grundschule Lehrte, Lehrte • Albert-Schweitzer-Gymnasium, Marl • Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hürth • Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hamburg • Albert-Schweitzer-Hauptschule Gundelfingen, Gundelfingen • Albert-Schweitzer-Schule, Bocholt • Albert-Schweitzer-Schule, Ahlen • Albert-Schweitzer-Schule Nienburg, Nienburg • Albertus-Magnus-Gymnasium, St. Ingbert • Albertus-Magnus-Schule, -
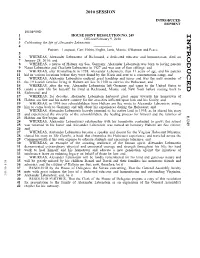
Introduced Reprint
2010 SESSION INTRODUCED REPRINT 10104909D INTRODUCED 1 HOUSE JOINT RESOLUTION NO. 249 2 Offered February 9, 2010 3 Celebrating the life of Alexander Lebenstein. 4 ±±±±±±±±±± Patrons±±Loupassi, Carr, Ebbin, Englin, Janis, Massie, O©Bannon and Peace 5 ±±±±±±±±±± 6 WHEREAS, Alexander Lebenstein of Richmond, a dedicated educator and humanitarian, died on 7 January 28, 2010; and 8 WHEREAS, a native of Haltern am See, Germany, Alexander Lebenstein was born to loving parents 9 Natan Lebenstein and Charlotte Lebenstein in 1927 and was one of four siblings; and 10 WHEREAS, after Kristallnacht in 1938, Alexander Lebenstein, then 11 years of age, and his parents 11 hid in various locations before they were found by the Nazis and sent to a concentration camp; and 12 WHEREAS, Alexander Lebenstein endured great hardship and terror and was the only member of 13 the 19 Jewish families living in Haltern am See in 1938 to survive the Holocaust; and 14 WHEREAS, after the war, Alexander Lebenstein left Germany and came to the United States to 15 create a new life for himself; he lived in Richmond, Miami, and New York before coming back to 16 Richmond; and 17 WHEREAS, for decades, Alexander Lebenstein harbored great anger towards his hometown of 18 Haltern am See and his native country for the atrocities inflicted upon him and his family; and 19 WHEREAS, in 1994 two schoolchildren from Haltern am See wrote to Alexander Lebenstein, asking 20 him to come back to Germany and talk about his experiences during the Holocaust; and 21 WHEREAS, Alexander Lebenstein