Siedlungen Im Kanton Zürich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
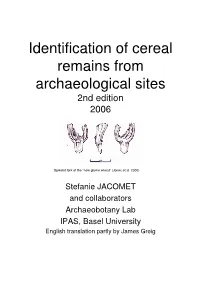
Identification of Cereal Remains from Archaeological Sites 2Nd Edition 2006
Identification of cereal remains from archaeological sites 2nd edition 2006 Spikelet fork of the “new glume wheat” (Jones et al. 2000) Stefanie JACOMET and collaborators Archaeobotany Lab IPAS, Basel University English translation partly by James Greig CEREALS: CEREALIA Fam. Poaceae /Gramineae (Grasses) Systematics and Taxonomy All cereal species belong botanically (taxonomically) to the large family of the Gramineae (Poaceae). This is one of the largest Angiosperm families with >10 000 different species. In the following the systematics for some of the most imporant taxa is shown: class: Monocotyledoneae order: Poales familiy: Poaceae (= Gramineae) (Süssgräser) subfamily: Pooideae Tribus: Triticeae Subtribus: Triticinae genera: Triticum (Weizen, wheat); Aegilops ; Hordeum (Gerste; barley); Elymus; Hordelymus; Agropyron; Secale (Roggen, rye) Note : Avena and the millets belong to other Tribus. The identification of prehistoric cereal remains assumes understanding of different subject areas in botany. These are mainly morphology and anatomy, but also phylogeny and evolution (and today, also genetics). Since most of the cereal species are treated as domesticated plants, many different forms such as subspecies, varieties, and forms appear inside the genus and species (see table below). In domesticates the taxonomical category of variety is also called “sort” (lat. cultivar, abbreviated: cv.). This refers to a variety which evolved through breeding. Cultivar is the lowest taxonomic rank in the domesticated plants. Occasionally, cultivars are also called races: e.g. landraces evolved through genetic isolation, under local environmental conditions whereas „high-breed-races“ were breed by strong selection of humans. Anyhow: The morphological delimitation of cultivars is difficult, sometimes even impossible. It needs great experience and very detailed morphological knowledge. -

Zur Waldgeschichte Im Unteren Zürichseegebiet Während Des
Bauhinia 6/1 (1977) 61—81 Zur Waldgeschichte im unteren Zürichseegebiet während des Neolithikums und der Bronzezeit Ergebnisse pollenanalytischer Untersuchungen Von Annekäthi Heitz-Weniger, Basel Manuskript eingegangen am 25. 3. 1977 1. Einleitung Im Rahmen eines vom Büro für Archäologie der Stadt Zürich unter der Lei tung von Dr. U. R u o f f *) unternommenen Projektes wurden an neolithischen und spätbronzezeitlichen Siedlungsplätzen im untersten Zürichsee pollenanalyti sche Untersuchungen durchgeführt. Im vorliegenden Beitrag, der Bestandteil die ser, als Dissertation am Botanischen Institut Basel unter der Leitung von Prof. Dr. H. Zoller *) durchgeführten Arbeit ist (Heitz-Weniger 1976, in Vor her.), soll nur ein Themenkreis behandelt werden: Die Waldvegetation, wie sie zur Zeit der prähistorischen Besiedlung am unteren Zürichsee bestand. Gerade auch für zahlreiche siedlungsgeschichtliche Probleme ist es wichtig, in welchen Wald gesellschaften die. Siedler ihre Nahrung und ihre Rohmaterialien beschaffen muss ten. Aufgrund der -vorliegenden palynologischen Untersuchungen und einiger pflanzensoziologischer und ökologischer Überlegungen ist es möglich, die damali gen Wälder zu beschreiben. Die Ergebnisse bezüglich der Krautvegetation des Ufers und bezüglich der Veränderung der Vegetation durch die Siedler, wie auch die Diskussion der speziellen Ufersiedlungsprobleme, die Begründung der Zeitstel lung der Diagramme und die Erläuterung der Methode bleibt andern Publikatio nen Vorbehalten (Heitz-Weniger 1976, Heitz-Weniger, in Vor her.). 2. Voraussetzungen 2.1 Vereinfachtes Durchschnitts-Pollendiagramm Die Grundlage für die in Kap. 3 versuchte Beschreibung .der Waldvegetation in prähistorischer Zeit am unteren Zürichsee liefern die Pollendiagramme des Hauptteils der genannten Arbeit (Heitz-Weniger, in Vorher.). Es sind *) Herrn Prof. Zoller und Herrn Dr. Ruoff sei an dieser Stelle herzlich gedankt. -

Prehistoric Pile Dwellings Around the Alps
Prehistoric Pile Dwellings around the Alps World Heritage nomination Switzerland, Austria, France, Germany, Italy, Slovenia Executive Summary Volume I 2 – Executive Summary Volume I Executive Summary Countries Switzerland (CH) Austria (AT) France (FR) Germany (DE) Italy (IT) Slovenia (SI) State, Province or Region Switzerland Cantons of Aargau (AG), Berne (BE), Fribourg (FR), Geneva (GE), Lucerne (LU), NeucHâtel (NE), Nidwalden (NW), ScHaffHausen (SH), ScHwyz (SZ), SolotHurn (SO), St. Gall (SG), THurgau (TG), Vaud (VD), Zug (ZG), Zurich (ZH). Austria — Federal state of CarintHia (Kärnten, KT): administrative district (Verwaltungsbezirk) of Klagenfurt-Land; — Federal state of Upper Austria (OberösterreicH, OÖ): administrative district (Verwaltungsbezirk) of Vöcklabruck. France — Region of RHône-Alpes: Départements of Savoie (73), Haute-Savoie (74); — Region of Franche-Comté: Département of Jura (39). Germany — Federal state of Baden-Württemberg (BW): administrative districts (Landkreise) of Alb-Donau-Kreis (UL), BiberacH (BC), Bodenseekreis (FN), Konstanz (KN), Ravensburg (RV); — Free State of Bavaria (BY): administrative districts (Landkreise) of Landsberg am Lech (LL); Starnberg (STA). 3 Volume I Italy — Region of Friuli Venezia Giulia (FV): Province of Pordenone (PN); — Region of Lombardy (LM): Provinces of Varese (VA), Brescia (BS), Mantua (MN), Cremona (CR); — Region of Piedmont (PM): Provinces of Biella (BI), Torino (TO); — Trentino-South Tyrol / Autonomous Province of Trento (TN); — Region of Veneto (VN): Provinces of Verona (VR), Padua (PD). Slovenia Municipality of Ig Name of Property PreHistoric Pile Dwellings around the Alps Sites palafittiques préHistoriques autour des Alpes Geographical coordinates to the nearest second The geograpHical coordinates to the nearest second are sHown in ÿ Figs. 0.1–0.6 . Switzerland Component Municipality Place name Coordinates of Centre Points UTM Comp. -

Zurich-Alpenquai: a Multidisciplinary Approach to the Chronological Development of a Late Bronze Age Lakeside Settlement in the Northern Circum-Alpine Region
Journal of Wetland Archaeology 12, 2012, 58–85 Zurich-Alpenquai: a multidisciplinary approach to the chronological development of a Late Bronze Age lakeside settlement in the northern Circum-Alpine Region Philipp Wiemann, Marlu Kühn, Annekäthi Heitz-Weniger, Barbara Stopp, Benjamin Jennings, Philippe Rentzel and Francesco Menotti Abstract The Alpenquai lake-dwelling is located on Lake Zurich, and can be considered as one of the rare Late Bronze Age lake-dwellings with a pronounced organic-rich cultural layer in the northern Circum-Alpine region. Within a larger research project, investigating the final abandonment of the lakeshores in the Circum-Alpine area at the end of the Late Bronze Age, this settlement has been investigated using a multidisciplinary research design. Combining micromorphology, archaeobotany, palynology, archaeozoology and material culture studies, the formation of the site is reconstructed, and the reasons for its final abandonment are sought. A highly dynamic lake system that caused a lake water level rise before 900 BC, a regression in the second half of the 9th century BC, and a later transgression, could be detected. The settlement appears to have been established during the lake regression, and abandoned during the transgression, proving a high degree of environmental adaptation by its inhabitants. Keywords: lake-dwellings, Switzerland, Bronze Age, multidisciplinary approach, site formation, abandonment Authors’ addresses: Philipp Wiemann, Marlu Kühn, Annekäthi Heitz-Weniger, Barbara Stopp, Benjamin Jennings, Philippe Rentzel and Francesco Menotti Institute of Prehistory and Archaeological Science (IPAS), University of Basel, Spalenring 145, 4055, Basel, Switzerland. Email: [email protected] Zurich-Alpenquai 59 Introduction The 3500-year long lake-dwelling tradition of the Circum-Alpine lakes cannot be seen as a continuous event. -

Zug-Riedmatt (Canton of Zug, Switzerland) – a Key to Chronology and Metallurgy in the Second Half of the Fourth Millennium BC
The copper axe blade of Zug-Riedmatt (Canton of Zug, Switzerland) – a key to chronology and metallurgy in the second half of the fourth millennium BC Eda Gross, Gishan Schaeren & Igor Maria Villa Abstract - The copper axe blade discovered in the pile dwelling site of Zug-Riedmatt is one of the few Neolithic copper axe blades in Eu- rope that can be dated with certainty. The blade’s form and its metal composition suggest that it is connected both to the south – more specifically to Copper Age cultures in northern Italy and southern Tuscany – and to the copper axe of the famous ice mummy of Tisenjoch (called ‘the Iceman’ or ‘Ötzi’). We were able to confirm this connection to the south by measuring the lead isotope composition of the blade, which traces the blade’s origin to Southern Tuscany. Due to these links to the south, the copper axe blade of Zug-Riedmatt can be de- scribed as a key to understanding Neolithic metallurgy north of the Alps in the second half of the fourth millennium BC. As the classification of the blade will have far-reaching consequences in regard to chronology and cultural history, we have decided to make the results of our analyses available as quickly as possible – even if this means that for now we can only discuss some basic results and assumptions about the blade’s context. Key words – archaeology; Circum-Alpine region; chalcolithic; pile dwelling; copper axe; metallurgy; lead isotopes; LA-ICP-MS; MC-ICP- MS; Horgen; Remedello; Rinaldone; Tuscany; Iceman Titel - Die Kupferbeilklinge von Zug-Riedmatt, Kanton Zug, Schweiz ‒ ein Schlüsselfund zu Chronologie und Metallurgie der zweiten Hälfte des 4. -

Clinical Microbiology and Immunology
4th International Conference on Clinical Microbiology and Immunology October 13-14, 2021 Zurich, Switzerland Hosting Organization: Pulsus Group 35 Ruddlesway, Windsor, Berkshire, SL4 5SF, United Kingdom Tel: +44-203-769-1778 [email protected] Invitation It is an immense delight to extend our warm welcome to the event “4th International Conference on Clinical Microbiology and Immunology”, which includes Keynote Address, Oral Lectures, Poster Presentations, Exhibitions, Workshops, Young Research Forum and more on October 13-14, 2021 in Zurich, Switzerland. The conference is organised around the topic “Recent Researches and advancements in Clinical Microbiology and Immunology”. Clinical Microbiology 2021 shares an insight into recent findings and cutting-edge innovations by improving and expanding the recent researches in clinical trials. The key aim of Clinical Microbiology 2021 is to put together a multi-disciplinary community of experts and experts from around the world to discuss and share break-through ideas on Clinical Microbiology and Immunology. It promotes top-level analysis and to globalise the quality research in general, while making discussions, presentations more globally competitive and attracting emphasis on the recent excellent accomplishments in the field of Microbiology, and future developments and needs. Microbiology Conference 2021 featured a slew of world-class speakers who shared their expertise and confabulated on a variety of cutting-edge topics in the field of microbiology. The experts who promoted -

Studying Habitats and Dynamical Interaction in Neolithic Europe Through the Material Culture of Pile Dwellings
Estudos do Quaternário, 11, APEQ, Braga, 2014, pp. 39-44 http://www.apeq.pt/ojs/index.php/apeq. STUDYING HABITATS AND DYNAMICAL INTERACTION IN NEOLITHIC EUROPE THROUGH THE MATERIAL CULTURE OF PILE DWELLINGS J. VERDONKSCHOT (1) Abstract: The Early Neolithic in Europe is one of the most dynamic and significant periods of prehistory. However, there are still many questions waiting to be answered. Pile dwellings can shed a light on this case as these sites and their material have been preserved exceptionally well due to the humid conditions of their location. Besides from this global aim they also offer the possibility of comparing several settlements extensively, including data such as architecture, tools and diet as well as the more traditional ceramic remains. This article proposes a line of investigation in which several Case Studies from different areas (the Alps, Northern Spain and Central Italy) are studied. These Case Studies consist of a specific area, including a lakeside settlement that forms the basis, and nearby contemporaneous sites. The areas are assessed based on the found archaeological record and in terms of their social organization and connections. Secondly, the dynamic relations between said areas are addressed in order to study connectivity and contact in Early Neolithic Europe. Above all this study promotes a different way of investigating, abandoning the single-site perspective, no longer looking exclusively for differences but adopting a slightly different vision and linking different sites and places. Keywords: Early Neolithic, Pile dwellings, Habitats, Interaction Resumen: Estudiando hábitats y interacción dinámica en el neolítico europeo a través de la cultura material de los palafitos El neolitico antiguo de Europa es uno de los momentos más dinámicos y significativos de la prehistoria, sin embargo todavía quedan muchas preguntas. -

ARCHÄOLOGIE IM KANTON ZÜRICH – KURZBERICHTE ZU DEN PROJEKTEN 2015 Bei Den Mit Einem Stern (*) Versehenen Einträgen Handelt Es Sich Um Negativbefunde
ARCHÄOLOGIE IM KANTON ZÜRICH – KURZBERICHTE ZU DEN PROJEKTEN 2015 Bei den mit einem Stern (*) versehenen Einträgen handelt es sich um Negativbefunde. AESCH abgesucht. Leider war zu diesem Zeitpunkt ein grosser Teil des Grabens bereits wieder verfüllt. Wo er noch CHILEGÄSSLI 8 offen stand, zeigt das Profil keine Kulturschicht. Auch im Koord. 675530/243260; Höhe 552 Aushubmaterial fehlten Hinweise auf eine abgetragene Spätmittelalterlich-neuzeitliche Gräber Kulturschicht. Die Stelle, an der die Keramik bzw. die Aushubbegleitung 2015.113; 01.06.2015 Kulturschicht gesichtet wurde, muss sich demnach im Verantwortlich: Fridolin Mächler, Werner Wild bereits wieder verfüllten, südlichen Bereich des Leitungs- grabens befunden haben. M. Kobler, Architekt in Dietikon, meldete den Fund von menschlichen Knochen in der Baugrube für ein Einfa- milienhaus, das nördlich der Flur Heligenmatt anstelle AFFOLTERN AM ALBIS eines landwirtschaftlichen Gebäudes errichtet werden soll. Von der angeschnittenen Bestattung wurden ein GANETEN, BISLIKEN Femur, eine Tibia sowie Finger- und Mittelhandknochen Koord. 677721/237635; Höhe 620 eines erwachsenen Individuums geborgen. Das Skelett Steinkreis unbekannter Zeitstellung war geostet und befand sich 1 m unter der aktuellen Prospektion 2015.140; 25.06.2015 Bodenoberfläche. Das Grab gehört zu einer Kapelle mit Verantwortlich: Roland Sojka Friedhof, deren genaue Lage trotz der 2014 wegen der geplanten Überbauung der Heiligenmatt durchgeführ- Im Bislikerhau befindet sich auf einer leicht erhöhten ten Sondierungen unbekannt blieb. Die Kapelle wurde Waldlichtung ein auffallender Steinkreis (Befundmel- 1360/70 und 1375 schriftlich erwähnt und ist auf der dung durch Sibylle Späni-Büchi). Die Fundstelle wurde Gyger-Karte von 1667 eingezeichnet. Spätestens vor im Hinblick auf die Frage prospektiert, ob es sich um 1807 erfolgte der Abbruch. -

Verkehr Und Innovation
Verkehr und Innovation Autor(en): Primas, Margarita Objekttyp: Article Zeitschrift: Archäologie der Schweiz = Archéologie suisse = Archeologia svizzera Band (Jahr): 13 (1990) Heft 2: Kanton Zürich PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-11647 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Verkehr und Innovation Margarita Primas Dynamische Vorgänge wie Verkehr, Handel, Um einen Existenznachweis prähistorischen Technologietransfer oder Krieg werden Handels zu führen, wurden mit in der archäologischen Literatur eher wachsender Akribie zwei methodische selten abgehandelt; es dominieren die Zu- Wege beschritten: die Auswertung von D standsanalysen einzelner Siedlungsphasen, Verbreitungskarten und die Rohstoffanalyse, ganzer Regionen oder Zeitabschnitte. -

Swiss Plateau): New Interdisciplinary Insights in Neolithic Settlement, Land Use and Vegetation Dynamics 10
Archaeological and palaeoecological investigations at Burgäschisee (Swiss Plateau): new interdisciplinary insights in Neolithic settlement, land use and vegetation dynamics 10 Albert Hafner1,2, Fabian Rey2,3,4, Marco Hostettler1,2, Julian Laabs1,2, Matthias Bolliger5, Christoph Brombacher6, John Francuz1, Erika Gobet2,3, Simone Häberle6, Philippe Rentzel6, Marguerita Schäfer6, Jörg Schibler6, Othmar Wey1,2, Willy Tinner2,3 Introduction 1 – Institute of Archaeological Sciences, University of Bern, Switzerland 2 – Oeschger Centre for Climate The prehistoric lake dwellings of Switzerland, Germany, and Austria have Change Research, University of been known for more than 150 years. Of these, 111 were awarded UN- Bern, Switzerland ESCO World Cultural Heritage status in 2011. Mainly dating from the Neo- 3 – Institute of Plant Sciences, University of Bern, Switzerland lithic (including the Chalcolithic or Copper Age) and the Bronze Age, la- 4 – Geoecology, Department of custrine settlements represent an early phase of sedentarisation in the Environmental Sciences, University northern foothills of the Alps. Despite much significant research on the of Basel, Switzerland 5 – Archaeological Service of the material culture, settlement dynamics, economy, and ecology, the focus Canton of Bern, Underwater has hitherto almost exclusively been on the classic sites situated on the Archaeology and Dendrochronology, Sutz-Lattrigen, larger northern pre-Alpine lakes in the so-called Three Lakes region of Switzerland western Switzerland and on the Lakes of Geneva, Zurich, and Constance. 6 – Institute for Integrative Prehistory The international and interdisciplinary research project ’Beyond lake vil- and Archaeological Science, University of Basel, Switzerland lages: studying Neolithic environmental changes and human impact on small lakes in Switzerland, Germany and Austria’ was launched in 2015 Figure 1: Areas examined as part of the interdisciplinary project entitled ’Beyond lake villages’ in the Alpine region. -

Settling Waterscapes in Europe. the Archaeology of Neolithic and Bronze Age Pile-Dwellings
et al. (eds.) et Hafner Albert Hafner, Ekaterina Dolbunova, Andrey Mazurkevich, Elena Pranckenaite, Martin Hinz (eds.) Settling Waterscapes in Europe in Waterscapes Settling Settling Waterscapes in Europe in Europe Waterscapes Settling Pile dwellings have been explored over a vast The volume thus provides a current insight region for a number of decades now. This has into international research into life in and ar- led to the development of different ways, me- ound a vast array of prehistoric waterscapes. thods, and even schools of underwater and Extensive multidisciplinary research carried peat-bog excavation practices and data ana- out in recent years has provided new data with lysis techniques under the influence of differ- regard to the anthropogenic influence on the ent research traditions in individual countries. landscapes around Neolithic and Bronze Age These and other factors can limit our under- pile dwellings, which allows us to characterise standing of the past, whilst on the other hand in more detail the lifestyles of the settlements’ they can also open up further avenues of inter- inhabitants, the peculiarities of the ecological pretation. niche and the interaction between humans and their environment. The volume also contains By collecting the papers presented at the 2016 various case studies that demonstrate the im- session of the EAA in Vilnius, this book aims to portance of scientific analysis for the study of take this diversity as an opportunity. The geo- settlement between land and water. graphical scope extends from the Baltic to Russia, Belarus, Albania, North Macedonia, Bul- Overall, the volume presents an important new garia, Bosnia, Coratia, Greece, Germany, Austria body of data and international perspectives on and Switzerland to France. -

Mobilities, Entanglements and Transformations in Neolithic Societies of the Swiss Plateau (3900 – 3500 BC)
Bern Working Papers on Prehistoric Archaeolog y No. 1 Institute of Archaeological Sciences Prehistory Albert Hafner Caroline Heitz Regine Stapfer March 2016 Mobilities, Entanglements, Transformations. Outline of a Research Project on Pottery Pratices in Neolithic Wetland Sites of the Swiss Plateau Project’s Title: Mobilities, Entanglements and Transformations in Neolithic Societies of the Swiss Plateau (3900 – 3500 BC) Funding: Swiss National Science Foundation Project No 100011_156205 Project management: Prof. Dr. Albert Hafner Institute of Archaeological Sciences Prehistory University of Bern Switzerland Project management: Prof. Dr. Vincent Serneels Department of Geosciences Section of Earth Sciences, Archaeometry University of Fribourg Switzerland Impressum Series ISSN: 2297- 8607 e-ISBN: 978-3-906813-12-7 (e-print) DOI: 10.7892/boris.77649 Editors: Albert Hafner and Caroline Heitz Institute of Archaeological Sciences, Prehistory University of Bern Muesmattstrasse 27 CH-3012 Bern This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Inter- national License English language editing: Andrew Lawrence, Sharon Shellock, Ariane Ballmer Layout: Designer FH in Visual Communication Susanna Kaufmann Photographs (front page): Today’s shore of Lake Neuchâtel, Pfyn and Michelsberg pottery from the Neolithic bog settlement of 2 Thayngen-Weier, Northern Switzerland (Caroline Heitz). Table of Contents 1. Aims and research questions 4 2. State of research 5 3. Case studies 10 4. Mixed methods research-design 13 5. Some words on applied methods