Groeschel Antike.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Princesse De Polignac Violin
The Princesse de Polignac violin Nicholas Sackman © 2021 This short research article does not claim to present the definitive history of the 1690 Antonio Stradivari violin – there are too many unanswerable questions – but it does provide more authoritative information than has been available previously. ***** Description written by Charles-Nicolas-Eugène Gand (Paris violin dealer) of a 1690 Stradivari violin which, in 1871, belonged to Madame la princesse de Polignac:1 (année 1871) M me la princesse de Polignac, Paris Violon Stradivarius, 13 pouces 4 lignes, année 1690 (l’étiquette porte 1699, mais le dernier chiffre est refait) Fond d’une pièce, belles veines larges remontant à droite, belles éclisses, celle du C gauche côté de la barre et celle du bas près du bouton côté droit ont des petites marques de trous de vers, table de 2 pièces, sapin très-serré, cassures à l’âme, dont une descendant jusqu’en bas, deux petites fentes à côté du sillet sous le menton, belle tête cassée au dessus de la cheville du La. Beau vernis rouge brun doré. acheté par Hill en 1921: ooxzx. (1871) Madame la princesse de Polignac, Paris Antonio Stradivari violin, 13 pouces 4 lignes [360.9mm],2 year 1690 (the label shows 1699 but the last numeral [has been] re-made) [?by adding a lower ‘tail’ to the original ‘0’] The back plate is in one piece; beautiful wide flames rising to the right. Beautiful ribs; the rib of the left-side C, on the bass-bar side, and the rib at the bottom, at the end pin, on the treble side – both have small marks of worm tracks. -

Ann-Kathrin Deininger and Jasmin Leuchtenberg
STRATEGIC IMAGINATIONS Women and the Gender of Sovereignty in European Culture STRATEGIC IMAGINATIONS WOMEN AND THE GENDER OF SOVEREIGNTY IN EUROPEAN CULTURE EDITED BY ANKE GILLEIR AND AUDE DEFURNE Leuven University Press This book was published with the support of KU Leuven Fund for Fair Open Access Published in 2020 by Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain / Universitaire Pers Leuven. Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium). Selection and editorial matter © Anke Gilleir and Aude Defurne, 2020 Individual chapters © The respective authors, 2020 This book is published under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivative 4.0 Licence. Attribution should include the following information: Anke Gilleir and Aude Defurne (eds.), Strategic Imaginations: Women and the Gender of Sovereignty in European Culture. Leuven, Leuven University Press. (CC BY-NC-ND 4.0) ISBN 978 94 6270 247 9 (Paperback) ISBN 978 94 6166 350 4 (ePDF) ISBN 978 94 6166 351 1 (ePUB) https://doi.org/10.11116/9789461663504 D/2020/1869/55 NUR: 694 Layout: Coco Bookmedia, Amersfoort Cover design: Daniel Benneworth-Gray Cover illustration: Marcel Dzama The queen [La reina], 2011 Polyester resin, fiberglass, plaster, steel, and motor 104 1/2 x 38 inches 265.4 x 96.5 cm © Marcel Dzama. Courtesy the artist and David Zwirner TABLE OF CONTENTS ON GENDER, SOVEREIGNTY AND IMAGINATION 7 An Introduction Anke Gilleir PART 1: REPRESENTATIONS OF FEMALE SOVEREIGNTY 27 CAMILLA AND CANDACIS 29 Literary Imaginations of Female Sovereignty in German Romances -

Censorship and Information Control – Item List September 17 Through December 14, 2018
Censorship and Information Control – Item List September 17 through December 14, 2018 Intro Case Papyri Fragment Iliad [150 CE-199CE] Ms. 1063 Mark Twain (1835-1910) The Adventures of Huckleberry Fin (Tom Sawyer’s Comrade) London: Chatto & Windus, 1884 PS1305.A1 1884 Rare 69604608 George Orwell (1903-1950) 1984: A Novel London: Secker & Warburg, 1949 PR6029.R9N7 1949a c. 2 Rare 109757590 Francis Blackburne Remarks on Johnson’s Life of Milton. To which are added Milton's Tractate of Edvcation and Areopagities. London: s.n., 1780 PR3581.J7 Rare 087898905 Tohō Akam Kinshibon Shomoku Kyoto, Japan: Akama Kōbundō, Shōwa 2 [1927] J9652 4742 Harvard Yenching/CJK 106460568 Nat Hentoff The Day They Came to Arrest the Book New York: Dell Laurel-Leaf, 1982 On loan from Ada Palmer George Orwell (1903-1950) Nineteen Eighty-Four New York: Penguin, 2002 On loan from Ada Palmer Index Librorum Prohibitorum: SS.MI D. N. PP. XII Italy: Typis Polyglottis Vaticanis, 1948 Gift of Walter Kaegi Index Librorum Prohibitorum: SS.MI D. N. PII. PP. XI Vatican City: Typis Polyglottis Vaticanis, 1938 On loan from Ada Palmer Savonarola Tabule Sopra le Prediche del Reveredo Venice: Bernardino Benali, 1517 On loan from Ada Palmer Plato The Republic New York: The Limited Editions Club, 1944 JC71.P350 1944 v.1 Rare 45688686 Jay Asher Thirteen Reasons Why New York: Razorbill, 2007 Gift of Ada Palmer Newspaper article (reproduction) The Chicago Maroon October 5, 1951 Newspaper article (reproduction) “Ousted Editor Blasts Chicago for Dismissal” Columbia Spectator Volume XCVI, N. 43 December 4, 1951 Newspaper article (reproduction) “Misc. -
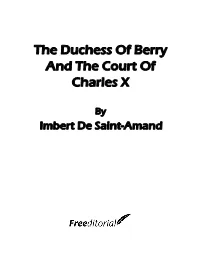
The Duchess of Berry and the Court of Charles X
The Duchess Of Berry And The Court Of Charles X By Imbert De Saint-Amand THE DUCHESS OF BERRY AND THE COURT OF CHARLES X I THE ACCESSION OF CHARLES X Thursday, the 16th of September, 1824, at the moment when Louis XVIII. was breathing his last in his chamber of the Chateau des Tuileries, the courtiers were gathered in the Gallery of Diana. It was four o'clock in the morning. The Duke and the Duchess of Angouleme, the Duchess of Berry, the Duke and the Duchess of Orleans, the Bishop of Hermopolis, and the physicians were in the chamber of the dying man. When the King had given up the ghost, the Duke of Angouleme, who became Dauphin, threw himself at the feet of his father, who became King, and kissed his hand with respectful tenderness. The princes and princesses followed this example, and he who bore thenceforward the title of Charles X., sobbing, embraced them all. They knelt about the bed. The De Profundis was recited. Then the new King sprinkled holy water on the body of his brother and kissed the icy hand. An instant later M. de Blacas, opening the door of the Gallery of Diana, called out: "Gentlemen, the King!" And Charles X. appeared. Let us listen to the Duchess of Orleans. "At these words, in the twinkling of an eye, all the crowd of courtiers deserted the Gallery to surround and follow the new King. It was like a torrent. We were borne along by it, and only at the door of the Hall of the Throne, my husband bethought himself that we no longer had aught to do there. -

Bacchus and Ariadne Oil on Canvas Laid on Board 110.5 X 142 Cm (43½ X 55⅞ In)
Carle van Loo (Nice 1705 - Paris 1765) Bacchus and Ariadne oil on canvas laid on board 110.5 x 142 cm (43½ x 55⅞ in) This fine example of Carle van Loo’s early work was painted in Turin c. 1732-1734. It depicts the famous mythological story of the god Bacchus falling in love with the Greek princess Ariadne. According to the myth, Ariadne had eloped from her native Crete with the Athenian hero Theseus. However, Theseus abandoned Araidne whilst she slept, and so she woke alone on the island of Naxos to see his ship sailing away. She was discovered grief-stricken by Bacchus, god of wine, who immediately fell in love with her. In some tellings of the story, Bacchus removed Ariadne’s crown and threw it into the heavens, where it became a constellation of stars. In other versions Ariadne herself became a star. Van Loo has depicted the moment Bacchus and Ariadne meet on the shore of Naxos. They look adoringly into each other’s eyes and the god gently takes the young princess by the hand. Above Ariadne’s head a putto has taken her crown, ready to be thrown to the heavens. Bacchus is dressed in his traditional leopard skin cloak, and the wreath of vines around his head reminds the viewer of his role as god of wine, as does the bunch of grapes in the lower left corner. Ariadne is dressed in beautiful silks and rests on a large luxurious pillow, reflecting her royal status. In her hand she suggestively holds Bacchus’ thyrsus, another of the god’s traditional attributes. -

Kantemir Introduction.Pdf
French in Russian diplomacy: Antiokh Kantemir’s address to King George II and his diplomatic and other correspondence1 Introduction Antiokh Kantemir: his life and his diplomatic and literary careers Antiokh Kantemir (or Cantemir, in eighteenth-century transliterated form), the author of the texts that we reproduce here, was the fourth son of Dimitrie Cantemir (1673-1723), a Moldavian political leader and scholar. In 1710 Dimitrie was elected Voivode, or local governor, of the Principality of Moldavia, a vassal state of the Ottoman Empire.2 He entered into secret negotiations with Peter I (the Great), whose victory at Poltava in 1709 over the Swedish forces of Charles XII (King of Sweden 1697-1718) convinced him that Muscovy was now the ascendant power in the region. However, when in 1711 Russian and Moldavian allied forces were defeated by the Turks on the River Prut, Dimitrie was forced to take refuge in Russia. Peter rewarded him for his allegiance, granting him estates, a substantial income and property in Moscow, to which the family moved in 1713. In Russia Dimitrie continued scholarly work on which he had long been engaged. At the request of the Berlin Academy of Sciences, of which he became a member in 1714, he wrote a Description of Moldavia in Latin.3 He also completed the work for which he is chiefly remembered, his History of the Growth and Decay of the Ottoman Empire, also in Latin, a valuable source for historians of the Ottoman Empire.4 (The work was known to Voltaire (1694-1778) when he wrote his History of Charles XII and to Edward Gibbon (1737-94), who used it when writing his Decline and Fall of the Roman Empire.5) Thanks to Antiokh, an English translation of Dimitrie’s magnum opus was published in London in 1734-35; French and German translations were subsequently published too, in Paris and Hamburg in 1743 and 1745 respectively. -

Louis Xiv in the Opinions of the Polish Nobility – from Fascination to Fear of Absolutum Dominium1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prace Historyczne 143, z. 1 (2016), s. 69–87 doi: 10.4467/20844069PH.15.001.4927 www.ejournals.eu/Prace-Historyczne LOUIS XIV IN THE OPINIONS OF THE POLISH NOBILITY – FROM FASCINATION TO FEAR OF ABSOLUTUM DOMINIUM1 Katarzyna Kuras Jagiellonian University in Kraków ABSTRACT LOUIS XIV IN THE OPINIONS OF THE POLISH NOBILITY – FROM FASCINATION TO FEAR OF ABSOLUTUM DOMINIUM Louis XIV, King of France (1643–1715), was variously perceived and assessed by the Polish nobility. The reception of his person and his concept of ruling the state by Polish noblemen was to change during the 17th and 18th centuries. In this period the nobles who visited France during their Grand Tours were generally fascinated by the glamour surrounding the monarch and the splendour of the palace of Versailles. They sought an opportunity to contact personally the Sun King and talk to him. Later Polish travellers sent to their homeland detailed relations from audiences by or meet- ings with Louis XIV. On the other hand, for a considerable part of the Polish nobility Louis XIV was the incarnation of absolutum dominium and a symbol of potential threat to the freedom beloved by the Polish “political nation”. These fears were fuelled by the activity of the king of France in the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth, especially his political and fi nancial support for the followers of the French candidatures to the Polish throne and for the concept of election vivente rege promoted by Ludwika Maria Gonzaga, the queen of Poland of French descent. The reception of the person of the Sun King and the vision of his rule in the eyes of the Polish nobility changed in the second half of the 18th century. -
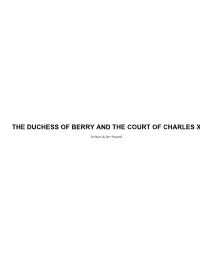
The Duchess of Berry and the Court of Charles X
THE DUCHESS OF BERRY AND THE COURT OF CHARLES X Imbert de St−Amand THE DUCHESS OF BERRY AND THE COURT OF CHARLES X Table of Contents THE DUCHESS OF BERRY AND THE COURT OF CHARLES X..................................................................1 Imbert de St−Amand......................................................................................................................................1 I. THE ACCESSION OF CHARLES X........................................................................................................2 II. THE ENTRY INTO PARIS......................................................................................................................4 III. THE TOMBS OF SAINT−DENIS..........................................................................................................7 IV. THE FUNERAL OF LOUIS XVIII.......................................................................................................10 V. THE KING..............................................................................................................................................14 VI. THE DAUPHIN AND DAUPHINESS.................................................................................................16 VII. MADAME............................................................................................................................................19 VIII. THE ORLEANS FAMILY.................................................................................................................23 IX. THE PRINCE OF CONDE....................................................................................................................26 -

Archives De Charles Mignon, Commis Des Affaires
Ministère des Affaires étrangères SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES Acquisitions réalisées de 1990 à 1992 Volume, folio Contenu Dates extrêmes Cote Vol. 1 Documents divers : archives de Charles Mignon, commis des Affaires 1694-XIXe siècle 1-1 et 1-2 étrangères sous Louis XIV, et de Pierre-Louis-Marie et Pierre Framery, agents consulaires en Norvège. Charles Mignon, commis des Affaires étrangères : correspondance adressée aux 1-1 négociateurs de la future paix de Ryswick. f. 4-68 Correspondance adressée à Saint-Germain et Gigny, plénipotentiaires à Maastricht. 1694 Novembre-décembre 1694. f. 69-96 Correspondance adressée à Harlay de Bonneuil, Verjus, Crécy et Callières, 1697 plénipotentiaires à Delft et Ryswick. Janvier-mars 1697. f. 97-101 Tables de chiffre. s.d. Papiers personnels de Pierre-Louis-Marie Framery et de son fils Pierre Framery : 1-2 état de service, testaments, passeports, éléments de correspondance. f. 103-121 Certificat de vie commune de Pierre Framery, ancien secrétaire de la légation française au 1796- Danemark, et de Marguerite Claire Aubière (1796), extrait de l’arrêté de nomination de [XIXe siècle] Framery fils comme consul de France à Christiansand (Norvège) (2 thermidor an VI), testaments de Pierre Louis Marie Framery (1813-1814, f. 105-109v), demande de secours et obligation adressée par Framery fils au chevalier de Schouboc, gouverneur de la province de Christiansand (mars-avril 1814, f. 110-111), autorisation de port de la décoration du lys (septembre 1814), lettre annonçant à Framery son rappel (décembre 1815), passeports fournis à Framery, à sa famille et à sa domesticité pour leur retour en France par le gouvernement suédois et le chargé d’affaires de France à Stockholm (1816, f. -
Review Volume 18 (2018) Page 1
H-France Review Volume 18 (2018) Page 1 H-France Review Vol. 18 (May 2018), No. 117 Youri Carbonnier and Jean Duron, Charles Gauzargues (1723-1801): Un musicien de la Chapelle royale entre Nîmes et Versailles. Paris: Éditions A. et J. Picard, 2016. 180 pp. Illustrations, bibliography, and index. €20.00 (pb). ISBN 978-2-7084-1014-5. Review by John Hajdu Heyer, University of Wisconsin-Whitewater. During the reign of Louis XIV, oversight of the music for Royal Chapel fell to a high-level cleric, one appointed to what was essentially an honorific post. This individual held the title of Maître de musique de la chapelle royale. Once appointed, these maîtres tended to serve for life and even beyond: for example, Charles-Maurice Le Tellier (1642-1710), Archbishop of Reims, held the post at a salary of 1200 livre tournois from 1668 until 1713 despite his death in 1710. In 1714, the diplomat Cardinal Melchior de Polignac (1661-1742) succeeded Le Tellier, serving in the post for three years until his exile, at which time the Bishop of Rennes took over until Polignac’s restoration. While these individuals contributed nominal administrative supervision, royally appointed sous-maîtres actually provided and directed the music of the Royal Chapel, thus carrying the primary functions of the musical establishment in the chapel from what appeared to be a subservient position. However, the post of sous-maître de la chapelle royale was the highest position to which a church musician could ascend under the ancien régime, and thus, musicians coveted the post. Louis XV discontinued the oversight post of maître de musique by 1761, due no doubt to financial considerations, but the head musicians in the chapel retained the title sous- maître, a title that so named lived on until the Revolution. -

Korespondencja Franciszka Ludwika, Księcia Conti Z Okresu Jego Wyprawy Do Polski Jesienią 1697 Roku
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE Title: "co dnia czynią mi nowe propozycje" : korespondencja Franciszka Ludwika, księcia Conti z okresu jego wyprawy do Polski jesienią 1697 roku Author: Aleksandra Skryzpietz Citation style: Skryzpietz Aleksandra. (2016). "co dnia czynią mi nowe propozycje" : korespondencja Franciszka Ludwika, księcia Conti z okresu jego wyprawy do Polski jesienią 1697 roku. "Wieki Stare Nowe" (T. 11 (2016), s. 48-66). „Wieki Stare i Nowe” 2016, t. 11 (16), s. 48—66 ISSN 18991556 (wersja drukowana) ISSN 23539739 (wersja elektroniczna) Aleksandra Skrzypietz Uniwersytet Śląski w Katowicach „co dnia czynią mi nowe propozycje”* — korespondencja Franciszka Ludwika, księcia Conti, z okresu jego wyprawy do Polski jesienią 1697 roku Wykorzystane w artykule listy Franciszka Ludwika de Bourbon, księcia Conti, adresowane do jego żony Marii Teresy de Bourbon pisane były podczas podróży księcia Conti do Polski. Wcześniejsza korespondencja — powstała latem 1697 roku, gdy nadeszły wieści o obiorze księcia na tron Polski — przeanalizowana została w artykule „jestem zdecydowany nie robić niczego pochopnie” — elekcja 1697 roku w korespondencji księcia Conti1. Temat elekcji i zamieszania, jakie nastąpiło po jej zakończeniu, został omówiony w książce poświęconej francuskim staraniom o pol- ską koronę2. Natomiast wyprawę elekta do Polski przedstawił w swej pracy Michał Komaszyński3. Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na te wydarzenia przez pry- zmat wiadomości, jakie książę Conti przesyłał swej małżonce. U schyłku czerwca 1697 roku, po długim, zdominowanym przez bardzo ostrą walkę bezkrólewiu, dokonała się elekcja polskiego władcy. Powstało jednak pytanie: kto został obrany? Obie strony, zarówno zwolennicy księcia Conti, jak i elektora sa- skiego Fryderyka Augsuta, uznały, że odniosły sukces. -

Carriera's Journal
Neil Jeffares, Pastels & pastellists Rosalba Carriera’s journal1 NEIL JEFFARES ERE IS A ROUGH translation into English of the famous journal kept by Rosalba Carriera (1673–1757) during her visit to Paris. She was accompanied by her mother, née Alba Foresti (1655–1738), her unmarried sister Giovanna (1675–1737), her sister Angela or H Anzola (1677–1757), and the latter’s husband, the painter Giovanni Antonio Pellegrini (1675–1741). Various editions2 have been produced in Italian and French, but I have not seen an English translation. Vianelli’s text departed freely from the original manuscript, and there are extensive differences with Sensier’s and Sani’s editions. It has been necessary to consult the original manuscript, my transcription of which (preserving as much of the original as possible, making it unreadable) is attached as Appendix I. I have also transcribed, but not translated, the diaries for the years 1723–28 when she had returned to Venice (Appendix II): here the entries are even more perfunctory. Sensier’s edition of the Paris journal has extensive notes, but they are difficult to use; Sani omits many of his annotations. I have kept mine to a minimum for readability, except where it is necessary to discuss a new identification. Since this is a reading edition rather than an academic transcription, I have silently given most names in their standard French spellings (e.g. M.a di Tre is Mme d’Estrées). Many of the sitters discussed belong to important families for whom iconographical genealogies may be found here (under the family name, so the marquise de Louvois appears under Le Tellier).