Blockseminar Gesellschaftliche Aspekte Der Informatik FH
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Humanoid Robots – from Fiction to Reality?
KI-Zeitschrift, 4/08, pp. 5-9, December 2008 Humanoid Robots { From Fiction to Reality? Sven Behnke Humanoid robots have been fascinating people ever since the invention of robots. They are the embodiment of artificial intelligence. While in science fiction, human-like robots act autonomously in complex human-populated environments, in reality, the capabilities of humanoid robots are quite limited. This article reviews the history of humanoid robots, discusses the state-of-the-art and speculates about future developments in the field. 1 Introduction 1495 Leonardo da Vinci designed and possibly built a mechan- ical device that looked like an armored knight. It was designed Humanoid robots, robots with an anthropomorphic body plan to sit up, wave its arms, and move its head via a flexible neck and human-like senses, are enjoying increasing popularity as re- while opening and closing its jaw. By the eighteenth century, search tool. More and more groups worldwide work on issues like elaborate mechanical dolls were able to write short phrases, play bipedal locomotion, dexterous manipulation, audio-visual per- musical instruments, and perform other simple, life-like acts. ception, human-robot interaction, adaptive control, and learn- In 1921 the word robot was coined by Karel Capek in its ing, targeted for the application in humanoid robots. theatre play: R.U.R. (Rossum's Universal Robots). The me- These efforts are motivated by the vision to create a new chanical servant in the play had a humanoid appearance. The kind of tool: robots that work in close cooperation with hu- first humanoid robot to appear in the movies was Maria in the mans in the same environment that we designed to suit our film Metropolis (Fritz Lang, 1926). -

Kultur -Und Techniksoziologische Studien
KKUULLTTUURR-- UUNNDD TTEECCHHNNIIKKSSOOZZIIOOLLOOGGIISSCCHHEE SSTTUUDDIIEENN no 03/2013 no 03/2013 - 2 - Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien http://www.uni-due.de/wpkts no 03/2013 Herausgeber: Diego Compagna, Stefan Derpmann Layout: Vera Keysers Kontaktadresse: Universität Duisburg-Essen Institut für Soziologie Diego Compagna [email protected] Ein Verzeichnis aller Beiträge befindet sich hier: http://www.uni-due.de/wpkts ISSN 1866-3877 (Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien) Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien - Copyright This online working paper may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also download them for your own personal use. This paper must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author‘s explicit permission. Please note that if you copy this paper you must: • include this copyright note • not use the paper for commercial purposes or gain in any way You should observe the conventions of academic citation in a version of the following form: Author (Year): Title. In: Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien (no xx/Year). Eds.: Diego Compagna / Stefan Derpmann, University Duisburg-Essen, Germany, at: http://www.uni-due.de/wpkts Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien - Copyright Das vorliegende Working Paper kann entsprechend der üblichen akademischen Regeln zitiert werden. Es kann für den persönlichen Gebrauch auch lokal gespeichert werden. Es darf nicht anderweitig publiziert oder verteilt werden (z.B. in Mailinglisten) ohne die ausdrückliche Erlaubnis des/der Autors/in. Sollte dieses Paper ausgedruckt oder kopiert werden: • Müssen diese Copyright Informationen enthalten sein • Darf es nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden Es sollten die allgemein üblichen Zitationsregeln befolgt werden, bspw. -

Modeling and Control of Legged Robots Pierre-Brice Wieber, Russ Tedrake, Scott Kuindersma
Modeling and Control of Legged Robots Pierre-Brice Wieber, Russ Tedrake, Scott Kuindersma To cite this version: Pierre-Brice Wieber, Russ Tedrake, Scott Kuindersma. Modeling and Control of Legged Robots. Springer Handbook of Robotics, Springer International Publishing, pp.1203-1234, 2016, 10.1007/978- 3-319-32552-1_48. hal-02487855 HAL Id: hal-02487855 https://hal.inria.fr/hal-02487855 Submitted on 21 Feb 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Chapter 48 Modeling and Control of Legged Robots Summary Introduction The promise of legged robots over standard wheeled robots is to provide im- proved mobility over rough terrain. This promise builds on the decoupling between the environment and the main body of the robot that the presence of articulated legs allows, with two consequences. First, the motion of the main body of the robot can be made largely independent from the roughness of the terrain, within the kinematic limits of the legs: legs provide an active suspen- sion system. Indeed, one of the most advanced hexapod robots of the 1980s was aptly called the Adaptive Suspension Vehicle [1]. Second, this decoupling al- lows legs to temporarily leave their contact with the ground: isolated footholds on a discontinuous terrain can be overcome, allowing to visit places absolutely out of reach otherwise. -

Washington Apple Pi Journal, July-August 2008
July/August 2008 Volume 30, No. 4 Washington Apple Pi Cl) ..c +.l M -c m o r a A Journal for Macintosh Computer Users Day Sund:1y ER DISCUSSION lil!i;iiiiif;tifij;pfl~Q~o°4./i_~r{,J;'/i;;J~ Ll / - ·· . -±2-0449 luz bevern. ge or s· Topic A specinc week and day of the \~' eek I 2nd ~ J l Wednesday-- -------- Washington Apple Pi Meetings July 2008 General Meeting July 2 6, 9:30 a.m., Luther Jackson Middle School Little Apps I Love! This month's meeting is going to be chock-full of discoveries with several presenters sharing some of their favorite little apps (applications) or widgets with you. Also featured: genealogy on the Mac. Come, watch and learn! There are tens of thousands of really cool third-party programs available. Learn how to find them yourself, d iscover new ways to do neat things, enhance your computing productivity, or express your creativity in new ways.There is no doubt the Mac can help you be productive but it can be fun too! After exploring little apps, Dick Nugent, a long time Pi member, will guide us through doing family genealogy on the Mac. He will continue in the Genealogy SIG with a demonstration of the popular Mac genealogy software, Reunion. As we have for thirty years, we will start with our legendary Q & A session, followed by Pi business. Kitty's Coffee Break will reenergize everyone for the main presentations. We will close with a short Town Hall meeting where your questions or comments for the leadership will be taken.Then comes lunch! The afternoon is reserved for three Special Interest Group meetings.The Beginners SIG, the ilife SIG and the rejuvenated Genealogy SIG provide opportunity for more focused attention, so bring your questions and your projects to share with the others. -
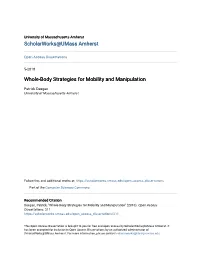
Whole-Body Strategies for Mobility and Manipulation
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Open Access Dissertations 5-2010 Whole-Body Strategies for Mobility and Manipulation Patrick Deegan University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations Part of the Computer Sciences Commons Recommended Citation Deegan, Patrick, "Whole-Body Strategies for Mobility and Manipulation" (2010). Open Access Dissertations. 211. https://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/211 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. WHOLE-BODY STRATEGIES FOR MOBILITY AND MANIPULATION A Dissertation Presented by PATRICK DEEGAN Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2010 Computer Science c Copyright by Patrick Deegan 2010 All Rights Reserved WHOLE-BODY STRATEGIES FOR MOBILITY AND MANIPULATION A Dissertation Presented by PATRICK DEEGAN Approved as to style and content by: Roderic Grupen, Chair Oliver Brock, Member Andrew Barto, Member Richard Van Emmerik, Member Andrew Barto, Department Chair Computer Science To my family. ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank my thesis advisor, Rod Grupen, for all his help, leadership, and support throughout my graduate school career. Rod’s vast knowledge, genius, and insight into robotics has been a constant inspiration. I feel very fortunate to have been a part of the Laboratory for Perceptual Robotics. The environment Rod created not only allowed me to develop my passion for robotics, but his understanding and patience allowed me to grow personally, overcome many obstacles, and develop the confidence I needed to bring this work to fruition. -

Social Robotics Agenda.Pdf
Thank you! The following agenda for social robotics was developed in a project led by KTH and funded by Vinnova. It is a result of cooperation between the following 35 partners: Industry: ABB, Artificial Solutions, Ericsson, Furhat robotics, Intelligent Machines, Liquid Media, TeliaSonera Academia: Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Karolinska Institutet, KTH, Linköpings universitet, Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet, Röda korsets högskola, Stockholms Universtitet, Uppsala Universitet, Örebro universitet Public sector: Institutet för Framtidsstudier, Myndigheten för Delaktighet, Myndigheten för Tillgängliga Medier, Statens medicinsk- etiska råd, Robotdalen, SLL Innovation, Språkrådet End-user organistions: Brostaden, Epicenter, EF Education First, Fryshuset Gymnasium, Hamnskolan, Investor, Kunskapsskolan, Silver Life, Svenskt demenscentrum, Tekniska Museet We would like to thank all partners for their great commitment at the workshops where they shared good ideas and insightful experiences, as well as valuable and important observations of what the future might hold. Agenda key persons: Joakim Gustafson (KTH), Peje Emilsson (Silver Life), Jan Gulliksen (KTH), Mikael Hedelind (ABB), Danica Kragic (KTH), Per Ljunggren (Intelligent Machines), Amy Loutfi (Örebro university), Erik Lundqvist (Robotdalen), Stefan Stern (Investor), Karl-Erik Westman (Myndigheten för Delaktighet), Britt Östlund (KTH) Writing group: editor Joakim Gustafson, co-editor Jens Edlund, Jonas Beskow, Mikael Hedelind, Danica Kragic, Per Ljunggren, Amy -

Robust Door Operation with the Toyota Human Support Robot
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bachelor Thesis Robust Door Operation with the Toyota Human Support Robot Robotic Perception, Manipulation and Learning Miguel Arduengo García February 2019 Degrees: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Enginyeria Física Advisors: Dr. Luis Sentis Álvarez Dra. Carme Torras Genís Robots are progressively spreading to urban, social and assistive domains. Service robots operating in domestic environments typically face a variety of objects they have to deal with to fulfill their tasks. Some of these objects are articulated such as cabinet doors and drawers. The ability to deal with such objects is relevant, as for example navigate between rooms or assist humans in their mobility. The exploration of this task rises interesting questions in some of the main robotic threads such as perception, manipulation and learning. In this work a general framework to robustly operate different types of doors with a mobile manipulator robot is proposed. To push the state-of-the- art, a novel algorithm, that fuses a Convolutional Neural Network with point cloud processing for estimating the end-effector grasping pose in real-time for multiple handles simultaneously from single RGB-D images, is proposed. Also, a Bayesian framework that embodies the robot with the ability to learn the kinematic model of the door from observations of its motion, as well as from previous experiences or human demonstrations. Combining this probabilistic approach with state-of-the-art motion planning frameworks, such as the Task Space Region, a reliable door and handle detection and subsequent door operation independently of its kinematic model is achieved with the Toyota Human Support Robot (HSR). -
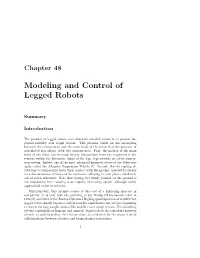
Modeling and Control of Legged Robots
Chapter 48 Modeling and Control of Legged Robots Summary Introduction The promise of legged robots over standard wheeled robots is to provide im- proved mobility over rough terrain. This promise builds on the decoupling between the environment and the main body of the robot that the presence of articulated legs allows, with two consequences. First, the motion of the main body of the robot can be made largely independent from the roughness of the terrain, within the kinematic limits of the legs: legs provide an active suspen- sion system. Indeed, one of the most advanced hexapod robots of the 1980s was aptly called the Adaptive Suspension Vehicle [1]. Second, this decoupling al- lows legs to temporarily leave their contact with the ground: isolated footholds on a discontinuous terrain can be overcome, allowing to visit places absolutely out of reach otherwise. Note that having feet firmly planted on the ground is not mandatory here: skating is an equally interesting option, although rarely approached so far in robotics. Unfortunately, this promise comes at the cost of a hindering increase in complexity. It is only with the unveiling of the Honda P2 humanoid robot in 1996 [2], and later of the Boston Dynamics BigDog quadruped robot in 2005 that legged robots finally began to deliver real-life capabilities that are just beginning to match the long sought animal-like mobility over rough terrain. Not matching yet the capabilities of humans and animals, legged robots do contribute however already to understanding their locomotion, as evidenced by the many fruitful collaborations between robotics and biomechanics researchers. -

Cultural Difference in Robotics: Japan and Germany - an Overview Rathmann, Martin
www.ssoar.info Cultural difference in Robotics: Japan and Germany - an overview Rathmann, Martin Veröffentlichungsversion / Published Version Arbeitspapier / working paper Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Rathmann, M. (2013). Cultural difference in Robotics: Japan and Germany - an overview. (Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien, 03/2013). Duisburg: Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, Fak. für Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-409393 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an. -

A Low-Cost Autonomous Humanoid Robot for Multi-Agent Research
NimbRo RS: A Low-Cost Autonomous Humanoid Robot for Multi-Agent Research Sven Behnke, Tobias Langner, J¨urgen M¨uller, Holger Neub, and Michael Schreiber Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Institute for Computer Science Georges-Koehler-Allee 52, 79110 Freiburg, Germany { behnke langneto jmuller neubh schreibe } @ informatik.uni-freiburg.de Abstract. Due to the lack of commercially available humanoid robots, multi-agent research with real humanoid robots was not feasible so far. While quite a number of research labs construct their own humanoids and it is likely that some advanced humanoid robots will be commercially available in the near future, the high costs involved will make multi-robot experiments at least difficult. For these reasons we started with a low-cost commercial off-the-shelf humanoid robot, RoboSapien (developed for the toy market), and mod- ified it for the purposes of robotics research. We added programmable computing power and a vision sensor in the form of a Pocket PC and a CMOS camera attached to it. Image processing and behavior control are implemented onboard the robot. The Pocket PC communicates with the robot base via infrared and can talk to other robots via wireless LAN. The readily available low-cost hardware makes it possible to carry out multi-robot experiments. We report first results obtained with this hu- manoid platform at the 8th International RoboCup in Lisbon. 1 Introduction Evaluation of multi-agent research using physical robots faces some difficulties. For most research groups building multiple robots stresses the available resources to their limits. Also, it is difficult to compare results of multi-robot experiments when these are carried out in the group’s own lab, according to the group’s own rules. -

Toni: a Soccer Playing Humanoid Robot
In Itsuki Noda, Adam Jacoff, Ansgar Bredenfeld, and Yasutake Takahashi, editors, RoboCup-2005: Robot Soccer World Cup IX, pp. 59-70, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 4020, Springer, 2006. Preliminary version in Proceedings of The 9th RoboCup International Symposium, Osaka, Japan, paper #95, July 2005. Toni: A Soccer Playing Humanoid Robot Sven Behnke, J¨urgen M¨uller, and Michael Schreiber Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Computer Science Institute Georges-K¨ohler-Allee 52, 79110 Freiburg, Germany { behnke jmuller schreibe } @ informatik.uni-freiburg.de Abstract. This paper describes the humanoid robot Toni that has been designed to play soccer in the RoboCup Humanoid League. The paper details Toni’s mechanical and electrical design, perception, self localiza- tion, behavior control, and infrastructure. Toni is fully autonomous, has a low weight (2.2kg), and is much taller (74cm) than most servo-driven humanoid robots. It has a wide field of view camera, ample computing power, and wireless communication. Toni possesses basic soccer skills. It walks dynamically in all directions (up to 20cm/s in forward direction) and turns on the spot. It perceives the ball and the goals and localizes itself on the field. Toni is able to approach the ball and to dribble it. It can kick the ball without falling. We performed tests in our lab and penalty kick demonstrations at Robo- Cup German Open 2005. Toni’s successors Jupp, Sepp, and Max per- formed well at the RoboCup 2005 Humanoid League competitions. 1 Introduction The ultimate goal of the RoboCup initiative is stated as follows: By mid-21st century, a team of fully autonomous humanoid robot soccer players shall win the soccer game, comply with the official rule of the FIFA, against the winner of the most recent World Cup [9]. -
Whole-Body Balancing Walk Controller for Position Controlled Humanoid Robots
International Journal of Humanoid Robotics Vol. 13, No. 1 (2016) 1650011 (28 pages) °c World Scienti¯c Publishing Company DOI: 10.1142/S0219843616500110 Whole-Body Balancing Walk Controller for Position Controlled Humanoid Robots Seung-Joon Yi GRASP Laboratory, University of Pennsylvania, Philadelphia PA 19104, USA [email protected] Byoung-Tak Zhang BI Laboratory, Seoul National University, Seoul, Korea [email protected] Dennis Hong RoMeLa Laboratory, University of California, Los Angeles CA 90095, USA [email protected] Daniel D. Lee GRASP Laboratory,University of Pennsylvania, Philadelphia PA 19104, USA [email protected] Received 25 May 2015 Accepted 13 January 2016 Published 17 March 2016 Int. J. Human. Robot. 2016.13. Downloaded from www.worldscientific.com by SEOUL NATIONAL UNIVERSITY on 06/18/16. For personal use only. Bipedal humanoid robots are intrinsically unstable against unforeseen perturbations. Conven- tional zero moment point (ZMP)-based locomotion algorithms can reject perturbations by incorporating sensory feedback, but they are less e®ective than the dynamic full body behaviors humans exhibit when pushed. Recently, a number of biomechanically motivated push recovery behaviors have been proposed that can handle larger perturbations. However, these methods are based upon simpli¯ed and transparent dynamics of the robot, which makes it suboptimal to implement on common humanoid robots with local position-based controllers. To address this issue, we propose a hierarchical control architecture. Three low-level push recovery controllers are implemented for position controlled humanoid robots that replicate human recovery behaviors. These low-level controllers are integrated with a ZMP-based walk controller that is capable of generating reactive step motions.