2 Die Logik Von Unternehmen (Und Warum Sie Scheitern)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Qualitative and Quantitative Analysis of Siemens Ag
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF SIEMENS AG Authors (Universitat de Barcelona): Patrícia Amor Agut Clara Valls Moreno Gemma Casserras EDITOR: Jordi Marti Pidelaserra (Dpt. Comptabilitat, Universitat Barcelona) 1 Patrícia Amor 14961785 Clara Valls 14959906 Gemma Casserras 14965090 Alessandra Cortegiani (Bloc 3) 14991480 2 BLOC 1: SIEMENS AG BLOC 2: Risk Analysis BLOC 3: Profitability Analysis 3 BLOC 1 SIEMENS AG BASIC INFORMATION 4 Index 1. Introduction 2. Company History 3. Vision, Mission and Strategy 3.1. Vision 3.2. Mission 3.3. Strategy 4. Company Structure 4.1. Board of directors 4.2. Management by sector 5. Company Sectors 5.1. Energy Sector 5.2. Industry Sector 5.3. Healthcare Sector 5.4. Infrastructure and cities Sector 5.5. Financial Services 5.6. Other activities 5.7. Revenues importance 6. Shareholders 7. Stakeholders 8. Competitors 5 1. Introduction: Siemens AG is a German multinational engineering and electronics conglomerate company headquartered in Munich, Germany. It is the largest based in Europe. Founded to manufacture and install telegraphic systems, Germany-based Siemens AG has prospered and grown over 165 years to become a multifaceted electronics and electrical engineering enterprise, and one of the most international corporations in the world. Founded to manufacture and install telegraphic systems, Germany-based Siemens AG has prospered and grown over 165 years to become a multifaceted electronics and electrical engineering enterprise, and one of the most international corporations in the world. The Siemens name has been synonymous with cutting-edge technologies and continuous growth in profitability. With their wide array of products, systems and services, they are world leaders in information and communications, automation and control, power, medical solutions, transportation and lighting. -

Case No COMP/M.4297 - NOKIA / SIEMENS
EN Case No COMP/M.4297 - NOKIA / SIEMENS Only the English text is available and authentic. REGULATION (EC) No 139/2004 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date: 13/11/2006 In electronic form on the EUR-Lex website under document number 32006M4297 Office for Official Publications of the European Communities L-2985 Luxembourg COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 13.11.2006 SG-Greffe(2006) D/206841 In the published version of this decision, some PUBLIC VERSION information has been omitted pursuant to Article 17(2) of Council Regulation (EC) No 139/2004 concerning non-disclosure of business secrets and other confidential information. The omissions are shown thus […]. Where possible the information MERGER PROCEDURE omitted has been replaced by ranges of figures or a general description. ARTICLE 6(1)(b) DECISION To the notifying party Dear Sir/Madam, Subject: Case No COMP/M.4297 – NOKIA/SIEMENS Notification of 5 October 2006 pursuant to Article 4 of Council Regulation No 139/20041 1. On 05/10/2006, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 by which the undertaking Nokia Corporation (“Nokia”, Finland) acquires within the meaning of Article 3(1)(b) of the Council Regulation control of the undertaking Nokia Siemens Networks (“NSN”), a newly created company to which Nokia and Siemens Aktiengesellschaft (“Siemens”, Germany) will contribute their worldwide mobile and fixed-line telecommunications network equipment businesses. Nokia and Siemens are hereinafter referred to as “the Parties”. 2. After examination of the notification, the Commission has concluded that the notified operation falls within the scope of the Merger Regulation and does not raise serious doubts as to its compatibility with the common market and the EEA Agreement. -

Siemens Brochure2
Maximizing Mobility—Partnering with Siemens and Cisco Moving toward next-generation mobile services • How about a network that As mobile networks grow in terms of number of subscribers and data traffic, mobile enables you to increase revenue operators have to evolve their networks, making them more efficient and allowing per subscriber by offering them to charge for differentiated services. Evolving your mobile network to all IP is key. IP-based networks allow operators to explore new business opportunities enhanced data services such as and deploy new revenue-generating service functionalities, such as content-aware messaging, browsing, and down- charging and multimedia messaging. loading of real-time multimedia? To help accelerate the pace of migration to a distributed IP mobile core, Cisco and • Or an infrastructure that allows Siemens have formed a strategic alliance that addresses these dynamic customer you to offer flexible billing for requirements. By combining Siemens’ strong position in the wireless infrastructure these data services? market with Cisco IP expertise, the two companies are in a better position to offer • And a partnership that lets you customers leading-edge solutions that enable you to maximize your mobile network. deliver on this promise through Sharing a Vision—Moving Toward a Global Mobile IP Network network innovation, product evo- The alliance was formed to help mobile operators pave the way to next-generation lution, and technical know-how? 3G networks based on IP. Siemens’ vision to align with operators who plan to utilize a common IP network across access technologies and Cisco proven leadership in Cisco and Siemens share your IP uniquely positions the alliance as an ideal partner of choice to support service vision and enable you to maximize providers through this critical IP NGN journey. -

Case No COMP/M.3911 - BENQ / SIEMENS MOBILE
EN Case No COMP/M.3911 - BENQ / SIEMENS MOBILE Only the English text is available and authentic. REGULATION (EC) No 139/2004 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date: 07/09/2005 In electronic form on the EUR-Lex website under document number 32005M3911 Office for Official Publications of the European Communities L-2985 Luxembourg COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 07-IX-2005 SG-Greffe(2005) D/204914 PUBLIC VERSION MERGER PROCEDURE ARTICLE 6(1)(b) DECISION To the notifying party Dear Sir/Madam, Subject: Case No COMP/M.3911 –BenQ / Siemens Mobile Notification of 04/08/05 pursuant to Article 4 of Council Regulation No 139/20041 1. On the 4 August 2005, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EC) No 139/2004 by which the undertaking BenQ Corporation (“BenQ”, Taiwan, Republic of China) acquires, within the meaning of 3(1)(b) of the Council Regulation, control of the mobile device business of Siemens AG (“Siemens device business”, Germany) by way of purchase of assets, and in respect of Germany and the UK, also by purchase of shares. I. THE PARTIES 2. BenQ is active in the communication and multimedia device business. Within this business it is active in the areas of digital displays, scanners and keyboards, mobile telephones (including communication devices like GSM mobile phones), digital projectors, storage devices, wireless technologies and electronic components. In the area of mobile telephones, BenQ sells its products mainly to other producers of telephones but also to a small extend under its own brand label to retailers and network operators. -
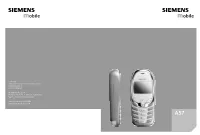
A57 Sw.QXD 13.05.2004 13:30 Uhr Seite 1 S S Mobile Mobile
BA Cover A57 sw.QXD 13.05.2004 13:30 Uhr Seite 1 s s mobile mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich © Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft www.siemens-mobile.com A57 cyan magenta yellow black LIEBREICH, Medienproduktion right page (1) of A57 Jaguar, short, en A31008-H5830-A1-2-7619 (24.06.2004, 06:22) VAR Language: en; VAR issueVAR Language: date: 040528 Contents 1 Contents Safety precautions ............................. 2 Profiles ............................................. 20 Overview of the phone ...................... 3 Setup ................................................ 20 Display symbols (selection) ................ 5 Display .......................................... 20 Getting Started ................................... 6 Language ...................................... 20 Insert SIM card/battery ..................... 7 Screensaver ................................... 20 Charge battery ................................. 7 Call setup ...................................... 20 Switch on/off, PIN entry ..................... 8 Divert ............................................ 21 General information ........................... 8 Clock ............................................. 21 User Guide ....................................... 8 Security ......................................... 22 Menu Control .................................. 8 Network ........................................ 22 Security ............................................. -

Download Executive Summary
EnOcean GmbH Kolpingring 18a 82041 Oberhaching www.enocean.com +49.89.67 34 689-0 Our Investment Premise – Our Story “Negawatts” is the lowest cost energy source available. EnOcean created a key ingredient for energy conservation: Energy Harvesting Wireless Sensors. They enable wireless control systems without the need to exchange and dispose batteries. With its wealth of German technology and patents EnOcean will create the most significant company in the field of wireless sensor connectivity. The solution enables building automation system for significant, but painless energy savings: Low intrusive through wireless technology Short payback period to building owner Supports global goals to fight global warming Market leaders like Siemens, Leviton, Masco and Honeywell have adopted the solution. EnOcean harvests tiny amounts of energy from the environment – for example, from motion, lighting or differences in temperature. The amount of energy obtained in this way is sufficient to transmit a wireless signal that controls the air condition, for instance. We combine the energy harvesting with a microprocessor, firmware to enable easy integration by our customers. The plug & play modules are ready for implementation, enabling OEMs to create energy-autonomous applications simply and cost-effectively – without in-house expertise on wireless and energy harvesting. A further advantage is the interoperability of products. Standardized sensor profiles enable products from different manufacturers to communicate and coordinate in one and the same system with no difficulty. The standardization is promoted by the EnOcean Alliance, a consortium of leading companies from the building sector, and its 170 member companies. Our customers market energy conservation systems that are fundamental for energy-efficient buildings and innovative industry – savings up to 60 % source: World Economic Forum, Study of the successful growth strategies of early-stage companies The sector that recognized the advantages of the EnOcean technology first is building automation. -
C30 GB 23/11/00 12:37 Side 4 Ss
Cover C30 GB 23/11/00 12:37 Side 4 ss Siemens Mobile Phones A/S Industrivej 30 DK-9490 Pandrup © Siemens AG 2000 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft http://www.siemens.com/mobiles Ref. No.: A31008-H6000-A1-1-7619 Printed in Denmark (7910.3000 GB / 11.00) User Guide C30 C30 Cover C30 GB 23/11/00 12:37 Side 2 2 Menu overview Siemens service Abu Dhabi Siemens Service Center 02713500 Lebanon . F.A. Kettaneh. 01443043 Setup menu Australia . Siemens . 1800622414 Lithuania . Siemens . 822391555 Applications Austria. Siemens . 0517075004 Luxembourg . Siemens . 43843399 Games Sheriff McAllen Bangladesh Siemens . 017527447 Malaysia . Siemens . 037514974 Stopwatch Echo Man List menu Black Jack Belgium . Siemens . 078152221 Marocco. SETEL S.A. 2352409 Outgoing calls Clock Display time Brunei . incomm. 02151 Mauritius . Ireland Blyth . 2116213 Answered calls Set time Bulgaria. Omnitel . 02739488 Netherlands . Siemens . 0703333100 Missed calls 12/24-hour mode China. Siemens . 02150318149 Norway . Siemens . 22633314 Phone book Network services Call divert Fixed numbers Call barring Croatia. Siemens . 016105381 Oman . Siemens Service Center . 791012 Barred numbers Call waiting Czech Rep.. Siemens . 0233032727 Pakistan . Siemens . 0215673565 Outgoing call ID Own numbers Line selection Denmark . Siemens . 35258600 Philippines . Siemens . 28149888 Info numbers Dubai . Siemens Service Center 04699720 Poland . Siemens . 0800220990 Service numbers Phone setup Language Network selection Egypt. Siemens . 23313129 Portugal . Siemens . 014178393 Messages Tones Dial mode Finland. Siemens . 092294370 Russia . Siemens . 80957371801 Greeting Factory settings France . Siemens . 0156384200 Saudi Arabia . Siemens . 026655058 Phone book Germany . Siemens . 01805333226 Singapore. Siemens . 8454818 Phone book setup Fixed dialling Greece. Siemens . 016864389 Slovak Rep. -

Go for Profit and Growth Heinz-Joachim Neubürger, CFO
Go for profit and growth Heinz-Joachim Neubürger, CFO MAY-04 Key figures – Second quarter in billions of euros Q204 Q203 New orders 19.7 19.1 Sales 17.8 18.2 Group profit from Operations 1.076 1.073 Net income 1.210 0.568 EPS (in euros) 1.36 0.64 Net cash from operating and investing activities 3.565 1.398 MAY-04 2 Key figures – First six months in billions of euros HY04 HY03 New orders 40.2 39.2 Sales 36.1 37.1 Group profit from Operations 2.437 2.170 Net income 1.936 1.089 EPS (in euros) 2.17 1.22 Net cash from operating and investing activities 2.374 0.261 MAY-04 3 Key features HY04 Growth achieved ! In line with expectations, reflecting “flat” - tish global market for turnkey systems ! Stronger growth in the product business, notably Medical and A&D on comparable basis, indicating market share gaining in certain sectors Strong cash flow ! Proceeds from sale of Infineon shares cover special contribution to pension plans ! Ongoing tight control of Capex relative to Depreciation indicating underline changes within the value added structure Transportation Systems ! Frustrating and embarrassing development MAY-04 4 Ongoing improvement in the I&C segment ICN – Information and Communication Networks ! Profit driven by restructuring in 03 and new products ! Carrier and Enterprise business in the black ! Demand situation “flat” - tish ICM – Information and Communication Mobile ! Solid performance on mobile networks ! Unit volume of handsets sharply up on YoY comparison, however marginally down over seasonally strong Christmas quarter ! ASP challenging - improvement expected with 65 series MAY-04 5 Sustainable success A&D – Automation and Drives ! Market share gain in all businesses across the globe ! Better performance in the U.S. -

Aufstellung Des Anteilsbesitzes Des Siemens Konzerns Gemäß § 313 Abs
Aufstellung des Anteilsbesitzes des Siemens Konzerns gemäß § 313 Abs. 2 HGB Kapital- anteil Stand 30.9.2002 in % I. Verbundene Unternehmen A. Konsolidiert 1. Deutschland (208 Gesellschaften) ACHH Grundstücksentwicklungs-GmbH & Co. OHG, Erlangen 1004) ACHH Grundstücksentwicklungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Erlangen 100 Alarmcom GmbH, Filderstadt-Bonlanden 100 Allgemeine Assekuranz-Vermittlung Duisburg GmbH, Duisburg 100 Atecs Mannesmann AG, Düsseldorf 1001) Audio Service GmbH, Herford 100 BFE Studio und Medien Systeme GmbH, Mainz 100 bibis Information Technology and Services GmbH, Dortmund 100 CAPTA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. OHG, Grünwald 1004) Divipart Aktiengesellschaft & Co. Grundstücks KG, Frankfurt am Main 100 Duewag AG, Krefeld-Uerdingen 99 Elektro-Röhren-Gesellschaft beschränkt haftende OHG, Göttingen 100 Elektro-Röhren-Gesellschaft mbH, Göttingen 100 Fertigungscenter für Elektrische Anlagen Bremen GmbH, Bremen 100 Fertigungscenter für Elektrische Anlagen Erlangen GmbH, Erlangen 100 Fertigungscenter für Elektrische Anlagen Hannover GmbH, Hannover 100 Fertigungscenter für Elektrische Anlagen Köln GmbH, Köln 100 Fertigungscenter für Elektrische Anlagen Langen GmbH, Mörfelden-Walldorf 100 Fertigungscenter für Elektrische Anlagen St. Ingbert GmbH, St. Ingbert 100 Frankendata Softwareengineering GmbH & Co. KG, Erlangen 100 Frankendata Softwareengineering Verwaltungsgesellschaft mbH, Erlangen 100 Gerap Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100 GIT Gesellschaft für Ingenieur-Technik mbH, -

Herunterladen
9/September 2005 Österreichs Insiderblatt für die Elektrobranche AllesAlles überüber MakroMarkt/MakroMarkt/ (!)haas(!)haas WieWie eineeine FreundschaftFreundschaft zerrisszerriss Merloni/Ardo: Agentursystem • Telekom: Kauf des Jahres Markt: Umsätze legen zu • BOF: Verkauft! Wer, was, P.b.b. Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 1170 Wien; Versandpostamt 8000 Graz; DVR0454591; Zulassungs Nr.: 02Z032978M 8000 Graz; DVR0454591; Zulassungs Nr.: 1170 Wien; Versandpostamt Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt P.b.b. Majdic: Kärntner Abwehrkampf Tagesaktuelle Insider-Infos unter www.elektro.at wie, wann, wo? Liebe Leser! In jedem Menschen sollen etwa 100 Millionen Nervenzellen ihre umschlag von 2 bis 3, wie in vielen Heimat rund um den Verdauungstrakt gefunden haben, weshalb die in Handelsbetrieben üblich, bei der landläufigen Meinung eher ungustiöse Zone in der mittleren Körper- gleichzeitigem Niedrig-Spannen- region unter Insidern auch gerne als das „kleine Gehirn“ bezeichnet Sortiment einfach nicht rechnet. wird. So stand’s zumindest in einer Profil-Coverstory vor kurzem. Das Punkt. Da kann man einen heißt aber auch, dass das „Entscheiden aus dem Bauch“ durchaus wis- Handstandüberschlag machen, senschaftlich haltbare Substanz hat. Radln schlagen oder mit dem Wer sich jetzt bestätigt fühlt in der Überzeugung, dass es im tägli- Kopf gegen die Wand rennen. chen Geschäft also ohnehin viel gescheiter ist, dem Bauch den Vorrang Wer jetzt meint, dass alles sei vor dem Hirn zu geben, muss leider enttäuscht werden. nur der Phantasie eines durch- Denn -
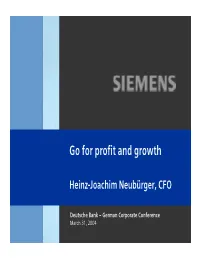
Go for Profit and Growth
Go for profit and growth Heinz-Joachim Neubürger, CFO Deutsche Bank – German Corporate Conference March 31, 2004 Key figures – Fiscal Year in billions of euros FY 03 FY 02 New orders 75.1 86.2 Sales 74.2 84.0 Group profit from Operations 4.295 3.756 Net income 2.445 1.661* EPS (in euros) 2.75 1.87** Net cash from operating and investing activities 1.773 4.754 * excl. EUR 936 millon gain on sales of Infineon shares ** excl. EUR 1,05 gain on sales of Infineon shares MAR-04 2 Successful Operation 2003 Reached Margin Targets Restore profitability in I&C Integrate Atecs Asset management U.S. Business Initiative Reduce central costs MAR-04 3 Key figures – First quarter in billions of euros Q1-04 Q1-03 New orders 20.5 20.1 Sales 18.3 18.8 Group profit from Operations 1.361 1.097 Net income 0.726 0.521 EPS (in euros) 0.82 0.59 Net cash from operating and investing activities (1.191) (1.137) MAR-04 4 Major efforts in the I&C segment in Q1-04 ICN – Information and Communication Networks ! Profit improvement as a result of restructuring in FY 03 ! Carrier and Enterprise business in the black ! Demand situation “flat” - tish ICM – Information and Communication Mobile ! More than doubled Q1-04 Group profit y-o-y ! Gaining market share – new record with 15.2 million sold handsets ! Well positioned with 29 contracts for 3G-Networks – more than 30.000 node B-stations installed MAR-04 5 Sustainable success A&D – Automation and Drives ! Market share gain in all businesses PG – Power Generation ! Performing within margin range; benefit from service Med – -

Peter Merz VP Nokia Standards Peter Merz | Linkedin
Peter Merz VP Nokia Standards Peter Merz | LinkedIn Peter is currently leading Nokia Standards at Nokia. The unit is responsible for developing holistic concepts and innovations for Access and Core networks as well as automation breakthroughs in network and service automation and driving them accordingly into external standardization bodies and fora. Peter received his Master of Science degree on electrical Engineering in 1995 from the University Stuttgart, Germany. In 1996 he joined the Siemens Mobile Networks division and started to work on GSM technology. He has a proven strong background in wireless research and he was part of the Siemens's pioneering activities in WCDMA and LTE. In 2004 he became manager of the unit responsible for radio access research and standardization. In 2007 he took over the position of Head of Radio Systems research in Nokia Siemens Network and later Nokia Networks. The research performed in this unit has substantially contributed to the evolution of WCDMA, HSPA and LTE/LTE-A and 5G technologies and systems that today and the future provide unparalleled connectivity on a global base. He is a proven leader and manager, capable of executing defined strategies by leading successfully projects & programs at multi-cultural organizations. Peter co- initiated/founded the industry consortium on CPRI (Common Public Radio Interface) together with Ericsson, NEC, Nortel, Siemens and Huawei. He was involved in the set-up of several collaborative research projects and bring up of various mobile generations like LTE and 5G moreover he holds several international patents. He is active in Digital Hub Mobility in Munich as well as a member of the VDE and in the board of “Münchner Kreis”.