Das Musikbusiness Funktionsweise, Eigenarten Und Untergang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

VOCAL 78 Rpm Discs Minimum Bid As Indicated Per Item
VOCAL 78 rpm Discs Minimum bid as indicated per item. Listings “Just about 1-2” should be considered as mint and “Cons. 2” with just the slightest marks. For collectors searching top copies, you’ve come to the right place! The further we get from the time of production (in many cases now 100 years or more), the more difficult it is to find such excellent extant pressings. Some are actually from mint dealer stocks and others the result of having improved copies via dozens of collections purchased over the past fifty years. * * * For those looking for the best sound via modern reproduction, those items marked “late” are usually of high quality shellac, pressed in the 1950-55 period. A number of items in this particular catalogue are excellent pressings from that era. * * * Please keep in mind that the minimum bids are in U.S. Dollars, a benefit to most collectors. * * * “Text label on verso.” For a brief period (1912-14), Victor pressed silver-on-black labels on the reverse sides of some of their single-faced recordings, usually with a translation of the text or similarly related comments. BESSIE ABOTT [s]. Riverdale, NY, 1878-New York, 1919. Following the death of her father which left her family penniless, Bessie and her sister Jessie (born Pickens) formed a vaudeville sister vocal act, accompanying themselves on banjo and guitar. Upon the recommendation of Jean de Reszke, who heard them by chance, Bessie began operatic training with Frida Ashforth. She subsequently studied with de Reszke him- self and appeared with him at the Paris Opéra, making her debut as Gounod’s Juliette. -

Beweg-Deinen-Arsch-Frank-Wilde.Pdf
ERFOLGSTRAINER NR.1 FRANK WILDE Beweg deinen Arsch Überarbeitete Auflage NEU: 32 Seiten Farbfotos Beweg deinen Arsch FRANK WILDE SANTOS VERLAG vierte Auflage Copyright© 2011 by SantoS Verlag Fürstenstraße 7 82467 Garmisch-Partenkirchen tel. 08821/951914 [email protected] www.santosverlag.de Druck: typomedia, oberammergau Umschlaggestaltung: typomedia, oberammergau www.typomedia-schubert.de ISBn 978-3-9813627-2-5 2 Vorwort Hallo liebe Leute, als 2007 dieses Buch erschien, hätte ich noch tausend Ideen gehabt, was da alles noch so rein gehört. aber der Verlag hat irgendwann „Stopp“ gesagt. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem Schluss ist und ein Buch in den Druck geht. Ich wollte von anfang an ein güns- tiges Buch zum Verkauf anbieten, damit es sich auch wirklich jeder leisten kann, auch finanziell nicht so stark bemittelte Leute, für die es ja auch gedacht war. Doch es kam anders. Es erschien als hochwertige gebundene Ver- sion. nachdem dieses Buch dann sensationelle Kritiken bekam, es sogar 2008 Buch der Woche im renommierten Hamburger abendblatt wurde, keimte in mir wieder meine ursprüngliche Idee. Ich drängte meinen Verleger, mir doch diesen titel zurück zu übertragen. Sportlich, wie er war, willigte er zögerlich, aber dann doch sehr fair ein. So konnte ich meine anfängliche Idee in die tat umsetzen. Mein Bruder Mario und ich gründeten den SantoS Verlag. Ich überarbeitete meinen von mir viel geliebten titel mit Begeisterung und suchte zu allen themen Bil- der, Briefe und Fotos aus meinem Leben zusammen. Und so halten Sie nun dieses überarbeitete Werk als taschenbuch in Ihren Händen. Da ich sehr viel auf Rei- sen bin, weiß ich, wie angenehm handliche Bücher sind. -

THE EXPEDITIONS of the VICTOR TALKING MACHINE COMPANY THROUGH LATIN AMERICA, 1903-1926 a Dissertation
RECORDING STUDIOS ON TOUR: THE EXPEDITIONS OF THE VICTOR TALKING MACHINE COMPANY THROUGH LATIN AMERICA, 1903-1926 A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy By Sergio Daniel Ospina Romero May 2019 © 2019 Sergio Daniel Ospina Romero ii RECORDING STUDIOS ON TOUR: THE EXPEDITIONS OF THE VICTOR TALKING MACHINE THROUGH LATIN AMERICA, 1903-1926 Sergio Daniel Ospina Romero, PhD Cornell University, 2019 During the early twentieth century, recording technicians travelled around the world on behalf of the multinational recording companies. Producing recordings with vernacular repertoires not only became an effective way to open local markets for the talking machines that these same companies were manufacturing. It also allowed for an unprecedented global circulation of local musics. This dissertation focuses on the recording expeditions lead by the Victor Talking Machine Company through several cities in Latin America during the acoustic era. Drawing from untapped archival material, including the daily ledgers of the expeditions, the following pages offer the first comprehensive history of these expeditions while focusing on five areas of analysis: the globalization of recorded sound, the imperial and transcultural dynamics in the itinerant recording ventures of the industry, the interventions of “recording scouts” for the production of acoustic records, the sounding events recorded during the expeditions, and the transnational circulation of these recordings. I argue that rather than a marginal side of the music industry or a rudimentary operation, as it has been usually presented hitherto in many histories of the phonograph, sound recording during the acoustic era was a central and intricate area in the business; and that the international ventures of recording companies before 1925 set the conditions of possibility for the consolidation of iii media entertainment as a defining aspect of consumer culture worldwide through the twentieth century. -

Lykke Li Discography Download Torrent Lykke Li Discography Download Torrent
lykke li discography download torrent Lykke li discography download torrent. SwatzellWertsapre: Free Muse mp3 - The 2nd Law (2012) rockbox download torrent to your pc or mobile. - Fast and reliable file torrent hosting search engine! Download free: The 2nd Law is the sixth studio album by English alternative rock band Muse, released throughout. Adobe Muse CC 2020 Crack for Mac OS Torrent Free Download. oliverwarren325: Adobe Muse CC 2020 Crack for mac is a complete development kit that allows users to develop powerful, attractive, and funky looking websites. everyone deserves music: Muse - The Resistance (2009) jedediahstevens7: everyone deserves music: Muse - The Resistance (2009).muse the resistance 2009 emotion,torrent search,zane lowe, Muse Bizzare Festival. annidevol: Muse Discography - ombined results from multile torrent sources. Super Muse-The Resistance-Real Proper (2009) Full. oiuojih: Here�s the Real Proper version of the for the new Muse album! Here�s the Real Proper version of the for the new Muse album! Undoubtedly one the most anticipated rock albums of 2009, the l. RS Muse - The Resistance (2009)@320kbps Depositfiles. habibab: Be absorbed in thought - The Guerrillas (2009)@320kbps Quote: Genre: In ruins / Mp3 sound / VBR / CBR 44,1kHz / 118 Mb 1 "Uprising" The Twilight Saga – New Moon OST - download album from torrent. muzikrand: Band Of Skulls - Friends Death Cab For Cutie - Meet Me On The Equinox Lykke Li - Possibility Anya Marina - Satellite Heart Muse - I Belong To You (New Moon Remix) Thom Yorke - Hearing Damage The Killers - A White Demon Love Song. Dvd muse paris 039 07 » Rapidshare Megaupload Free Downloads Torrent Forum File video movies clip dvd rip avi xvid rar music songs remix album mp3 movies codec player crack key serial keygen windows. -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Lage, Analyse und Perspektive österreichischer Musiker im Forschungsfeld der FM4 Charts 2011 unter Berücksichtigung deutscher und/oder englischer Texte. Verfasser Roland Maurer angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof. Mag. Dr. Regine Allgayer-Kaufmann 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ……………………........…...……………………………...... 4 2. Problemstellung und Erkenntnisinteresse …....…………………….... 7 2.1. Forschungsfragen ….......…………………………………………...... 9 2.2. Forschungshypothesen …………………………………………….... 9 2.3. Erhebungsgegenstand ……………………………………….………. 10 2.4. Stand der Forschung …………………………………………………. 11 THEORETISCHE VERANKERUNG 3. IFPI Austria Musikbericht 2011 …............................……………….... 13 4. Forschungsfeld Radio FM4 ………………………………………….... 17 4.1 Musikauswahl, Marktsituation, FM4 Charts ………………………... 19 4.2. Position, Sprache, Formate …………………………………............. 21 4.3. Auftrag, HörerInnen, Radio FM4 Off Air ………………................... 22 4.4. FM4 Radio Sessions, FM4 Überraschungskonzerte, FM4 Soundpark 23 Exkurs 1: Jugendkultur ……………………………………………………....... 25 Exkurs 2: Independent vs. Popularmusik ………………………………........ 26 5. Sprache in der Musik ………………………………………………...... 33 6. Bandscout ……………………………………………………................ 35 6.1. Rahmenbedingungen, die sich von Bandscout ableiten …........... 36 6.1.1. Anzahl der Live-Konzerte ! Booking ……………………… 36 6.1.2. Größe -

Christian Gerhaher, Baritone Gerold Huber, Piano
Tuesday, October 29, 2019 at 7:30 pm Mahler Songs Christian Gerhaher, Baritone Gerold Huber, Piano ALL-MAHLER PROGRAM Lieder eines fahrenden Gesellen (1883–85) Wenn mein Schatz Hochzeit macht Ging heut’ morgen übers Feld Ich hab’ ein glühend Messer Die zwei blauen Augen von meinem Schatz Selections from Des Knaben Wunderhorn (1887–1898) Wer hat dies Liedlein erdacht? Ablösung im Sommer Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald Um schlimme Kinder artig zu Machen Rheinlegendchen Der Schildwache Nachtlied Intermission Please make certain all your electronic devices are switched off. This performance is made possible in part by the Josie Robertson Fund for Lincoln Center. Steinway Piano Alice Tully Hall, Starr Theater Adrienne Arsht Stage White Light Festival The White Light Festival 2019 is made possible by The Shubert Foundation, The Katzenberger Foundation, Inc., Mitsubishi Corporation (Americas), Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc., Laura Pels International Foundation for Theater, Culture Ireland, The Joelson Foundation, Sumitomo Corporation of Americas, The Harkness Foundation for Dance, J.C.C. Fund, Japanese Chamber of Commerce and Industry of New York, Great Performers Circle, Lincoln Center Patrons and Lincoln Center Members Endowment support is provided by The Andrew W. Mellon Foundation and the Blavatnik Family Foundation Fund for Dance Lead Support for Great Performers provided by PGIM, the global investment management business of Prudential Financial, Inc. Additional Support for Great Performers is provided by Rita E. and Gustave M. Hauser, The Shubert Foundation, The Katzenberger Foundation, Inc., Audrey Love Charitable Foundation, Great Performers Circle, Lincoln Center Patrons and Lincoln Center Members Endowment support for Symphonic Masters is provided by the Leon Levy Fund Endowment support is also provided by UBS Public support is made possible by the New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew M. -

Politics and Popular Culture: the Renaissance in Liberian Music, 1970-89
POLITICS AND POPULAR CULTURE: THE RENAISSANCE IN LIBERIAN MUSIC, 1970-89 By TIMOTHY D. NEVIN A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FUFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2010 1 © 2010 Timothy Nevin 2 To all the Liberian musicians who died during the war-- (Tecumsey Roberts, Robert Toe, Morris Dorley and many others) Rest in Peace 3 ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank my parents and my uncle Frank for encouraging me to pursue graduate studies. My father’s dedication to intellectual pursuits and his life-long love of teaching have been constant inspirations to me. I would like to thank my Liberian wife, Debra Doeway for her patience in attempting to answer my thousand and one questions about Liberian social life and the time period “before the war.” I would like to thank Dr. Luise White, my dissertation advisor, for her guidance and intellectual rigor as well as Dr. Sue O’Brien for reading my manuscript and offering helpful suggestions. I would like to thank others who also read portions of my rough draft including Marissa Moorman. I would like to thank University of Florida’s Africana librarians Dan Reboussin and Peter Malanchuk for their kind assistance and instruction during my first semester of graduate school. I would like to acknowledge the many university libraries and public archives that welcomed me during my cross-country research adventure during the summer of 2007. These include, but are not limited to; Verlon Stone and the Liberian Collections Project at Indiana University, John Collins and the University of Ghana at East Legon, Northwestern University, Emory University, Brown University, New York University, the National Archives of Liberia, Dr. -

Catalogue a ‐ Z
Catalogue A ‐ Z A ? MARK AND MYSTERIANS "Same" LP CAMEO 1966 € 60 (US Garage‐Original Canada Pressing VG++++/VG+) 007 & SCENE " Landscapes" LP Detour € 12 (UK mod‐beat ' 70/ ' 80) 1‐2‐5 “Same” LP Misty lane € 13 (Garage punk dall’Olanda) 13th FLOOR ELEVATORS "Easter every Where" CD Spalax € 15,00 ('60 US Psych) 13th FLOOR ELEVATORS "Graeckle Debacle" CD Spalax € 15,00 ('60 US Psych) 13th FLOOR ELEVATORS "The Psychedelic Sound Of…" CD Spalax € 15,00 ('60 US Psych) 13th FLOOR ELEVATORS "Unlock the Secret" CD Spalx € 15,00 ('66 US Psych) 20/20 "Giving It All" 7" LINE 1979 € 15 (US Power Pop) 27 DEVILS JOKING "The Sucking Effect" LP RAVE 1991 € 10 (US Garage VG/M‐) 3 NORMAL BEATLES "We Name Is Justice" DLP BUBACK € 23 (Beat from Germany) 39 CLOCKS "Cold Steel To The Heart " LP WHAT'S SO FUNNY ABOUT 1985 € 35 (Psychedelic Wave from Germany) 39 CLOCKS "Subnarcotic" LP WHAT'S SO FUNNY ABOUT 1982 € 35 (Psychedelic Wave from Germany 1988 Reissue) 39 CLOCKS "The Original Psycho Beat" LP WHAT'S SO FUNNY ABOUT 1993 € 20 (Psychedelic Wave from Germany) 3D INVISIBLES "Robot Monster" 7" NEUROTIC BOP 1994 € 5 (US Punk Rock) 3D INVISIBLES "They Won't StayDead" LP NEUROTIC BOP 1989 € 15 (US Punk Rock) 440’S “Gas Grass Or As” 7” Rockin’ Bones € 5 (US Punk) 5 LES “Littering..” 7” HAGCLAND 198? € 5 (Power Pop dal Belgio M‐/M‐) 5.6.7.8.'S "Can't Help It !" CD AUGOGO € 14 (Japan Garage i 7"M‐/M) 5.6.7.8's "Sho‐Jo‐Ji" 7" THIRD MAN € 9 (Garage Punk from Tokyo) 60 FT DOLLS "Afterglow" 7" DOLENT € 3 (Promo Only) 64 SPIDERS "Potty Swat" 7" REGAL SELECT 1989 € 17 (US Punk M‐/M‐) 68 COMEBACK "Do The Rub" 7" BAG OF HAMMERS 1994 € 7 (US Punk Blues) 68 COMEBACK "Flip,Flop,& Fly" 7" GET HIP 1994 € 13 (US Punk Blues) 68 COMEBACK "Great Million Sellers" 7" 1+2 1994 € 8 (US Punk Blues) 68 COMEBACK "High Scool Confidential" 7" PCP I. -

Manual of Analogue Sound Restoration Techniques
MANUAL OF ANALOGUE SOUND RESTORATION TECHNIQUES by Peter Copeland The British Library Analogue Sound Restoration Techniques MANUAL OF ANALOGUE SOUND RESTORATION TECHNIQUES by Peter Copeland This manual is dedicated to the memory of Patrick Saul who founded the British Institute of Recorded Sound,* and was its director from 1953 to 1978, thereby setting the scene which made this manual possible. Published September 2008 by The British Library 96 Euston Road, London NW1 2DB Copyright 2008, The British Library Board www.bl.uk * renamed the British Library Sound Archive in 1983. ii Analogue Sound Restoration Techniques CONTENTS Preface ................................................................................................................................................................1 Acknowledgements .............................................................................................................................................2 1 Introduction ..............................................................................................................................................3 1.1 The organisation of this manual ...........................................................................................................3 1.2 The target audience for this manual .....................................................................................................4 1.3 The original sound................................................................................................................................6 -

Billboard Magazine
Pop's princess takes country's newbie under her wing as part of this season's live music mash -up, May 31, 2014 1billboard.com a girl -powered punch completewith talk of, yep, who gets to wear the transparent skirt So 99U 8.99C,, UK £5.50 SAMSUNG THE NEXT BIG THING IN MUSIC 200+ Ad Free* Customized MINI I LK Stations Radio For You Powered by: Q SLACKER With more than 200 stations and a catalog of over 13 million songs, listen to your favorite songs with no interruption from ads. GET IT ON 0)*.Google play *For a limited time 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung and Milk Music are both trademarks of Samsung Electronics Co. Ltd. Appearance of device may vary. Device screen imagessimulated. Other company names, product names and marks mentioned herein are the property of their respective owners and may be trademarks or registered trademarks. Contents ON THE COVER Katy Perry and Kacey Musgraves photographed by Lauren Dukoff on April 17 at Sony Pictures in Culver City. For an exclusive interview and behind-the-scenes video, go to Billboard.com or Billboard.com/ipad. THIS WEEK Special Double Issue Volume 126 / No. 18 TO OUR READERS Billboard will publish its next issue on June 7. Please check Billboard.biz for 24-7 business coverage. Kesha photographed by Austin Hargrave on May 18 at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. FEATURES TOPLINE MUSIC 30 Kacey Musgraves and Katy 5 Can anything stop the rise of 47 Robyn and Royksopp, Perry What’s expected when Spotify? (Yes, actually.) Christina Perri, Deniro Farrar 16 a country ingenue and a Chart Movers Latin’s 50 Reviews Coldplay, pop superstar meet up on pop trouble, Disclosure John Fullbright, Quirke 40 “ getting ready for tour? Fun and profits. -

Annu Annual Report 2010
KEY FIGURES 2006 – 2010 2010 Report Annual Group RTL THE LEADING EUROPEAN ENTERTAINMENT NETWORK RTL Group +11.5 % EVERYWHERE. (2010: +63.2 %) EVERYONE. FOR INDEX = 100 TV & RADIO RADIO & TV SHARE PRICE PERFORMANCE 2006 – 2010 DJ STOXX – 19.6 % (2010: +13.3 %) what they watch or listen to – how, and why. and how, – to listen or watch they what ( ) ( ) REVENUE € million MARKET CAPITALISATION € billion out find can you Report Annual this Throughout 10 5,591 10 11.9 companies. Group RTL from broadcasts or 09 5,156* 09 7.3 productions enjoying world, the * Re-presented following the 2010 08 5,774 08 6.6 over all people asked we why, out find To application of 5,707 IFRS 5 to Five 07 07 12.5 REPORT ANNUAL (discontinued 06 5,640 operations) 06 13.1 +8.4 % +63.2 % family. or friends with still love live broadcasts, broadcasts, live love still Above all though, people people though, all Above EBITA (€ million) TOTAL DIVIDEND PER SHARE (€) 10 1,111 10 5.00 09 796* 09 3.50 convenience. their at shows * Re-presented 08 916 following the 08 3.50 application of radio replay or podcasts 07 898 IFRS 5 to Five 07 5.00 (discontinued 06 851 operations) 06 3.00 Dividend payout 2006 – 2010: € 3.1 billion download can Listeners +39.6 % devices. mobile or internet or watch them on the the on them watch or (€ million) 1 (€) EQUITY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE moments, favourite their 10 5,597 10 4.23 replay or pause can Viewers 09 5,530 09 2.85 08 5,871 08 3.87 digitisation. -
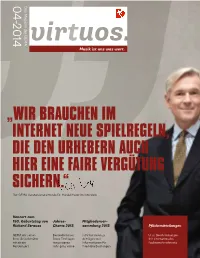
Virtuos 04/2014
04-2014 Das Magazin der GEMA Das Magazin Musik ist uns was wert. „WIR BRAUCHEN IM INTERNETDer GEMA-Vorstandsvorsitzende Dr. Harald NEUE Heker im Interview SPIELREGELN, DIEKonzert zum DEN URHEBERN AUCH 150. Geburtstag von Jahres- Mitgliederver- Richard Strauss Charts 2013 sammlung 2015 Pflichtmitteilungen HIERGEMA ehrt einen EINEBestsellerlisten: FAIREInformationen VERGÜTUNG zu U. a.: Beschränkungen ihrer Gründerväter Diese Titel lagen Anträgen und der internationalen mit einem vergangenes Informationen für Rechtewahrnehmung SICHERN.“Festkonzert Jahr ganz vorne Ihre Hotelbuchungen editorial Liebe Leserinnen und Leser, die letzte virtuos-Ausgabe eines Jahres bietet immer eine gute Gelegenheit, die vergangenen zwölf „GEMA-Monate“ noch ein- mal Revue passieren zu lassen, aber auch schon den Blick nach vorn zu richten. Wir wünschen allen 2014 war ein Richard-Strauss-Jahr – auch für die GEMA. Er als einer der Grün- derväter unserer Verwertungsgesellschaft hätte am 11. Juni seinen 150. Ge- burtstag gefeiert. Das, wofür Strauss neben seinem herausragenden Wirken Lesern eine frohe als Komponist auch steht – nämlich eine Balance zwischen Musikschaffen und einer angemessenen Vergütung dafür zu gewährleisten –, hat heute im digitalen Zeitalter keineswegs an Aktualität verloren, eher im Gegenteil. Wir in der GEMA engagieren uns leidenschaftlich dafür, die Stellung der Musikautoren in der Ge- Weihnachtszeit und alles sellschaft zu sichern und den Wert der Musik deutlich zu machen. Dabei stimmt es uns hoffnungsvoll, dass die öffentliche Diskussion ebenso wie die Vorhaben von politischer Seite sichtlich in eine Richtung weisen, die durchaus im Sinne der Urheber ist. Die für 2016 geplante Umsetzung der EU-Wahrnehmungsrichtlinie Gute für ein gesundes in nationales Recht wird dabei von besonderer Bedeutung sein. Foto: Florian Jaenicke Florian Foto: Für die GEMA war 2014 ein zukunftsweisendes Jahr.