Schwarz Die Wiederentdeckung.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2/1-Spaltig, Ohne Einrückungen
Der Nachlass von Wilhelm Lauer im Archiv des Geographischen Instituts Bonn Findbuch bearbeitet von Sabine KROLL und Jens Peter MÜLLER 2., um Nachträge erweiterte Fassung Bonn 2019 Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................................. II Vorwort .................................................................................................................................................... III Zur Biographie von Wilhelm Lauer ...................................................................................................... III Hinweise zum Nachlass Lauer und zur Benutzung ............................................................................. III 1 Lebensdokumente von Wilhelm Lauer .................................................................................................. 5 1.1 Privater und gesellschaftlicher Bereich .......................................................................................... 5 1.2 Beruflicher Bereich ......................................................................................................................... 6 1.2.1 Wilhelm Lauer als Wissenschaftler ......................................................................................... 6 1.2.2. Wilhelm Lauer in Leitungsfunktionen ................................................................................... 16 1.2.3 Wilhelm Lauer als Gutachter ................................................................................................ -

WDA-Leistungsbericht 2015
LEISTUNGSBERICHT 2015 GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN. 1 INHALT Vorwort 3 Mission 5 Mitglieder 6 THEMEN DES JAHRES Netzwerk mit Weitblick: WDA-Zukunftskonferenz 8 Themen, die das Jahr bestimmten: Rückblick 2015 12 Gesagt, getan, beziffert: Zahlen und Zitate 16 „Wir werden gebraucht“: Interview mit Detlef Ernst 18 Innovativ bleiben: Interview mit Rudolf Kumbolder 21 LEISTUNGEN DES VERBANDS Service-Palette des WDA: Leistungen im Überblick 23 Im Dialog: Mitgliederstimmen zur Verbandsarbeit 24 Von Seoul bis Mailand: Veranstaltungen 2015 25 Fortbilden, versichern, IT: Leistungen im Fokus 29 ENTWICKLUNGEN DES NETZWERKS Balance halten: Strategie, Ziele und Projekte 34 Panorama: durchs Jahr mit dem WDA 36 Transparenz zählt: Eckdaten zur Verbandsarbeit 39 NETZWERK UND TEAM Vielfältiges Netzwerk: Partner des WDA 42 Weltweit im Einsatz: der Vorstand im Porträt 48 Team Berlin: die Geschäftsstelle im Porträt 50 ZUKUNFT TRAGEN UND GESTALTEN – STIMMEN DER SCHUlvORSTÄNDE Mauritius Reisky von Dubnitz, São Paulo 5 Dr. Eva Häußling, Stockholm 22 Martin Schüller, Athen 33 Gabriele Bunzel Khalil, Beirut 41 Wolfgang Selzer, Pretoria 47 Joachim Stickel, Sydney 51 Impressum 52 2 VORWORT ZUKUNFT GESTALTEN, AUSTAUSCH FÖRDERN Liebe Leserin, lieber Leser, gemeinsam Zukunft tragen, das ist der Leitsatz des Welt- Die WDA-Tagung mit Symposium in Berlin erwies sich verbands Deutscher Auslandsschulen. Dafür steht unser 2015 erneut als die zentrale Veranstaltung, um sich zum Netzwerk, dafür engagieren sich die Schulen weltweit. Auslandsschulwesen auszutauschen. Am Symposium nah- Jede dieser Schulen leistet durch ihr Bildungsangebot ei- men hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Bildung nen wichtigen Beitrag. Das Leben, Lernen und Arbeiten an und Kultur teil. Schwerpunkte der Tagung waren die Re- den Auslandsschulen prägt die Menschen in ihrem Um- form der Lehrerbesoldung und die Frage, wie sich das feld, ob Schüler, Eltern, Lehrkraft oder Vorstand. -
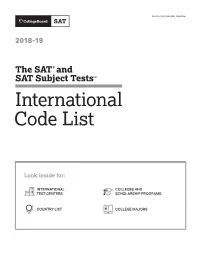
2018-19 SAT International Code List
OFFICE COPY-DO NOT REMOVE. 2018-19 The SAT® and SAT Subject Tests™ International Code List Look inside for: INTERNATIONAL COLLEGES AND TEST CENTERS SCHOLARSHIP PROGRAMS COUNTRY LIST COLLEGE MAJORS Using this Code List Booklet This reference is intended for the counseling or SAT® International Representative’s office, where it can be used by anyone who needs to submit a paper registration for the SAT, the SAT with Essay, or the SAT Subject Tests™. See the back cover for the 2018-19 test calendar and fees. Important Note: The code list is updated regularly, and test center availability is subject to change. Please visit collegeboard.org/sat-codes for the latest information on test centers that may be available in your area. Page Type of Codes Description Area on SAT Registration Form 3 Country Codes Three-digit code Item 9b – Supply the country code corresponding to your address. 4 International Test Center Five-digit code Item 20 – Supply two codes to Codes designate first choice and second choice center. 8 College and Scholarship Four-digit code Items 21a and 21b – Supply up to Program Codes eight codes to designate which institutions should receive score reports. Indicate any fees owed in Item 21c. 19 College Majors by Academic Three-digit code Item 13, Questions 17–19, Choice of Area of Study Majors – Supply up to three choices of majors to possibly pursue in college. • Visit sat.org/practice to check out our free resources for the SAT, in particular: – Our mobile app – Khan Academy® practice and instructions • Visit SATSubjectTests.org for SAT Subject Test information and practice. -

20 Años Arquitectura + Administración + Urbanismo
20 AÑOS ARQUITECTURA + ADMINISTRACIÓN + URBANISMO Este CV EXTENSO se presenta una parte del trabajo profesional realizado durante 20 AÑOS, combinando integralmente la Práctica Profesional (Proyecto y Obra), la Docencia y la Investigación (Administración, Arquitectura, Construcción, Derechos Humanos, Desarrollo Empresarial, Economía, Hospitalidad, Mercadotecnia, Turismo, Urbanismo). DATOS PERSONALES___________________________________________ Nombre: CUAUHTEMOC PERSEO LOPEZ HERRERA Lugar de nacimiento: ACAPULCO, GUERRERO Fecha de nacimiento: 12 DE NOVIEMBRE DE 1973 Edad: 43 AÑOS Cédula profesional de Arquitecto: 2 440 105 Expedida el 24 de marzo de 1997. Duplicado el 07 de marzo de 2001. Examen Recepcional de Maestría en Administración: 10 de enero de 2006. Con Mención Honorifica. Cédula de Grado de Maestro en Administración: 5 875 125 Expedida el 05 de marzo de 2009. Examen de Candidato a Doctor en Urbanismo: 06 de marzo de 2012. Currículum Vitae / Cuauhtémoc Perseo López Herrera. 2 1 FORMACIÓN PROFESIONAL 2 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 3 EXPERIENCIA PROFESIONAL 4 EXPERIENCIA PROFESIONAL ACADÉMICA 5 ASPIRANTE A RECTOR 6 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 7 INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 8 ACTIVIDAD GREMIAL 9 ANEXOS Currículum Vitae / Cuauhtémoc Perseo López Herrera. 3 1 FORMACIÓN PROFESIONAL Currículum Vitae / Cuauhtémoc Perseo López Herrera. 4 LICENCIATURA________________________________________________ ARQUITECTURA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM). UNIDAD AZCAPOTZALCO. DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO (CyAD). La División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) se compone de las licenciaturas en Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial. Los tres primeros trimestres (tronco común) se cursan materias con estudiantes de las tres carreras. Periodo: 1991 - 1996 Dirección: México, D.F. Cargo Estudiantil La planilla Escala 1:1 se llevó a cabo la contienda electoral, representando al turno vespertino. -

BEGEGNUNG 2/2009: Deutschland
2 -2009 BEGEGNUNG 30. Jahrgang DEUTSCHE SCHULISCHE ARBEIT IM AUSLAND Deutschland – die neue Mitte Alumni VIP Inland Fokus – 60 Jahre BRD Jasmin Tabatabai: Von der Humoristischer Grenzgänger: Wie hat sich das Schul- DS Teheran zum Film Dieter Nuhr im Interview system in dieser Zeit Teach First Deutschland entwickelt? Ausland ZfA-Schreibwettbewerb Premiere in Frankreich: Erste Länderdossier USA: 20 Jahre Mauerfall DSD-Prüfung in Braille-Schrift Deutsche Schulen in Mexiko – Schüler werden kreativ Köln 50° 55‘ N 6° 57‘ E Editorial Ein Jahr voller runder Geburtstage 2009 ist ein besonderes Jahr. Charles Darwin, Abraham Lincoln und Felix Mendelssohn-Bartholdy wären im Februar 200 Jahre alt geworden. In diesem Jahr runden sich außerdem die Todestage von Georg Friedrich Händel (250.), Josef Haydn (200.), Alexander von Humboldt (150.) und Friedrich Schiller (250.). Aber auch die Bundesrepublik Deutschland feiert: 60 Jahre Grundgesetz, 20 Jahre Mauerfall, zwei wichtige Ereignisse, die das Land und die Menschen verändert haben. Grund genug für uns, den Schwerpunkt des Heftes auf „Deutschland – die neue Mitte“ zu legen. Eine aktuelle Umfrage der Konrad- Adenauer-Stiftung schafft dabei Klarheit: Zwei Drittel der Befragten sind stolz auf die Bundesrepublik von heute, rund 90 Prozent bewerten die Entwicklung seit 1949 als Erfolgsgeschichte. Wir haben das Jubiläum zum Anlass genommen, um im Fokus die Entwicklung des Schulsystems von den Anfängen nach dem Ende des NS-Regimes bis zum PISA-Schock und seinen Folgen nachzuzeichnen. Wie hat sich Schule verändert und was ist vom Schulsystem der DDR übrig geblieben? 2009 jährt sich auch der Geburtstag von Louis Braille, dem Erfinder der Blinden- schrift, zum 200. Mal. -

Lucio Muniain Arquitecto Curriculum Vitae 2020
LUCIO MUNIAIN ARQUITECTO CURRICULUM VITAE 2020 DATOS PERSONALES Nombre Lucio Muniain Compañía LUCIO MUNIAIN et al ARQUITECTURA + URBANISMO Profesión Arquitecto Cédula Profesional 3945870 Socio CAM-SAM 5010.18 Dirección Marsella 53, Segundo Piso Colonia Juárez 06600 CDMX, México Oficina 22301740 Celular 5555075390 Facebook www.facebook.com/LMetal Email [email protected] [email protected] Web www.lmetal.com.mx Nacionalidad Mexicana, México D.F. Fecha de Nacimiento 13 Febrero 1969 Profesional 1988-1992 Arquitectura y Urbanismo, Universidad Iberoamericana, México 1991 Architectural Design, Parsons School of Design, New York, NY 1997-1998 Maestría en Proyectos para Desarrollo Urbano Universidad Iberoamericana, México LUCIO MUNIAIN (Ciudad de México, 1969) Estudia Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Iberoamericana y en Parsons School of Design en Nueva York de 1988 a 1992. Maestría en Desarrollo Urbano en la Universidad Iberoamericana de 1996 a 1998. Práctica independiente en LUCIO MUNIAIN et al desde 1998. Entre sus proyectos más destacados están el Corporativo Autofin (Edificio de Oficinas de 40,000 M2), Proyecto Bahía Balandra en La Paz Baja California Sur (Plan Maestro de Ciudad para 20,000 Habitantes en primera fase, con Rick Joy, Mathias Klotz, Rem Koolhaas y Nieto & Sobejano entre otros), el Tercer Lugar Nacional para la nueva Sede del Senado de la República y el Primer Lugar para la Nueva Sede para la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Carácas, Venezuela, Concurso Internacional por Invitación (en colaboración con PRODUCTORA), en 2017 fue comisionado con el proyecto para la remodelación de la Plaza de la Constitución (El Zócalo) en la CDMX. En 2019 gana el concurso con Bosco Gutiérrez Cortina y Andrés Casillas para la remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. -

Enrique Palou García I.2 Lugar De Trabajo: Universidad De Las Américas, Puebla
CURRICULUM VITAE IN EXTENSO I. DATOS PERSONALES I.1 Nombre: Enrique Palou García I.2 Lugar de trabajo: Universidad de las Américas, Puebla. Cholula, Puebla 72810, México I.3 Teléfonos de trabajo: +52 (222) 229-2658/ 229-2409/ 229-2126 I.4 E-mail: [email protected] I.5 Sitios en Internet: http://enriquepalou.wordpress.com, http://web.udlap.mx/enriquepalou I.6 Nombramiento: Profesor de tiempo completo (nivel Catedrático) I.7 Fecha de ingreso: 1 de Abril de 1992 I.8 SNI: Investigador Nacional Nivel III (1998-2018) Curriculum Vitae de Enrique Palou II. ESCOLARIDAD II.1 Profesional Licenciatura en Ingeniería Química II.1.1 Lugar: Universidad Iberoamericana, D.F. II.1.2 Grado obtenido: Ingeniero Químico II.1.3 Fecha: 8 de Septiembre de 1989 II.1.4 Promedio: 8.6/10 II.1.5 Tesis: Antología comentada sobre Ingeniería de Procesos II.1.6 Título: Nº 9162 II.1.7 Cédula Profesional: Nº 1450346 II.2 Posgrado 1. Maestría en Ciencias (especialidad en Ingeniería en Alimentos) II.2.1.1 Lugar: Universidad de las Américas, Puebla II.2.1.2 Grado obtenido: Maestro en Ciencias II.2.1.3 Fecha: 2 de Junio de 1992 II.2.1.4 Promedio: 9.4/10 II.2.1.5 Tesis: Evaluación de la Transferencia de Masa durante la Deshidratación Osmótica de Fruta II.2.1.6 Cédula Profesional: Nº 2079358 II.2.1.7 Distinciones: 1er estudiante Maestro en Ciencias de la Universidad de las Américas, Puebla 2. Doctorado (especialidad en Ingeniería en Alimentos) II.2.2.1 Lugar: Washington State University II.2.2.2 Grado obtenido: Ph.D. -

Jahrbuch Des Auslandsschulwesens 2004/20022004/2005004/2005
Jahrbuch des Auslandsschulwesens 2004/20022004/2005004/2005 Herausgegeben vom ❖ Zum Artikel: Vorwort ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 Auf den Eintrag im Inhaltsverzeichnis klicken Joachim Lauer, Leiter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zurück ❖ Neue Chancen für deutsche Auslandsschulen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4 zum Inhaltsverzeichnis: auf die Seitenzahl Peter Dettmar, Leiter des Schulreferates im Auswärtigen Amt des aktuellen Beitrages klicken ❖ Herausragende kulturpolitische Ereignisse ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 Tschechische Republik: Eine ganz besondere Erfolgsgeschichte ❖ Argentinien: Anne Frank – eine Geschichte für heute ❖ „El vigente espíritu de Ana Frank