Die Deutsche Ostsiedlung Zwischen Elbe Und Spree
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bischofswerda the Town and Its People Contents
Bischofswerda The town and its people Contents 0.1 Bischofswerda ............................................. 1 0.1.1 Geography .......................................... 1 0.1.2 History ............................................ 1 0.1.3 Sights ............................................. 2 0.1.4 Economy and traffic ...................................... 2 0.1.5 Culture and sports ....................................... 3 0.1.6 Partnership .......................................... 3 0.1.7 Personality .......................................... 3 0.1.8 Notes ............................................. 4 0.1.9 External links ......................................... 4 0.2 Großdrebnitz ............................................. 4 0.2.1 History ............................................ 4 0.2.2 People ............................................ 5 0.2.3 Literature ........................................... 6 0.2.4 Footnotes ........................................... 6 0.3 Wesenitz ................................................ 6 0.3.1 Geography .......................................... 6 0.3.2 Touristic Attractions ..................................... 6 0.3.3 Historical Usage ....................................... 7 0.3.4 Fauna ............................................. 7 0.3.5 References .......................................... 7 1 People born in or working for Bischofswerda 8 1.1 Abd-ru-shin .............................................. 8 1.1.1 Life, Publishing, Legacy ................................... 8 1.1.2 Legacy -

Qualitative Changes in Ethno-Linguistic Status : a Case Study of the Sorbs in Germany
Qualitative Changes in Ethno-linguistic Status: A Case Study of the Sorbs in Germany by Ted Cicholi RN (Psych.), MA. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Political Science School of Government 22 September 2004 Disclaimer Although every effort has been taken to ensure that all Hyperlinks to the Internet Web sites cited in this dissertation are correct at the time of writing, no responsibility can be taken for any changes to these URL addresses. This may change the format as being either underlined, or without underlining. Due to the fickle nature of the Internet at times, some addresses may not be found after the initial publication of an article. For instance, some confusion may arise when an article address changes from "front page", such as in newspaper sites, to an archive listing. This dissertation has employed the Australian English version of spelling but, where other works have been cited, the original spelling has been maintained. It should be borne in mind that there are a number of peculiarities found in United States English and Australian English, particular in the spelling of a number of words. Interestingly, not all errors or irregularities are corrected by software such as Word 'Spelling and Grammar Check' programme. Finally, it was not possible to insert all the accents found in other languages and some formatting irregularities were beyond the control of the author. Declaration This dissertation does not contain any material which has been accepted for the award of any other higher degree or graduate diploma in any tertiary institution. -

Land Use Effects and Climate Impacts on Evapotranspiration and Catchment Water Balance
Institut für Hydrologie und Meteorologie, Professur für Meteorologie climate impact Q ∆ ∆ E ● p basin impact ∆Qobs − ∆Qclim P ● ● ● P ● ● ● ●● ●● ● ●● ● −0.16 ●●● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●● ●●●●● ● ●●● ●● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●●●● U −0.08 ● ● ●● ●● ●●● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● ∆ ● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●● ●● ● ● ●●●●●● ● ●●●● ●● ●●●● ●●● ● ●●●● ● ● 0 ● ●● ● ●●●●● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●●●●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ●● ●● ●●● ●●● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● 0.08 ● ● ●●● ●●● ●●● ● ●● ● ●●●● ● ● ● ● ●●● ●●●● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0.16 ● ● ●● ●● ● ●●● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● climate impact ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● Q ● ● ● ●● ● ● ● ● ● − ∆ ● ● ● ● ● ●● − ∆ ● ● ● E ● ● p basin impact ● P −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 ∆W Maik Renner● Land use effects and climate impacts on evapotranspiration and catchment water balance Tharandter Klimaprotokolle - Band 18: Renner (2013) Herausgeber Institut für Hydrologie und Meteorologie Professur für Meteorologie Tharandter Klimaprotokolle http://tu-dresden.de/meteorologie Band 18 THARANDTER KLIMAPROTOKOLLE Band 18 Maik Renner Land use effects and climate impacts on evapotranspiration and catchment water balance Tharandt, Januar 2013 ISSN 1436-5235 Tharandter Klimaprotokolle ISBN 978-3-86780-368-7 Eigenverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden Vervielfältigung: reprogress GmbH, Dresden Druck/Umschlag: reprogress GmbH, Dresden Layout/Umschlag: Valeri Goldberg Herausgeber: Christian Bernhofer und Valeri Goldberg Redaktion: Valeri Goldberg Institut für -

Pedigree of the Wilson Family N O P
Pedigree of the Wilson Family N O P Namur** . NOP-1 Pegonitissa . NOP-203 Namur** . NOP-6 Pelaez** . NOP-205 Nantes** . NOP-10 Pembridge . NOP-208 Naples** . NOP-13 Peninton . NOP-210 Naples*** . NOP-16 Penthievre**. NOP-212 Narbonne** . NOP-27 Peplesham . NOP-217 Navarre*** . NOP-30 Perche** . NOP-220 Navarre*** . NOP-40 Percy** . NOP-224 Neuchatel** . NOP-51 Percy** . NOP-236 Neufmarche** . NOP-55 Periton . NOP-244 Nevers**. NOP-66 Pershale . NOP-246 Nevil . NOP-68 Pettendorf* . NOP-248 Neville** . NOP-70 Peverel . NOP-251 Neville** . NOP-78 Peverel . NOP-253 Noel* . NOP-84 Peverel . NOP-255 Nordmark . NOP-89 Pichard . NOP-257 Normandy** . NOP-92 Picot . NOP-259 Northeim**. NOP-96 Picquigny . NOP-261 Northumberland/Northumbria** . NOP-100 Pierrepont . NOP-263 Norton . NOP-103 Pigot . NOP-266 Norwood** . NOP-105 Plaiz . NOP-268 Nottingham . NOP-112 Plantagenet*** . NOP-270 Noyers** . NOP-114 Plantagenet** . NOP-288 Nullenburg . NOP-117 Plessis . NOP-295 Nunwicke . NOP-119 Poland*** . NOP-297 Olafsdotter*** . NOP-121 Pole*** . NOP-356 Olofsdottir*** . NOP-142 Pollington . NOP-360 O’Neill*** . NOP-148 Polotsk** . NOP-363 Orleans*** . NOP-153 Ponthieu . NOP-366 Orreby . NOP-157 Porhoet** . NOP-368 Osborn . NOP-160 Port . NOP-372 Ostmark** . NOP-163 Port* . NOP-374 O’Toole*** . NOP-166 Portugal*** . NOP-376 Ovequiz . NOP-173 Poynings . NOP-387 Oviedo* . NOP-175 Prendergast** . NOP-390 Oxton . NOP-178 Prescott . NOP-394 Pamplona . NOP-180 Preuilly . NOP-396 Pantolph . NOP-183 Provence*** . NOP-398 Paris*** . NOP-185 Provence** . NOP-400 Paris** . NOP-187 Provence** . NOP-406 Pateshull . NOP-189 Purefoy/Purifoy . NOP-410 Paunton . NOP-191 Pusterthal . -
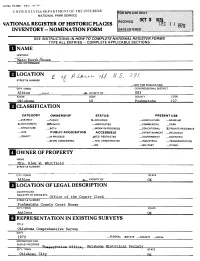
National Register of Historic Places Inventory -- Nomination Form
rnnNo. 10-300 REV. (9/77; UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR NATIONAL PARK SERVICE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES INVENTORY -- NOMINATION FORM SEE INSTRUCTIONS IN HOW TO COMPLETE NATIONAL REGISTER FORMS __________TYPE ALL ENTRIES -- COMPLETE APPLICABLE SECTIONS______ INAME HISTORIC "Mato/Kosvk/House___ ______________________________________ AND/ORTSOMMOfi LOCATION STREET & NUMBER _NOT FOR PUBLICATION CITY. TOWN CONGRESSIONAL DISTRICT Albion VICINITY OF 003 STATE CODE COUNTY CODE Oklahoma 40 Puffhmataha 127 CLASSIFICATION CATEGORY OWNERSHIP STATUS PRESENT USE _DISTRICT —PUBLIC X_OCCUPIED _AGRICULTURE —MUSEUM X-BUILDING(S) .2EPRIVATE —UNOCCUPIED —COMMERCIAL —PARK —STRUCTURE —BOTH —WORK IN PROGRESS —EDUCATIONAL 2LPRIVATE RESIDENCE —SITE PUBLIC ACQUISITION ACCESSIBLE —ENTERTAINMENT —RELIGIOUS —OBJECT —IN PROCESS —XYES: RESTRICTED —GOVERNMENT —SCIENTIFIC —BEING CONSIDERED —YES: UNRESTRICTED —INDUSTRIAL —TRANSPORTATION _NO —MILITARY —OTHER: OWNER OF PROPERTY NAME Mrs. Qlen W. Whltfleld STREET & NUMBER CITY. TOWN STATE Albion VICINITY OF OK LOCATION OF LEGAL DESCRIPTION COURTHOUSE. REGISTRY OF DEEDS.ETC. Office of the County Clerk STREET & NUMBER Pushmataha County Court House CITY, TOWN STATE Antlers OK REPRESENTATION IN EXISTING SURVEYS Oklahoma Comprehensive Survey DATE 1979 —FEDERAL JXSTATE —COUNTY —LOCAL DEPOSITORY FOR SURVEY RECORDS Oklahoma Historical Society CITY. TOWN STATE Oklahoma Citv OK DESCRIPTION CONDITION CHECK ONE CHECK ONE —EXCELLENT —DETERIORATED JiUNALTERED 2LORIGINALSITE X_GOOD _RUINS —ALTERED —MOVED DATE. —FAIR _UNEXPOSED DESCRIBE THE PRESENT AND ORIGINAL (IF KNOWN) PHYSICAL APPEARANCE The Mato Kosyk house is a small one-story, rectangular, white frame building located about three-quarters of a mile west of Albion on a gravel road. It is not entirely visible from the road, and access to it is by a private driveway leading south from the road, then west to the house lot. -

Wandervorschlag: Die Wanderung Entlang Der Wesenitz
Wandervorschlag: Die Wanderung entlang der Wesenitz Von der Quelle bis zur Mündung - Aus dem Granit durch den Sandstein in die Elbe Wandervorschlag von Roland Füssel, Helmsdorf Die Wesenitzquelle befindet sich im Granit des Hohwaldgebietes der Oberlausitz zwischen Neustadt in Sachsen, Steinigtwolmsdorf und Neukirch/Lausitz. Sie entspringt in 515 m über NN am Südhang des Valtenberges und mündet nach ca. 71 km bei Pratzschwitz in die Elbe. Dabei durchfließt sie bzw. berührt mit ihrem Lauf etwa 25 Ortschaften. Ihr Name stammt aus dem sorbischen und bedeutet „Bach der Ulme“. Mit der Wasserkraft wurden in der Vergangenheit über 100 Mühlen, Sägewerke und Schleifen betrieben. Heute existieren davon nur noch wenige, wurden zum Teil umgebaut oder sind dem Verfall preisgegeben. Gegenwärtig gibt es einige Objekte, die mit eingebauten Turbinen Strom erzeugen. Für die Wanderung bietet sich die Topographische Karte Blatt 42, 43 und 48 des Landesvermessungsamtes Sachsen an. Es steht eine verkehrsberuhigende Streckenführung im Vordergrund. Er führt mehr oder weniger direkt an der Wesenitz entlang. Bitte beachten Sie, dass die Strecke teilweise durch Naturschutzgebiete verläuft. An der Wesenitz lässt es sich zu jeder Jahreszeit gut wandern, außer bei Hochwasser. Zum Valtenberg gelangen wir u.a. von Neustadt in Sachsen (markierter Wanderweg blauer bzw. roter Strich) oder von Neukirch/Lausitz (grüner Strich) aus. Eine Bushaltestelle befindet sich an der Hohwaldschänke und auf markiertem Weg ist die Quelle nach ca. 3 km nicht sehr weit. Der Quellort, ein alter Stollen, im Volksmund auch als „Goldbergwerk“ bekannt, ist der Ausgangpunkt zum naheliegenden Gipfel des Valtenberges, mit der Baude (Gaststätte) und dem 22 m hohen Turm. Er bietet einen guten Rundblick in die Oberlausitz, das Zittauer Gebirge, ins Isergebirge, in die Sächsische Schweiz und dem Osterzgebirge. -

Assessment of TOPKAPI-X Applicability for Flood Events Simulation in Two Small Catchments in Saxony
hydrology Article Assessment of TOPKAPI-X Applicability for Flood Events Simulation in Two Small Catchments in Saxony Firas Al Janabi 1, Nurlan Ongdas 2,*, Christian Bernhofer 3, Julian David Reyes Silva 1 , Jakob Benisch 1 and Peter Krebs 1 1 Faculty of Environmental Sciences, Department of Hydrosciences, Institute of Urban Water Management, Technical University of Dresden, 01062 Dresden, Germany; fi[email protected] (F.A.J.); [email protected] (J.D.R.S.); [email protected] (J.B.); [email protected] (P.K.) 2 ON-Oekohydroprojekt, Aiteke bi 120400, Kazakhstan 3 Faculty of Environmental Sciences, Department of Hydrosciences, Institute of Hydrology and Meteorology, Chair of Meteorology, Technical University of Dresden, 01737 Tharandt, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected] Abstract: Numerical simulations of rainfall-runoff processes are useful tools for understanding hydrological processes and performing impact assessment studies. The advancements in computer technology and data availability have assisted their rapid development and wide use. This project aims to evaluate the applicability of a physically based, fully distributed rainfall-runoff model TOPKAPI-X for the simulation of flood events in two small watersheds of Saxony, Germany. The 2 results indicate that the model was calibrated well for 4.88 km Wernersbach catchment (NSE 0.89), whereas 276 km2 Wesenitz catchment calibration was only satisfactory (NSE 0.7). The addition of the Citation: Janabi, F.A.; Ongdas, N.; second soil layer improved the model’s performance in comparison to the simulations with only one Bernhofer, C.; Reyes Silva, J.D.; soil layer for Wernersbach (NSE increase from 0.83 to 0.89). -

Northern Kentucky University Board of Regents Materials
Northern Kentucky University Board of Regents Materials March 20, 2019 TABLE OF CONTENTS MATERIALS AGENDA March 20, 2019, Meeting Agenda ........................................................................................... 3 MINUTES January 16, 2019, Board Meeting Minutes ......................................................................... 4-13 PRESIDENTIAL REPORTS B-1) Facilities Management Report ................................................................................ 14-20 B-2) Research/Grants/Contracts Report (December 1, 2018 – January 31, 2019) ......... 21-22 B-3) Fundraising Report (July 1, 2018 – January 31, 2019) ............................................... 23 B-4) Quarterly Financial Report ..................................................................................... 24-35 B-5) Policies Report ............................................................................................................. 36 PRESIDENTIAL RECOMMENDATIONS C-1) Academic Affairs Personnel Actions ..................................................................... 37-57 C-2) Academic Affairs Reappointment, Promotion, and Tenure ................................... 58-62 C-3) Non-Academic Personnel Actions.......................................................................... 63-67 C-4) Major Gifts Acceptance .......................................................................................... 68-69 C-5) Naming Recommendations......................................................................................... -

Bohemian Rhapsody
Tour Code: 25710 BOHEMIAN RHAPSODY Grade 6 Holiday Duration: 15 days The beautiful Elbe Valley from Prague to HOLIDAY DATES 3th Jun 2018 - 17th Jun 2018, 17th Jun 2018 - 1st Jul 2018 Dresden. 1st Jul 2018 - 15th Jul 2018, 15th Jul 2018 - 29th Jul 2018 12th Aug 2018 - 26th Aug 2018, 9th Sept 2018 - 23rd Sept 2018 Since the 1790s travellers have been fascinated by the beauty, the unique and intriguing landscape, the cultural heritage of Saxon and Bohemian Switzerland. HOLIDAY HIGHLIGHTS Walk the 70 mile romantic Malerweg (Painters Trail). Visit Europe’s largest freestanding rock arch. Experience a glorious display of contrasting and breathtaking landscapes. Visiting two wonderful contrasting cities. BOHEMIAN RHAPSODY Through woods rich in ferns and mosses, across meadows, up fissures between pillars of eroded sandstone, the Malerweg, or Painters' Way, winds its way through Germany's Saxon Switzerland. From rocky viewpoints the meandering Elbe is often visible. You first see the river beneath Prague's Charles Bridge, where it is known as the Vltava. At the end of our journey you meet it once again in the neo-classical and Baroque splendour of Dresden. We follow the Malerweg in its entirety from our riverside base in Krippen adjacent to the resort of Bad Schandau. Throughout the trail's seventy miles, which we follow in eight stages, it is easy to see why great painters and musicians have found inspiration here. The unique jumble of rocks, the sweeping panoramas, the dampness of the forest floor, mists rising from the valleys; these are the very essence of the Romantic Movement. -

Zbigniew Rykiel the Cultural Liquidation of Lusatia in the Context of the European and German Integration
Zbigniew Rykiel The cultural liquidation of Lusatia in the context of the European and German integration Bulletin of Geography. Socio-Economic Series nr 4, 165-182 2005 BULLETIN OF GEOGRAPHY (SOCIO-ECONOMIC SERIES) NO. 4/2005 Zbigniew Rykiel University of Zielona Góra THE CULTURAL LIQUIDATION OF LUSATIA IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN AND GERMAN INTEGRATION BASIC CONCEPTS The concept of cultural liquidation, developed by K. Buchanan (1978), is set in a wider theoretical context. The concept of assimilation is one that has widely been applied, even though rarely defined, especially in geographical li terature. Generally, however, it can be recognised as a special case of the pro cess of social adaptation. Membership in specific social groups has widely been accepted as an indication of social adaptation. The notion of assimilation sug gests, in turn, that the adjustment of a minority group to the cultural pattern of the majority is considered. Assimilation of immigrant groups has especially been stressed, particularly of those ethnically peculiar (Kennedy, 1943; Price, Zu brzycki, 1962; Clarke, 1971; Peach, 1980). Assimilation is opposite to social integration, which implies a mutual adju stment of the minority and the majority in cultural, social, political or socio- spatial contexts. As a result, a new cultural pattern can be formed that includes some elements of both minority and majority cultural patterns (Rykiel, 2002). The practice of assimilation, on the contrary, has been based on the assumption that it is advantageous fof the minority to adapt to the majority’s more satisfy ing, prosperous and „civilised” way of life. The majority, identified with the dominant ethno-class, believes therefore the dominant culture should not be modified by any aspect of minority culture. -

Philip Earl Steele Homo Religiosus
Philip Earl Steele Homo religiosus : the phenomenon of Poland’s Mieszko I The full significance of Mieszko I’s decision to adopt Christianity in 966 has generally evaded Polish historiography. This is understandable regarding recent generations of Polish scholars, as the dogmas imposed during the country’s communist period had the effect of preserving the rationalist skepticism which Jacob Burckhardt, for instance, had applied in the mid-19 th c. toward understanding the conversion of Constantine the Great 1. That reductionist approach, often labeled “scientism” in Poland, dismisses the etiological power of religious beliefs and motives in history’s dynamics – and it was by and large rejected in Western scholarship roughly a century ago. 2 Yet as the medieval historian Richard Fletcher observed already a decade into the post-Cold War era, “This line of argument has held some appeal for historians of a Marxist inclination, of whom a few may still be encountered in remote places” 3. Polish historians might chuckle upon reading that – or cringe, as the case may be. For the shoe certainly fits. The structural realities of the Soviet bloc of course compounded this problem, inasmuch as they fostered the virtual autarky of national scholarly communities. Thus, until the demise of communism, Polish historians were importantly cut off from the community of Western scholars. Their ensuing lack of skill with Western languages only deepened the 1 J. Burckhardt, Die Zeit Constantins des Grossen, Basel 1853. 2 Cf. C. Odahl, Constantine and the Christian Empire, London, New York 2013, p. 285-286. 3 Richard Fletcher, The Barbarian Conversion: From Paganism to Christianity , University of California Press, 1999, p. -

HWSK-Nr. 4, Gefahrenkarte Stadt Bischofswerda
StUFA Bautzen Landestalsperrenverwaltung des Käthe-Kollwitz-Str. 17, 02603 Bautzen Freistaates Sachsen Talsperrenmeisterei StUFA Radebeul Gottleuba / Weißeritz Wasastr. 50, 01445 Radebeul Bahnhofstraße 14, 01796 Pirna Hochwasserschutzkonzeption rechtselbischer Fließgewässer I. Ordnung Los 2 - Wesenitz HWSK – Nr. 4 Erläuterung zu den Gefahrenkarten Überschwemmung Stadt Bischofswerda mit OT aufgestellt: iiKKDD Ingenieur – Consult GmbH Zur Wetterwarte 50 Haus 337/G 01109 Dresden Telefon: 03 51 / 88 44 1 - 0 Dresden, den 20.12.2004 Telefax: 03 51 / 88 44 1 - 33 StUFA Bautzen / StUFA Radebeul LTV Freistaat Sachsen - TSM Gottleuba/Weißeritz Hochwasserschutzkonzeption rechtselbischer Fließgewässer I. Ordnung Los 2 – Wesenitz, HWSK Nr. 4 Abschlussbericht - Gesamtgewässer Gefahrenkarten Überschwemmung Stadt Bischofswerda mit OT Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines .....................................................................................................................5 1.1 Zielstellung ...................................................................................................................... 5 1.2 Grundlagen......................................................................................................................5 1.3 Vorgehensweise.............................................................................................................. 5 2. Prozessanalyse ............................................................................................................... 7 2.1 Hydrologie ......................................................................................................................