Das Licht Und Die Architektur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tehdään Elementeistä Suomalaisen Betonielementtirakentamisen Historia
Tehdään elementeistä Suomalaisen betonielementtirakentamisen historia SBK-säätiö Tehdään elementeistä Tehdään elementeistä Suomalaisen betonielementtirakentamisen historia Tehdään elementeistä Suomalaisen betonielementtirakentamisen historia SBK-säätiö Kannen kuva: Temppeliaukion kirkko, Helsingin suosituimpia nähtävyyksiä. Kirkon vuosittainen kävijämäärä on noin puoli miljoonaa. Arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen. Tehdään elementeistä. Arkkitehti Tuomo Suomalaisen kertomaa: Taivallahden seurakunnan kirkon arkkitehtuurikilpailuun valmistauduttaessa vuonna 1960 neuvoteltiin suunnitelman rakenteista diplomi-insinööri Paavo Simulan kanssa. Katon palkiston rakennustapaa pohdittaessa Simula ehdotti: ”Tehdään elementeistä – Janhunen tekee elementit”. Elementit toimitti vuonna 1968 ins.tsto Esijännitystekniikka Henri Janhunen Ky. Kustantaja: SBK-säätiö Julkaisija: Betonitieto Oy © 2009 kirjoittajat ja SBK-säätiö Teksti: Yki Hytönen ja Matti Seppänen Kuvatoimitus: Petri Janhunen, Kari Laukkanen ja Matti Seppänen Ulkoasu & taitto sekä repro & kuvankäsittely: Peter Sandberg Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-92-5772-0 5 Sisältö Alkusanat 7 Mitä on ”Sangen vaikeaa Saatteeksi 9 teollinen rakentaminen 46 mutta ei epätoivoista” 94 ”Sandwich” ja ”kirjahylly” 47 BES-tutkimus 96 Kohti täyselementtitaloja 50 1. Sileävalukerho 50 TEOLLISEN Haka etenee ketjuttamalla 54 Huippuvuodet 99 RAKENTAMISEN Kustannussäästöjä tavoitellen 55 Nousukausi 99 NOUSU 11 Sementtiteollisuus tulee mukaan 100 Elementtien BES-rakentaminen käynnistyy 104 -

Mattilanniemi Campus University Ofjyväskyläuniversity Jury Report Table of Contents 1
/2013 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ PUBLIC DESIGN OY / J-PAINO OY MATTILANNIEMI CAMPUS ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION 25 JANUARY 2013 TO 25 APRIL 2013 JURY REPORT TABLE OF CONTENTS 1 1 COMPETITION ASSIGNMENT................................................................................. 1.1 Organiser, character and aim of the competition ........................................... 1. Invitees ......................................................................................................................... 1. The competition jury and specialists ................................................................... 1. Competition rules ...................................................................................................... 1. Competition language ............................................................................................. 1. Compensation for participation ............................................................................ 2 THE COMPETITION INITIAL DATA .................................................................... .1 Background .................................................................................................................. . Town plan, urban structure and environment at present ............................ .................................................................................................... Traffic and parking 3 DESIGN GUIDELINES ................................................................................................... .1 The most important -

CURRICULUM VITAE DR ARTO KIVINIEMI Ph.D., M.Sc.Arch
CURRICULUM VITAE DR ARTO KIVINIEMI Ph.D., M.Sc.Arch. Email: [email protected] 3rd June 2020 Photo: Suvi Kiviniemi Table of Content 1 Studies ........................................................................................................................... 2 2 Employment .................................................................................................................... 2 2.1 Other Academic Positions ........................................................................................... 2 3 Awards and Grants ........................................................................................................... 3 4 Information Technology R&D ............................................................................................ 3 4.1 R&D Projects at the University of Liverpool .................................................................. 3 4.2 R&D Projects at the University of Salford ..................................................................... 3 4.3 Industrial Collaboration at the University of Salford ...................................................... 4 4.4 PhD Supervision and Assessment ................................................................................ 4 4.5 R&D Projects at Olof Granlund 2008-2010 ................................................................... 6 4.6 Projects at VTT, Technical Research Centre of Finland 1996-2008 ................................. 6 4.7 Teaching ................................................................................................................. -

Rod Smith, Architect Biography
ITINERARY n.51 13 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9 11 12 14 Rod Smith, Architect Biography: In October 2002 architect Rod Smith was awarded the Hamilton City Council Civic Award by Mayor David Christopher John Rodney Braithwaite. The Award, in the category of Arts and Culture, acknowledged Smith’s ‘outstanding service given Smith was born in Rochdale, to the city of Hamilton’. The citation states that without seeking praise for what he enjoys doing, he deserved England in 1933. The son of to be recognised as one of the city’s unsung heroes. That the award citation describes his role in the Hamilton an architect, Smith’s family Chamber Music Society, but makes no mention of his architectural contribution to the city, which commenced in emigrated in 1946 to Hamilton 1961, imbuing the ‘unsung hero’ descriptor with perhaps more gravity than was intended. so his father could take up the position of Architect to Smith’s buildings are recognisable because of their Scandinavian appearance. Roofs, if not flat are pitched at 40 the Waikato Hospital Board. degrees, external walls are typically constructed of concrete block with cedar to soffits, and internal linings are of Smith went to Auckland plywood and larch. The Scandinavian influence comes primarily from books and periodicals Smith purchased University to study architecture during the 1950s and 1960s. It wasn’t until 1996 that Smith embarked on a Scandinavian tour and visited Finland in 1953. He originally became for the first time. Buildings that struck Smith as impressive on that tour include the Suomalainen brothers’ aware of Finland through an Temppeliaukio Church (1969) and Arto Sipinen’s Espoo Cultural Centre (1989), both in Finland, and Alvar Aalto’s appreciation of the music Nordic House (1968) in Iceland. -
JYVÄSKYLÄ Arkkitehtuurikartta Architectural
Arkkitehtuurikartta JYVÄSKYLÄ Architectural Map Sähköinen versio 1.0 Digital version 1.0 Perustuu kartan 2014 painettuun versioon. Based on a 2014 printed edition of the map M LOHIKOSKI KESKUSTA ARKKITEHTUURIKARTTA ARCHITECTURAL MAP CITY CENTRE I M I O J Ä R O V U I T TAULUMÄKI Tervetuloa arkkitehtuurin kaupunkiin! F Jyväskylän arkkitehtuurikartta johdattaa kiehtovalle kier KORTEPOHJA rokselle Jyväskylän rakennettuun ympäristöön. Kartassa L KANGAS esitellään yksittäisiä kohteita ja aluekokonaisuuksia eri aikakausilta keskustasta, Vaajakoskelta ja Säynätsalosta. D VIITANIEMI Erityisesti esille on tuotu kahden Jyväskylässä vahvasti RAJAKATU TOURULAN KIVÄÄRITEHDAS vaikuttaneen arkkitehdin, Alvar Aallon ja Wivi Lönnin suunnittelemia rakennuksia. Lisäksi huomiota on kiin Y L Ä K nitetty Jyväskylän identiteettiä rakentaneisiin kohteisiin S ja uudempaan arkkitehtuuriin 1990luvulta lähtien. G PUISTOLA Ä PUISTOKATU TOURULANTIE Q VAAJAVIRRANRANTA V Welcome to the city of architecture! P HARJU VAAJAKOSKEN S KESKUSTA Y The architectural map of Jyväskylä takes us on a NAISSAARI conducted tour of Jyväskylä’s built environment. J MÄKI-MATTI JA NISULA The map provides information on individual locations KÄVELYKATU JA ALAKAUPUNKI and distinct areas dating from different periods in the PEDESTRIAN STREET AND DOWNTOWN YLIOPISTONKATU ASEMAKATU J city centre, Vaajakoski and Säynätsalo. R KILPISENKATU VARASSAARI KIRKKOPUISTON YMPÄRISTÖ Particular emphasis has been given to buildings designed CHURCH PARK AND SURROUNDINGS and implemented by two architects who have had a VOIONMAANKATU strong influence on Jyväskylä, Alvar Aalto and Wivi C A K AU PPA K AT U B Lönn. Attention has also been paid to those architectural C RAUTPOHJAN locations which have shaped Jyväskylä’s identity and to SCHAUMANNIN PUISTOTIE TYKKITEHTAAN LUTAKKO YLÄKAUPUNKI VAPAUDENKATU ALUE A I B UPTOWN B SATAMAKATU G F C newer architecture from the 1990s onwards. -

ATINER's Conference Paper Series AGR2016-2159
ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2014-1176 Athens Institute for Education and Research ATINER ATINER's Conference Paper Series AGR2016-2159 Business and Culture – Time of Great Changes in the 1980’s in Finland, Lahti as an Example Riitta Niskanen Researcher/Adjunct Professor Lahti City Museum/Helsinki University Finland 1 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ARC2016-2159 An Introduction to ATINER's Conference Paper Series ATINER started to publish this conference papers series in 2012. It includes only the papers submitted for publication after they were presented at one of the conferences organized by our Institute every year. This paper has been peer reviewed by at least two academic members of ATINER. Dr. Gregory T. Papanikos President Athens Institute for Education and Research This paper should be cited as follows: Niskanen, R. (2016). "Business and Culture – Time of Great Changes in the 1980’s in Finland, Lahti as an Example", Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: ARC2016-2159. Athens Institute for Education and Research 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece Tel: + 30 210 3634210 Fax: + 30 210 3634209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr URL Conference Papers Series: www.atiner.gr/papers.htm Printed in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. All rights reserved. Reproduction is allowed for non-commercial purposes if the source is fully acknowledged. ISSN: 2241-2891 07/03/2017 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ARC2016-2159 Business and Culture – Time of Great Changes in the 1980’s in Finland, Lahti as an Example Riitta Niskanen Abstract Finland had a strong economic boom in the 1980’s. -

Built to Plan Global
report Planned cities Tt 50 B 4 03 BUilt to 01 01 Students sitting outside PLAN Aalto University in Otaniemi, Espoo Global 02 Mayor of Espoo, Jukka The garden city Mäkelä Preface 03 Outdoor swimming Tapiola, Finland It isn’t as easy as pool in Tapiola governments suppose Year1 founded:2 1951 3 4 5 6 7 8 9 10 to build a metropolis Founded by: Heikki von Hertzen, a lawyer from scratch with Name: Means “the home of Tapio”, all the vibrancy of a the forest god in Finland’s 19th-century city that has grown national epic The Kalevala naturally. So here are Population: 9,325 a few examples of Iconic building: Aarne Ervi’s Mäntytorni cities from different apartment building, built in 1954 periods of history that were built according 02 “Our success is down to collaboration to a spcific plan and between the city, its residents, the univer- have stood the sity and businesses,” says Jukka Mäkelä, test of time. the mayor of Espoo, Finland’s second- largest city. He is standing among the birch trees outside his childhood home. As he expounds his vision for the city’s future, one of the children playing out- side hits a ball under his electric car. Wel- come to Tapiola garden city. Located in the east of Espoo munici- pality, the district of Tapiola was con- ceived by a lawyer, Heikki von Hertzen, whose book Homes or Barracks for Our Children? set out his urban-planning priorities: nature, family, jobs, public space and a variety of housing options. -
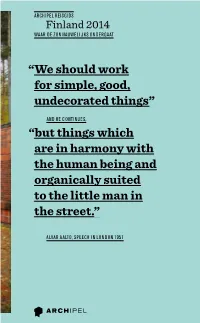
We Should Work for Simple, Good, Undecorated Things”
archipel reisgids Finland 2014 Waar DE ZON NaUWeliJKs ONDERGAAT “We should work for simple, good, undecorated things” aNd he continues, “but things which are in harmony with the human being and organically suited to the little man in the street.” Alvar aalto, speech i N London 1957 voorwoord Archipel in Finland Woorden zijn in Finland zo belangrijk, dat zwijgen er als een deugd wordt opgevat. — Een Fins gezegde luidt: bouw eerst de sauna en dan pas het huis. VOORWOORD 1 ARCHIPEL IN FINLAND 2 Finland is een bebost land met duizenden meren. Het heeft zo’n 5 miljoen inwoners voor een oppervlakte van 338.000 km2. Ter vergelij- king, België heeft 11 miljoen inwoners voor een oppervlakte van 30.528 km2. Finland is een schaars bevolkt land, waar het landschap grotendeels door natuur- lijke bossen en meren wordt gedomineerd. Nederzettingen concentreren zich algemeen in kustgebieden en naast belangrijke meren en waterwegen. Bebouwd gebied bedekt minder dan drie procent van het land. De stedelijke gebieden zijn betrekkelijk klein, vaak met agglomeraties van minder dan 10.000 inwo- ners. Enkel tien steden hebben meer dan 50.000 inwoners. Het stedelijk gebied Helsinki met zijn miljoen inwoners is het dichtstbevolkte gebied van Finland en telt zo’n 3000 inwoners per km2. Jaarlijks worden er ongeveer 30.000 nieuwe huizen gebouwd, waarvan veel eengezinswo- ningen. De huidige regering mikt op apparte- mentencomplexen om effectiever om te gaan met de ruimte en de woningnood. Bovendien is er een uitermate boeiende stadsontwikkeling aan de gang in Helsinki: haven en industrie ver- huizen zodat de stad in nieuwe uitbreidingen terug de link legt met de kustlijn. -

Suomen Taidehistoria 2011.Pdf
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI SUOMEN TAIDEHISTORIA Runkomoniste kevät 2011 Taidehistoria Helsingin yliopisto SUOMEN TAIDEHISTORIAN PERUSTUNTEMUKSEN KURSSI, KL 2011, TTA 120E, OHJELMA Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Markus Hiekkanen ([email protected]) Jakso 1 ti 18.1. Ville Lukkarinen ja Markus Hiekkanen, Kurssin johdanto, klo 10–12 to 20.1. Markus Hiekkanen, Keskiajan taide, 10–13 ti 25.1. Markus Hiekkanen, Keskiajan taide, 10–13 to 27.1. Markus Hiekkanen, Keskiajan taide, 10–13 ti 1.2. Anja Kervanto Nevanlinna, Kaupunkirakennustaide, 10–13 to 3.2. Anja Kervanto Nevanlinna, Kaupunkirakennustaide, 10–13 ti 8.2. Markus Hiekkanen, 1500–1600-luvut, 10–13 to 10.2. Ville Lukkarinen, 1700-luvun arkkitehtuuri, 10–13 ti 15.2. Ville Lukkarinen, 1700-luvun arkkitehtuuri, 10–12 to 17.2. Elina Räsänen, 1700-luvun ja 1800-luvun alun kuvataide, 10–12 ti 22.2. Anne-Maria Pennonen, 1800-luvun kuvataide, 10–12 to 24.2. Ville Lukkarinen, Kuvataide 1870–1900, 10–12 ti 1.3. Anja Kervanto Nevanlinna, 1800-luvun arkkitehtuuri, 10–12 to 3.3. Anja Kervanto Nevanlinna, 1800-luvun arkkitehtuuri, 10–12 Jakson 1 kuulustelu ti 15.3. klo 10–13 auditoriumissa XV ja uusintakuulustelu ma 28.3. klo 10– 13 taidehistorian opintosalissa Jakso 2 to 17.3. Juha Jämbäck, 1700–1800-lukujen taidekäsityö, 10–13 ti 22.3. Juha Heikki Tihinen, 1800-luvun kuvanveisto, 10–13 to 24.3. Pinja Metsäranta, 1800- ja 1900-luvun taitteen arkkitehtuuri, 10–12 ti 29.3. Pinja Metsäranta, Arkkitehtuuri noin 1900–1950, 10–13 to 31.3. Juhana Lahti, Arkkitehtuuri 1950–, 10–13 ti 5.4. -

Päätöksen Paikka Kunnantalot Ja Kaupungintalot Rum För Beslut
aatihuoneesta kaupungintaloon, pitäjäntuvasta kunnantaloon. Kunnan- ja kau- Rpungintalojen historia kuvastaa omalta osaltaan suomalaisen paikallisdemokrati- an kehitystä ja muutosta. Kunnan- ja kaupungintaloilla on aina ollut vahva symboli- nen ulottuvuutensa ja niille on usein varattu merkittävä rooli kaupunkirakenteessa ja -maisemassa. Kunnan- ja kaupungintaloissa kuvastuvat yhteisön yhteiset, rakennus- ajankohdalle ominaiset arvot ja asenteet. Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään joka syksy 49 eri maassa. Vuonna 2009 Suomen rakennusperintöpäivien teemana on kunnan- ja kaupungintalot. Teemavuo- den julkaisu Päätöksen paikka nostaa esiin tämän muutoksessa elävän osan yhteistä rakennusperintöämme. rån rådhus till stadshus, sockenstugor till kommunhus. Kommun- och stadshu- Päätöksen paikka Fsens historia återspeglar utvecklingen och förändringarna i lokaldemokratin i Fin- land. Kommun- och stadshusen har alltid spelat en viktig roll i stadsstrukturen och Päätöksen paikka Kunnantalot ja kaupungintalot -landskapet. De har också en stark symbolisk dimension som representanter för bes- lutanderätten och lokaldemokratin. I dem avspeglas vilka gemensamma värden och attityder som var rådande i samhället vid tidpunkten för byggandet. Dagarna för Europas byggnadsarv firas årligen i 49 olika europeiska länder. Te- | Rum för beslut | Rum mat för de finska byggnadsarvsdagarna 2009 är kommun- och stadshus. Temaårets Rum för beslut publikation Rum för beslut lyfter fram denna föränderliga del av vårt gemensamma Kommun- och stadshusen byggnadsarv. -

Luettelo Konserttisaleista Suomessa 2019
Konsertti Kulttuuritalossa. Kuva Väinö Kannisto, CC BY 4.0, Helsingin kaupunginmuseo. Riitta Niskanen Rakennus / kunta / valmistumisvuosi / suunnittelija(t) Turun konserttitalo Turku 1952 Risto-Veikko Luukkonen ja Ahti Korhonen Lahden konserttitalo Lahti 1954 Kaija Siren ja Heikki Siren Kulttuuritalo Helsinki 1957 Alvar Aalto Kulttuuritalo Marita Outokumpu 1957 Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 1958 Alvar Aalto Tampereen yliopisto Tampere 1960 Toivo Korhonen Seinäjoen kaupungintalo Seinäjoki 1962 Alvar Aalto Kouvolan kaupungintalo Kouvola 1968 Juha Leiviskä Finlandia-talo Helsinki 1971/1975 Alvar Aalto Joensuun yliopisto Joensuu 1972- Jan Söderlund, Erkki Valovirta ja Risto Marila Tampereen konservatorio Tampere 1974 Teuvo Viitanen Lappia-talo Rovaniemi 1975 Alvar Aalto Kokkolan kauppaoppilaitos Kokkola 1981 Marjatta Mäkinen Snellman-Sali Jyväskylän teatteritalo Jyväskylä 1982 Alvar Aalto Lappeenrannan Arkkitehtitoimisto Castrén – Jauhiainen – Lappeenranta 1983 kaupungintalo Nuuttila Oulun musiikkikeskus Oulu 1983 Matti Heikkinen Laurentius-sali Lohja 1983 Arno Savela Kouvola-talo Kouvola 1983 Erkki Valovirta Rauma-sali Rauma 1984 Stoa Helsinki 1984 Björn Krogius ja Veli-Pekka Tuominen Kuusankoskitalo Kuusankoski 1985 Anna Brunow ja Juhani Maunula Retretti Punkaharju 1985 Tapio Korpisaari Kuopion musiikkikeskus Kuopio 1985 Esa Malmivaara ja Raimo Savolainen Nättepori Ii 1985 Pekka Martikainen Brahe-sali Lieksa 1985 Kimmo Karjalainen ja Erja Pesola Imatran kulttuuritalo Imatra 1986 Arto Sipinen Arkkitehtitoimisto Arrak (rakennus vuodelta Taidetehdas -
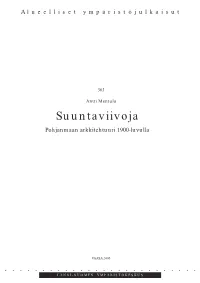
Pohjanmaan Arkkitehtuuri 1900-Luvulla.Pdf
Alueelliset ympäristöjulkaisut Alueelliset ympäristöjulkaisut 363 Antti Mentula Suuntaviivoja Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900-luvulla VAASA 2005 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ..........................Alueelliset ympäristöjulkaisut 363 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-1859-8 ISSN 1238-8610 Kannen kuva: Ylistaron valtion virastotalo, Antti Mentula Valokuvat ja piirrokset: ks. s.67 Taitto: Antti Mentula & Tiina Hietikko-Hautala Painopaikka ja -vuosi: Arkmedia, Vaasa 2005 ○○○○○○○○○○○○○○○ 2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Alueelliset ympäristöjulkaisut 363 Sisällys 1 Alkusanat: 1900-luvun alueellinen arkkitehtuuri? ............................ 4 Tutkimuksen nykytilanne ............................................................................. 4 Vaasa, Lapua ja Ylistaro ................................................................................ 5 2 Pohjalaisen arkkitehtuurin perintö (-1900) ...................................... 7 Talonpoikaisarkkitehtuuri ja kertaustyylit .................................................... 8 2.1 Vaasa .......................................................................................... 10 2.2 Lapua ......................................................................................... 11 2.3 Ylistaro ....................................................................................... 12 3 Kansanrakennusperinteen hidas murtuminen (1900-1919) .......... 13 3.1 Vaasa .......................................................................................... 15 3.2 Lapua