Vorläufige Fassung)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rote Liste Und Artenliste Sachsens Zieralgen Artikel-Nr
Rote Liste und Artenliste Sachsens Zieralgen Artikel-Nr. L V-2-2/35 Inhalt Vorwort 03 1 Einleitung 05 2 Methodische Grundlagen der Erfassung und Bewertung 07 2.1 Fundnachweise, Taxaliste – Quellen und Herangehensweise 07 2.2 Erfassung und Auswertung von Begleitparametern 09 2.3 Lebensräume und ökologische Ansprüche der Desmidiaceen in Sachsen 09 3 Gefährdungskategorien 14 4 Gefährdungsanalyse 16 4.1 Grundlagen der Gefährdungsanalyse 16 4.2 Aktuelle Bestandssituation 16 4.3 Langfristiger Bestandstrend 17 4.4 Kurzfristiger Bestandstrend 18 4.5 Risikofaktoren 18 4.6 Gefährdungseinstufung 18 5 Kommentierte Artenliste 20 6 Rote Liste 62 7 Gefährdungssituation 70 8 Weiterer Untersuchungsbedarf 73 9 Literatur 74 10 Anhang 82 Anhang A1: Prozentuale Verteilung der Taxa auf Standorttypen 82 Anhang A2: Gesamt-Phosphor an den Messstellen mit aktuellen Desmidiaceen-Vorkommen 88 Anhang A3: pH-Wert an den Messstellen mit aktuellen Desmidiaceen-Vorkommen 92 Anhang A4: Leitfähigkeit an den Messstellen mit aktuellen Desmidiaceen-Vorkommen 100 Anhang A5: Vorstellung nicht eindeutig zuordenbarer Taxa 108 Vorwort Kommentierte Artenlisten bieten eine Übersicht Gefährdung innerhalb der Artengruppen werden über die in Sachsen vorkommende Artenvielfalt feste Bewertungskriterien angelegt, die den Ver- einer Organismengruppe. Sie vermitteln grund- gleich mit anderen Bundesländern ermöglichen. legende Informationen zu den Arten. Dazu zäh- Für die Zieralgen ist zudem die Kenntnis ihrer len auch die Fakten für eine Gefährdungsana- ökologischen Ansprüche wesentlich, da sie wich- lyse. Deren Ergebnis wird in der »Roten Liste« tige Indikatororganismen für die Bewertungs- zusammengefasst. verfahren nach der Europäischen Wasserrah- Rote Listen gefährdeter Organismen dokumen- menrichtlinie enthalten. tieren den Kenntnisstand über die Gefährdung Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten der einzelnen Arten und über den Anteil gefähr- Sachsens werden in Verbindung mit kommen- deter Arten der betrachteten Sippe. -
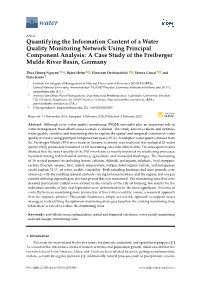
Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network
water Article Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network Using Principal Component Analysis: A Case Study of the Freiberger Mulde River Basin, Germany Thuy Hoang Nguyen 1,2,*, Björn Helm 2 , Hiroshan Hettiarachchi 1 , Serena Caucci 1 and Peter Krebs 2 1 Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), United Nations University, Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany; [email protected] (H.H.); [email protected] (S.C.) 2 Institute for Urban Water Management, Department of Hydrosciences, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Bergstrasse 66, 01069 Dresden, Germany; [email protected] (B.H.); [email protected] (P.K.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-35189219370 Received: 11 November 2019; Accepted: 3 February 2020; Published: 5 February 2020 Abstract: Although river water quality monitoring (WQM) networks play an important role in water management, their effectiveness is rarely evaluated. This study aims to evaluate and optimize water quality variables and monitoring sites to explain the spatial and temporal variation of water quality in rivers, using principal component analysis (PCA). A complex water quality dataset from the Freiberger Mulde (FM) river basin in Saxony, Germany was analyzed that included 23 water quality (WQ) parameters monitored at 151 monitoring sites from 2006 to 2016. The subsequent results showed that the water quality of the FM river basin is mainly impacted by weathering processes, historical mining and industrial activities, agriculture, and municipal discharges. The monitoring of 14 critical parameters including boron, calcium, chloride, potassium, sulphate, total inorganic carbon, fluoride, arsenic, zinc, nickel, temperature, oxygen, total organic carbon, and manganese could explain 75.1% of water quality variability. -

Und Meldestufen Der Hochwassermeldepegel Flussgebiet
Anlage 2 LANDESHOCHWASSERZENTRUM SACHSEN Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Alarm- und Meldestufen der Hochwassermeldepegel Flussgebiet: Elbestrom Alarmstufe Termin AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 Alarmstufe gilt Melde- für Schluss- Hochwasser- Hoch- für Gewässer- Gewässer Melde- Kontroll- Wach- stufe weitere meldung meldepegel wasser- abschnitt im dienst dienst dienst Meldung abwehr Landkreis [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] Uhrzeit [cm] Schöna Elbe 400 500 600 750 50 6.00 Uhr, 390 Sächsische 18.00 Uhr Schweiz- Osterzgebirge Dresden Elbe 400 500 600 700 50 6.00 Uhr, 390 Dresden, Stadt 18.00 Uhr Meißen (Elbe bis Grödel- Elsterwerdaer Floßgraben) Riesa Elbe 480 600 680 760 40 6.00 Uhr, 470 Meißen 18.00 Uhr (Elbe ab Grödel- Elsterwerdaer Floßgraben) Nordsachsen (Elbe oberhalb Mündung Dahle) Torgau Elbe 580 660 740 780 40 6.00 Uhr, 570 Nordsachsen 18.00 Uhr (Elbe unterhalb Mündung Dahle) Flussgebiet: Nebenflüsse der oberen Elbe Alarmstufe Termin AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 Alarmstufe gilt Melde- für Schluss- Hochwasser- Hoch- für Gewässer- Gewässer Melde- Kontroll- Wach- stufe weitere meldung meldepegel wasser- abschnitt im dienst dienst dienst Meldung abwehr Landkreis [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] Uhrzeit [cm] Lichtenhain Kirnitzsch 80 110 140 170 30 6.00 Uhr, 70 Sächsische 18.00 Uhr Schweiz- Osterzgebirge (Kirnitzsch un- terhalb Mündung Saupsdorfer Bach) Sebnitz 2 Sebnitz 90 120 150 210 30 6.00 Uhr, 80 Sächsische 18.00 Uhr Schweiz- Osterzgebirge Neustadt 1 Polenz 100 130 160 190 30 6.00 Uhr, 90 Sächsische 18.00 Uhr Schweiz- Osterzgebirge (Polenz -

Maßnahmenumsetzung WRRL in Sachsen
Maßnahmenumsetzung WRRL in Sachsen Zwischenbericht gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Wasser- rahmenrichtlinie zur Umsetzung der Maßnahmenprogramme – Sächsisches Hintergrunddokument 2 Inhalt 1 Einleitung ................................................................................................................................................................. 7 1.1 Bezug zu den Berichten der FGG Elbe und Oder sowie den sächsischen Hintergrunddokumenten......................... 7 1.2 Verwaltungserlasse zur Umsetzung der Maßnahmenprogramme im Freistaat Sachsen........................................... 8 2 Regionale Arbeitsgruppen (rAG) ............................................................................................................................ 9 2.1 Organisation und Struktur .......................................................................................................................................... 9 2.1.1 Bisherige Aktivitäten der regionalen Arbeitsgruppen ................................................................................................. 10 2.1.2 Bisherige Ergebnisse der Arbeit der regionalen Arbeitgruppen ................................................................................. 11 2.1.3 Gesamteinschätzung der Arbeit der regionalen Arbeitsgruppen................................................................................ 13 2.2 Stand der Maßnahmenumsetzung............................................................................................................................. 14 -

Hochwasserriskogebiete Nach § 73 WHG in Sachsen
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Blatt 1 von 10 Hochwasserrisikogebiete Hochwasserriskogebiete nach § 73 WHG in Sachsen Stand: 22.12.2018 Vorbemerkung: Die benannten Gewässer sind zum Teil nicht durchgängig als Riskogebiet eingestuft (siehe interaktive Karte). Code des Risikogebietes Name des Risikogebietes Gewässer Gewässer- betroffene Gemeinden ordnung (nur bei Gewässern II. Ordnung) DESN_RG_582288_HAV_PE11_1 Albrechtsbach Albrechtsbach, Wuischker Wasser 2 Bautzen, Hochkirch, Kubschütz DESN_RG_566694_SAL_UWE_1 Alte Gösel Alte Gösel 2 Großpösna, Rötha DESN_RG_542693528_MES_FM_1 Altenhainer Bach Altenhainer Bach 2 Frankenberg/Sa. DESN_RG_58212_HAV_PE11_1 Alter Graben/Beiersdorfer Wasser Alter Graben, Beiersdorfer Wasser 2 Beiersdorf, Oppach DESN_RG_5426956_MES_FM_1 Altmittweidaer Bach Altmittweidaer Bach 2 Mittweida DESN_RG_542552_MES_FM_1 Amselgrundbach Amselgrundbach, Zulaufgraben 2 Döbeln Pommlitzgrund DESN_RG_58242_HAV_PE11_1 Arnsdorfer Wasser Arnsdorfer Wasser 2 Waldhufen DESN_RG_5418958_MES_ZM_1 Auerswalder Bach Auerswalder Bach 2 Lichtenau DESN_RG_5425596_MES_FM_1 Bärentalbach Bärentalbach 2 Döbeln DESN_RG_537118936_MES_ES1_1 Berggraben/Schäfertilke Berggraben/Schäfertilke 2 Sebnitz DESN_RG_5416552_MES_ZM_1 Bernsbach Bernsbach 2 Bernsdorf DESN_RG_6741476_LAN_1 Bertsdorfer Wasser Bertsdorfer Wasser 2 Bertsdorf-Hörnitz DESN_RG_54182_MES_ZM_1 Beuthenbach Würschnitz, Beuthenbach 2 Stollberg/Erzgeb. DESN_RG_54254_MES_FM_1 Bielbach Bielbach 2 Döbeln DESN_RG_5373452_MES_ES2_1 Birmenitzer Dorfbach Birmenitzer Dorfbach 2 -

Sachsen Arbeit Und Verkehr
STAATSMINISTERIUM Freistaat FÜR WIRTSCHAFT SACHSEN ARBEIT UND VERKEHR Der Staatsminister Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Postfach 10 03 29 I 01073 Dresden Präsidenten des Sächsischen Landtages Durchwahl Herrn Dr. Matthias Rößler Telefon: 0351 564-8001 Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 Telefax: 0351 564-8024 01067 Dresden Kleine Anfrage des Abgeordneten Gunter Wild, Fraktion der AfD Aktenzeichen Drs.-Nr.: 6/5926 (bitte bei A ntwort angeben) Thema: Monitoring der Wasserqualität bergbaulich beeinflusster Ge 38-1053/13/4 wässer Dresden, 3 1. AUG . 2076 Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage 1: Wer übernimmt welche Kosten in welcher Höhe für das Ge wässermonitoring bezüglich bergbaulich bedingter Eisen und Sulfateinträge? Das Gewässermonitoring obliegt der unteren Wasserbehörde des jeweiligen Z~ ti t i l:at seit 2006 Landkreises. Die Bergbauunternehmen LMBV mbH , Vattenfall Europe Mi audlt bcrufu ndfa mlllc ning AG und MIBRAG mbH sind grundsätzlich im Rahmen der erteilten was serrechtlichen Erlaubnisse beauflagt, die notwendigen Daten auf eigene Kosten zu erheben. Frage 2: An welchen Messstellen werden in Sachsen die Parameter Eisen und Sulfat überwacht? Hausanschrift: In Sachsen wird ein umfangreiches Monitoring der Gewässer zur Realisie Sächsisches Staatsministerium fü r Wirtschaft, Arbeit und rung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) betrieben. Verkehr Wilhelm-Buck-Straße 2 Neben den Messstellen, die im Auftrag von LMBV mbH, Vattenfall Europe 01097 Dresden Mining AG und MIBRAG mbH betrieben werden, werden die Parameter Ei sen und Sulfat bei den im Landesmessnetz Sachsen betriebenen Messstel Außenstellen: Hoyerswerdaer Straße 1 len nach EG-WRRL entsprechend den Vorgaben des Wasser 01099 Dresden haushaltsgesetzes (WHG) und des Sächsischen Wassergesetzes Glacisstraße 4 (SächsWG) an allen Oberflächenwasserkörpern (OWK) erhoben. -

Strecken 500 Bis 539 = OSTSACHSEN
=== VD-T === Der Virtuelle Deutschland-Takt = Strecken 500 bis 539 = OSTSACHSEN Ein Integraler Taktfahrplan von Jörg Schäfer Übersichtskarte mit VD-T-Kurs- buchnummern Grafischer Fahrplan der Normalverkehrszeit: Jede Linie ist eine Zugfahrt im Stundentakt: IC-Express (ICE) Reg.-Express (RE) (dunkel / hell zur Unterscheidung) Inter-City (IC) Inter-Regio (IR) Regionalbahn (RB) 2 500 Dresden - Pirna - B.Schandau - Tetschen (Decin) (- Prag) Schon bei der Projektierung der ersten deutschen Fernbahn zwischen Leipzig und Dresden gab es Pläne, die Strecke später nach Süden fortzusetzen. Das Königreich Sachsen favorisierte anfangs eine Linie durch die Oberlausitz über Zittau und Reichenberg, um Berlin und Wien auf kürzestem Wege miteinander zu verbinden. Die technischen Schwierigkeiten bei der Querung des Jeschken- gebirges verhinderten dieses Projekt aber. Österreich-Ungarn bevorzugte von vornherein eine Bahn in den Tälern von Moldau und Elbe mit günstigerer Topografie. Schon 1840 begannen die Vermessungen im Elbtal. 1842 wurde in einem Staatsvertrag die Fertigstellung in 8 Jahren verein- bart. Im Elbtal konzipierte man eine Trasse, die „drei Fuß österreichisches Maß“ über dem Pegel des bis damals höchsten Hochwassers vom März 1845 lag. Ab 1.8.184 8 fuhren täglich vier Zugpaare zwischen Dresden und Pirna. Die Ge- samtstrecke bis Bodenbach ging am 6.4.1851 in Betrieb. Eine „Übereinkunft zwischen der kaiserlich österreichischen und der königlich-sächsischen Regierung“ regelte die Betriebsführung durch die sächsische Staatsbahn auf böhmischem Territorium und legte den Bahnhof Bodenbach als Wechselstation fest. Ende des 19. Jahrhunderts genügten die Bahnanlagen in Dresden nicht mehr dem steigenden Verkehrsaufkommen. Die ebenerdige Trassierung mit vielen Bahn- übergängen behinderte die Stadtentwicklung. Man entschied sich schließlich für den kompletten Umbau mit Erweiterung auf vier Gleise, Höherlegung der Gleise und Neubau fast aller Dresdner Stationen. -

Lfulg Schriftenreihe Heft 10/2010
Geogene Hintergrundbelastungen Schriftenreihe, Heft 10/2010 Oberflächenwassergenaue Ableitung von Referenzwerten geogener Hintergrundbelastungen für Schwermetalle und Arsen in der Wasserphase sowie im schwebstoffbürtigen Sediment sächsischer Fließgewässer im Einzugsgebiet des Erzgebirges/Vogtlandes Annia Greif, Prof. Dr. rer. nat. Werner Klemm Schriftenreihe des LfULG, Heft 10/2010 | 1 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel und Hintergrund ............................................................................................... 4 2 Projektmanagement ................................................................................................ 6 3 Anforderungen der WRRL und nationaler Regelwerke........................................ 8 4 Theoretische Untersuchungen im Erzgebirge/Vogtland.................................... 12 4.1 Gesteine .................................................................................................................. 12 4.2 Böden ...................................................................................................................... 13 4.3 Bachsedimente........................................................................................................ 15 5 Praktische Untersuchungen in den Referenzgebieten....................................... 16 5.1 Probenahme............................................................................................................ 16 5.2 Probenaufbereitung und Analytik............................................................................. 21 5.3 -

Landeshochwasserzentr
vom 29. Juli 2008 Nr. 7 Sächsisches Amtsblatt, Sonderdruck Anlage 1 Zustellungsplan für Hochwassernachrichten LANDESHOCHWASSERZENTRUM SACHSEN Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ZUSTELLUNGSPLAN für HOCHWASSERNACHRICHTEN Flussgebiet: Elbestrom Hochwasserstandsmeldung Empfänger warnung/ eilbenach- richtigung richtigung -entwarnung Hochwasser- Hochwasser- Pegel Gewässer Arzberg X X Riesa Elbe Torgau Elbe Bad Schandau, Stadt X X Schöna Elbe Beilrode X X Riesa Elbe Torgau Elbe Belgern, Stadt X X Riesa Elbe Torgau Elbe Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz X Cavertitz X X Dresden Elbe Riesa Elbe Coswig, Stadt X X Dresden Elbe Deutscher Wetterdienst, Regionalzentrale X Leipzig Diera-Zehren X X Dresden Elbe Riesa Elbe Dommitzsch, Stadt X X Torgau Elbe Dresden, Stadt X X Schöna Elbe Dresden Elbe Elsnig X X Torgau Elbe Großtreben-Zwethau X X Torgau Elbe Heidenau, Stadt X X Schöna Elbe Hirschstein X X Dresden Elbe Riesa Elbe Klipphausen X X Dresden Elbe Königstein/Sächsische Schweiz, Stadt X X Schöna Elbe Land Brandenburg, Landesumweltamt X Land Brandenburg, Mühlberg, Stadt X X Land Sachsen-Anhalt, Landesbetrieb für X X Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Landesdirektion Dresden X X Schöna Elbe Dresden Elbe Riesa Elbe Landesdirektion Leipzig X X Dresden Elbe Riesa Elbe Torgau Elbe Landestalsperrenverwaltung, X X Dresden Elbe Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster Riesa Elbe Torgau Elbe Landestalsperrenverwaltung, X X Schöna Elbe Betrieb Oberes Elbtal Dresden Elbe Riesa Elbe Landestalsperrenverwaltung, Zentrale X X -

Historisches Ortsnamenbuch Von Sachsen Band I Ay– L
Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen Band I Ay–L Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte · Band 21 Herausgegeben von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen Herausgegeben von Ernst Eichler und Hans Walther Band I Ay–L Bearbeitet von Ernst Eichler, Volkmar Hellfritzsch, Hans Walther und Erika Weber Akademie Verlag Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des Freistaates Sachsen (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) Mit einer Karte Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen / hrsg. von Ernst Eichler und Hans Walther. – Berlin : Akad. Verl. (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte ; Bd. 21) ISBN 3-05-003728-8 Bd. 1. A–L. – 2001 ISBN 3-05-003728-8 © Akademie Verlag GmbH, Berlin 2001 Gedruckt auf säurefreiem Papier. Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikrover- filmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Druckvorstufe: Volkmar Hellfritzsch Druck: druckhaus köthen GmbH Printed in Germany Inhalt Vorwort . VII Einführung . IX 1 Zur Forschungsgeschichte . IX 2 Namenüberlieferung und historische Quellen . XI 2.1 Quellenübersicht . XI 2.2 Quellenkritik . XV 3 Historische Schichtung und geographische Verbreitung der Ortsnamen .