Physiker]Innen [Physiker]Innen Eine Auswahl Eine Auswahl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Physics Teaching and Research at Göttingen University 2 GREETING from the PRESIDENT 3
Physics Teaching and Research at Göttingen University 2 GREETING FROM THE PRESIDENT 3 Greeting from the President Physics has always been of particular importance for the Current research focuses on solid state and materials phy- Georg-August-Universität Göttingen. As early as 1770, Georg sics, astrophysics and particle physics, biophysics and com- Christoph Lichtenberg became the first professor of Physics, plex systems, as well as multi-faceted theoretical physics. Mathematics and Astronomy. Since then, Göttingen has hos- Since 2003, the Physics institutes have been housed in a new ted numerous well-known scientists working and teaching physics building on the north campus in close proximity to in the fields of physics and astronomy. Some of them have chemistry, geosciences and biology as well as to the nearby greatly influenced the world view of physics. As an example, Max Planck Institute (MPI) for Biophysical Chemistry, the MPI I would like to mention the foundation of quantum mecha- for Dynamics and Self Organization and the MPI for Solar nics by Max Born and Werner Heisenberg in the 1920s. And System Research. The Faculty of Physics with its successful Georg Christoph Lichtenberg and in particular Robert Pohl research activities and intense interdisciplinary scientific have set the course in teaching as well. cooperations plays a central role within the Göttingen Cam- pus. With this booklet, the Faculty of Physics presents itself It is also worth mentioning that Göttingen physicists have as a highly productive and modern faculty embedded in an accepted social and political responsibility, for example Wil- attractive and powerful scientific environment and thus per- helm Weber, who was one of the Göttingen Seven who pro- fectly prepared for future scientific challenges. -
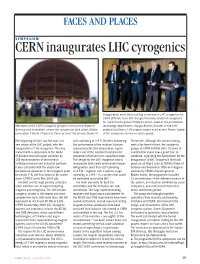
CERN Inaugurates LHC Cyrogenics
FACES AND PLACES SYMPOSIUM CERN inaugurates LHC cyrogenics Inauguration and ribbon-cutting ceremony of LHC cryogenics by CERN officials: from left, Giorgio Passardi, leader of cryogenics for experiments group; Philippe Lebrun, head of the accelerator Members of the CERN cryogenic groups in front of the Globe of technology department; Giorgio Brianti, founder of the LHC Science and Innovation, where the symposium took place. (Globe project; Lyn Evans, LHC project leader and Laurent Tavian, leader conception T Buchi, Charpente Concept and H Dessimoz, Group H.) of the cryogenics for accelerators group. The beginning of June saw the start of a coils operating at 1.9 K. Besides enhancing Tennessee. Although the commissioning new phase at the LHC project, with the the performance of the niobium-titanium work is far from finished, the cyrogenics inauguration of LHC cryogenics. This was superconductor, this temperature regime groups at CERN felt that after 10 years of marked with a symposium in the Globe makes use of the excellent heat-transfer construction it was now a good time to of Science and Innovation attended by properties of helium in its superfluid state. celebrate, organizing the Symposium for the 178 representatives of the research The design for the LHC cryogenics had to Inauguration of LHC Cryogenics that took institutes involved and industrial partners. incorporate both newly ordered and reused place on 31 May-1 June at CERN's Globe of It also coincided with the stable low- refrigeration plant from LEP operating Science and Innovation. After an inaugural temperature operation of the cryogenic plant at 4.5 K – together with a second stage address by CERN’s director-general, for sector 7–8, the first sector to be cooled operating at 1.9 K – in a system that could Robert Aymar, the programme included down (CERN Courier May 2007 p5). -
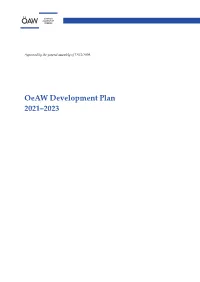
Development Plan 2021–2023
Approved by the general assembly of 12/13/2019. OeAW Development Plan 2021–2023 Glossary AI Artificial Intelligence BMBWF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Federal Ministry of Education, Science and Research) CLARIN Common Language Resources and Technology Infrastructure DARIAH Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DH Digital Humanities ESQ Erwin Schrödinger Center for Quantum Science & Technology ESS Earth System Sciences Research Program FWF Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Austrian Science Fund) FTI Forschung, Technologie und Innovation (Research, Technology and Innovation) GSK Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (Humanities, Social Sciences and Cultural Studies) GUEP Entwurf des Gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplans 2022–2027 in der Fassung vom 01.08.2019 (draft Austrian University Development Plan 2022–2027 as of 08/01/2019) HI Rom Historisches Institut beim Österreichischen Kulturforum in Rom (Historical Institute of the Austrian Cultural Forum, Rome) HPDA High Performance Data Analysis IP Intellectual Property IPR Intellectual Property Rights JESH Joint Excellence in Science and Humanities funding program at the OeAW NFTE Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (National Foundation for Research, Technology and Development) PA Performance agreement between the OeAW and the BMBWF SDG Sustainable Development Goals STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics Page 2 of 30 OeAW Development Plan 2021–2023 Table of Contents -

INF 3190 Wireless Communications
Department of Informatics Networks and Distributed Systems (ND) group INF 3190 Wireless Communications Özgü Alay [email protected] Simula Research Laboratory Outline • Brief history of wireless • What is wireless communication? • Bottom-down approach – Physical layer : how can we transmit signals in air? – Link layer : multiple access – Wireless impact higher layers? • Wireless Systems – Mobile Broadband Networks – Wifi – Sensor Networks, Adhoc Networks 2 Wireless History • James C Maxwell ( 1831- 1879) laying the theoretical foundation for EM fields with his famous equations • Heinrich Hertz (1857- 1894 ) was the first to demonstrate the wave character of electrical transmission through space (1886). (Note Today the unit Hz reminds us of this discovery). • Radio invented in the 1880s by Marconi • The 1st radio broadcast took place in 1906 when Reginald A Fessenden transmitted voice and music for Christmas. • The invention of electronic vacuum tube in 1906 by Lee De Forest (1873-1961) & Robert Von Lieben (1878 – 1913) helped to reduce the size of sender and receiver . 3 Wireless History cont… • In 1915 , the first wireless voice transmission was set up between New York and San Francisco • The 1st commercial radio station started in 1920 – Note Sender & Receiver still needed huge antennas due to high transmission power. • In 1926, the first telephone in a train was available on the Berlin – Hamburg line • 1928 was the year of many field trials for TV broadcasting. John L Baird ( 1888 – 1946 ) transmitted TV across Atlantic and demonstrated color TV 4 Wireless History cont … • Invention of FM in 1933 by Edwin H Armstrong [ 1890 - 1954 ] . • 1946, Public Mobile in 25 US cities, high power transmitter on large tower. -

Ludwig Boltzmann Was Born in Vienna, Austria. He Received His Early Education from a Private Tutor at Home
Ludwig Boltzmann (1844-1906) Ludwig Boltzmann was born in Vienna, Austria. He received his early education from a private tutor at home. In 1863 he entered the University of Vienna, and was awarded his doctorate in 1866. His thesis was on the kinetic theory of gases under the supervision of Josef Stefan. Boltzmann moved to the University of Graz in 1869 where he was appointed chair of the department of theoretical physics. He would move six more times, occupying chairs in mathematics and experimental physics. Boltzmann was one of the most highly regarded scientists, and universities wishing to increase their prestige would lure him to their institutions with high salaries and prestigious posts. Boltzmann himself was subject to mood swings and he joked that this was due to his being born on the night between Shrove Tuesday and Ash Wednesday (or between Carnival and Lent). Traveling and relocating would temporarily provide relief from his depression. He married Henriette von Aigentler in 1876. They had three daughters and two sons. Boltzmann is best known for pioneering the field of statistical mechanics. This work was done independently of J. Willard Gibbs (who never moved from his home in Connecticut). Together their theories connected the seemingly wide gap between the macroscopic properties and behavior of substances with the microscopic properties and behavior of atoms and molecules. Interestingly, the history of statistical mechanics begins with a mathematical prize at Cambridge in 1855 on the subject of evaluating the motions of Saturn’s rings. (Laplace had developed a mechanical theory of the rings concluding that their stability was due to irregularities in mass distribution.) The prize was won by James Clerk Maxwell who then went on to develop the theory that, without knowing the individual motions of particles (or molecules), it was possible to use their statistical behavior to calculate properties of a gas such as viscosity, collision rate, diffusion rate and the ability to conduct heat. -

Hans Thirring, on the Formal Analogy Between the Basic Electromagnetic Equations and Einstein’S Gravity Equations in first Approximation
Gen Relativ Gravit (2012) 44:3217–3224 DOI 10.1007/s10714-012-1450-4 GOLDEN OLDIE EDITORIAL Editorial note to: Hans Thirring, On the formal analogy between the basic electromagnetic equations and Einstein’s gravity equations in first approximation Herbert Pfister Published online: 26 October 2012 © Springer Science+Business Media, LLC 2012 Keywords Gravitomagnetism · Frame dragging · Lense–Thirring effect · Experimental relativity · Golden Oldie 1 Technical comments on the Thirring paper The paper contains some inconsistencies and errors, and an undefined quantity, which, however, does not invalidate the final equations for gravitomagnetism. Since in a realistic rotating body (angular velocity ω) there arise centrifugal stresses of order ω2, it is inconsistent to incorporate the velocities v of the field-generating body up to second order but to treat this body as incoherent matter (dust). The same incon- sistency appeared in Thirring’s model of a rotating mass shell [1], which therefore did not correctly solve the Einstein equations (in the shell). For this case the inconsistency was observed and corrected by Lanczos [2]. In the present paper the inconsistency has no severe consequences because the second order terms in v anyhow are quite unimportant. An error in Thirring’s paper appears in the integration volume dV0 which has to be substituted by dV = dV0/(dx4/ds). The same error appeared in Thirring’s paper [1] on the rotating mass shell, was there observed by M. Laue and W. Pauli, and corrected by Thirring in [3]. But, as with the inconsistency with the incoherent The republication of the original paper can be found in this issue following the editorial note and online via doi:10.1007/s10714-012-1451-3. -

7: Society III
A History Of Knowledge What The Victorian Age Knew Chapter 7: Society III Piero Scaruffi (2004) www.scaruffi.com Edited and revised by Chris Hastings (2013) Abolitions • Abolition of slavery in the USA (1861) • Abolition of serfdom in Russia (1861) 2 Democracy • USA: 1865 • France: 1875 • Britain: 1918 • But not for women 3 Puritanism • 1865: The “Salvation Army” • 1873: Anthony Comstock founds the Society for the Suppression of Vice • 1874: The Woman's Christian Temperance Union is founded 4 The Invention Of Childhood • Kate Greenaway (Britain): “Under the Window: Pictures & Rhymes for Children” (1879) 5 Customs • One is a gentleman/lady not by birth but by good manners • The dandy (modeled after Bryan “Beau” Brummell of the 1800s) 6 Private Life Board games of the 1880s 7 Private Life • Moving panoramas: Before cinema and before virtual reality • Robert Baker’s proto-panorama of Edinburgh (1791) • John Banvard: Moving panorama of 1848 • Albert Smith’s panorama of the Mont Blanc, showed more than 2000 times (1852-58) • Moses Gompertz and the Poole brothers’ Myriorama (1890s) Banvard’s panorama 8 Transportation • 1825: Britain inaugurates the first railway in the world • 1840s: Boom of railways in Britain • 1869: The Union and Central Pacific railroads create the first transcontinental railroad • 1885: Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach invent the motorcycle • 1886: Karl Benz builds a gasoline-powered car • 1890: The first electrical subway (London) • 1900: Ferdinand von Zeppelin builds the first rigid dirigible • 1903: Wilbur and Orville -

Chapter 1 the Biography of a Trafficking Material
Trafficking Materials and Maria Rentetzi Gendered Experimental Practices Chapter 1 The Biography of a Trafficking Material In 1904, an article titled "Radium and Radioactivity" appeared in Century 1 Magazine, a monthly popular magazine published from 1881 to 1930. The article presents Marie Curie's personal account of the discovery of radium and radioactivity. In the article, Curie discusses in depth her arduous attempts to study the radiation of the compounds of uranium and that of known chemical elements, hoping to discover more which are endowed with atomic radioactivity. She revels that it was the chemists who supplied her with the materials she needed. "As I desired to make a very thorough investigation, I had resource to different chemists, who put at my disposal specimens—in some cases the only ones in existence—containing very rare elements." Her next step was to examine different minerals, especially the oxide of uranium 2 ore (pitchblende). To her great surprise, this specimen was found to be four times more active than oxide of uranium itself. The explanation was more than obvious. "The ore must contain a substance more radioactive than uranium and thorium, and this substance must necessarily be a chemical element as yet unknown."1 Her attempts to isolate the new element would lead Marie and Pierre Curie, who joined her research shortly after, to the discovery of both polonium and radium, to the Nobel Prize in Physics in 1903, and to a second Nobel Prize in 1911, this time in chemistry. This chapter attempts to present a cultural -

An Improbable Venture
AN IMPROBABLE VENTURE A HISTORY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO NANCY SCOTT ANDERSON THE UCSD PRESS LA JOLLA, CALIFORNIA © 1993 by The Regents of the University of California and Nancy Scott Anderson All rights reserved. Library of Congress Cataloging in Publication Data Anderson, Nancy Scott. An improbable venture: a history of the University of California, San Diego/ Nancy Scott Anderson 302 p. (not including index) Includes bibliographical references (p. 263-302) and index 1. University of California, San Diego—History. 2. Universities and colleges—California—San Diego. I. University of California, San Diego LD781.S2A65 1993 93-61345 Text typeset in 10/14 pt. Goudy by Prepress Services, University of California, San Diego. Printed and bound by Graphics and Reproduction Services, University of California, San Diego. Cover designed by the Publications Office of University Communications, University of California, San Diego. CONTENTS Foreword.................................................................................................................i Preface.........................................................................................................................v Introduction: The Model and Its Mechanism ............................................................... 1 Chapter One: Ocean Origins ...................................................................................... 15 Chapter Two: A Cathedral on a Bluff ......................................................................... 37 Chapter Three: -
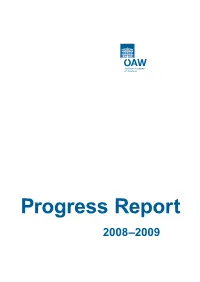
Progress Report
Progress Report 2008–2009 We owe special thanks to the Austrian Science Fund (FWF) for its financial support for numerous projects of the research facilities of the Austrian Academy of Sciences All rights reserved Copyright © 2009 by Austrian Academy of Sciences Layout: Art Quarterly Publishing House Werbe- und PR-Agentur GmbH. Printed and bound: Wograndl 3 Table of contents Preface . 5 RESEARCH FACILITIES OF THE SECTION FOR MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES Biology and Medicine CeMM – Research Center for Molecular Medicine GmbH . 11 Breath Research Institute . 14 GMI – Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology . 18 IMBA – Institute of Molecular Biotechnology GmbH . 22 Institute for Biomedical Aging Research . 26 Institute for Biophysics and Nanosystems Research . 30 Konrad Lorenz Institute for Ethology . 34 Earth Sciences Institute for Geographic Information Science . 37 Center for Geosciences . 40 Commission for the Palaeontological and Stratigraphical Research of Austria . 42 Commission for Geophysical Research . 45 Commission for Quaternary Research . 48 Commission for Basic Research on Mineral Raw Materials . 51 Mathematics, Simulation and Metrology Institute for Integrated Sensor Systems . 55 Acoustics Research Institute . 58 Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics . 61 Commission for Scientific Visualization . 65 Physics and Materials Sciences Erich Schmid Institute of Materials Science . 68 Institute of High Energy Physics . 71 Institute for Quantum Optics and Quantum Information . 74 Stefan Meyer Institute for Subatomic Physic. 77 Environmental Research Institute for Limnology . 80 Institute of Technology Assessment . 83 Commission for Interdisciplinary Ecological Studies . 86 Space Research Space Research Institute . 89 Commission for Astronomy . 92 Interdepartmental Research Tasks Commission for Scientific Co-operation with the Austrian Federal Ministry of Defence and Sports . -

Light and the Electromagnetic Spectrum
© Jones & Bartlett Learning, LLC © Jones & Bartlett Learning, LLC NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION © Jones & Bartlett Learning, LLC © Jones & Bartlett Learning, LLC NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION © Jones & Bartlett Learning, LLC © Jones & Bartlett Learning, LLC NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION © Jones & Bartlett Learning, LLC © Jones & Bartlett Learning, LLC NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION © Jones & Bartlett Learning, LLC © Jones & Bartlett Learning, LLC NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION © JonesLight & Bartlett and Learning, LLCthe © Jones & Bartlett Learning, LLC NOTElectromagnetic FOR SALE OR DISTRIBUTION NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION4 Spectrum © Jones & Bartlett Learning, LLC © Jones & Bartlett Learning, LLC NOT FOR SALEJ AMESOR DISTRIBUTIONCLERK MAXWELL WAS BORN IN EDINBURGH, SCOTLANDNOT FOR IN 1831. SALE His ORgenius DISTRIBUTION was ap- The Milky Way seen parent early in his life, for at the age of 14 years, he published a paper in the at 10 wavelengths of Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. One of his first major achievements the electromagnetic was the explanation for the rings of Saturn, in which he showed that they con- spectrum. Courtesy of Astrophysics Data Facility sist of small particles in orbit around the planet. In the 1860s, Maxwell began at the NASA Goddard a study of electricity© Jones and & magnetismBartlett Learning, and discovered LLC that it should be possible© Jones Space & Bartlett Flight Center. Learning, LLC to produce aNOT wave FORthat combines SALE OR electrical DISTRIBUTION and magnetic effects, a so-calledNOT FOR SALE OR DISTRIBUTION electromagnetic wave. -
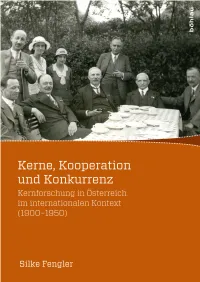
Kerne, Kooperation Und Konkurrenz. Kernforschung In
Wissenschaft, Macht und Kultur in der modernen Geschichte Herausgegeben von Mitchell G. Ash und Carola Sachse Band 3 Silke Fengler Kerne, Kooperation und Konkurrenz Kernforschung in Österreich im internationalen Kontext (1900–1950) 2014 Böhlau Verlag Wien Köln Weimar The research was funded by the Austrian Science Fund (FWF) : P 19557-G08 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagabbildung: Zusammentreffen in Hohenholte bei Münster am 18. Mai 1932 anlässlich der 37. Hauptversammlung der deutschen Bunsengesellschaft für angewandte physikalische Chemie in Münster (16. bis 19. Mai 1932). Von links nach rechts: James Chadwick, Georg von Hevesy, Hans Geiger, Lili Geiger, Lise Meitner, Ernest Rutherford, Otto Hahn, Stefan Meyer, Karl Przibram. © Österreichische Zentralbibliothek für Physik, Wien © 2014 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Lektorat: Ina Heumann Korrektorat: Michael Supanz Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien Satz: Michael Rauscher, Wien Druck und Bindung: Prime Rate kft., Budapest Gedruckt auf chlor- und säurefrei gebleichtem Papier Printed in Hungary ISBN 978-3-205-79512-4 Inhalt 1. Kernforschung in Österreich im Spannungsfeld von internationaler Kooperation und Konkurrenz ....................... 9 1.1 Internationalisierungsprozesse in der Radioaktivitäts- und Kernforschung : Eine Skizze ...................... 9 1.2 Begriffsklärung und Fragestellungen ................. 10 1.2.2 Ressourcenausstattung und Ressourcenverteilung ......... 12 1.2.3 Zentrum und Peripherie ..................... 14 1.3 Forschungsstand ........................... 16 1.4 Quellenlage .............................