Masterarbeit / Master´S Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Developmentof Early Imperial Dress from the Tetrachs to The
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Birmingham Research Archive, E-theses Repository University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. The Development of Early Imperial Dress from the Tetrarchs to the Herakleian Dynasty General Introduction The emperor, as head of state, was the most important and powerful individual in the land; his official portraits and to a lesser extent those of the empress were depicted throughout the realm. His image occurred most frequently on small items issued by government officials such as coins, market weights, seals, imperial standards, medallions displayed beside new consuls, and even on the inkwells of public officials. As a sign of their loyalty, his portrait sometimes appeared on the patches sown on his supporters’ garments, embossed on their shields and armour or even embellishing their jewelry. Among more expensive forms of art, the emperor’s portrait appeared in illuminated manuscripts, mosaics, and wall paintings such as murals and donor portraits. Several types of statues bore his likeness, including those worshiped as part of the imperial cult, examples erected by public 1 officials, and individual or family groupings placed in buildings, gardens and even harbours at the emperor’s personal expense. -
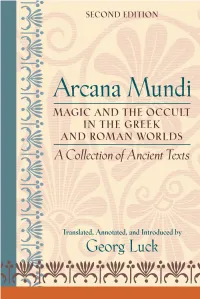
Arcana Mundi : Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds : a Collection of Ancient Texts / Translated, Annotated, and Introduced by Georg Luck
o`o`o`o`o`o SECOND EDITION Arcana Mundi MAGIC AND THE OCCULT IN THE GREEK AND ROMAN WORLDS A Collection of Ancient Texts Translated, Annotated, and Introduced by Georg Luck o`o`o`o`o`o THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS BALTIMORE The first edition of this book was brought to publication with the generous assistance of the David M. Robinson Fund and the Andrew W. Mellon Foundation. ∫ 1985, 2006 The Johns Hopkins University Press All rights reserved. Published 1985, 2006 Printed in the United States of America on acid-free paper 2 4 6 8 9 7 5 3 1 The Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland 21218-4363 www.press.jhu.edu Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Arcana mundi : magic and the occult in the Greek and Roman worlds : a collection of ancient texts / translated, annotated, and introduced by Georg Luck. — 2nd ed. p. cm. Includes bibliographical references (p. ) and indexes. isbn 0-8018-8345-8 (hardcover : alk. paper) isbn 0-8018-8346-6 (pbk. : alk. paper) 1. Occultism—Greece—History—Sources. 2. Occultism—Rome—History— Sources. 3. Civilization, Classical—Sources. I. Luck, Georg, 1926– bf1421.a73 2006 130.938—dc22 2005028354 A catalog record for this book is available from the British Library. For Harriet This page intentionally left blank Contents List of Texts ix Preface xiii List of Abbreviations xvii General Introduction: Exploring Ancient Magic 1 I. MAGIC Introduction 33 Texts 93 II. MIRACLES Introduction 177 Texts 185 III. DAEMONOLOGY Introduction 207 Texts 223 IV. DIVINATION Introduction 285 Texts 321 V. -

Des Soldats De L'armée Romaine Tardive: Les Protectores (Iiie-Vie
THÈSE Pour obtenir le diplôme de doctorat Spécialité : Histoire, histoire de l’art et archéologie Préparée au sein de l’Université de Rouen Normandie Des soldats de l’armée romaine tardive : les protectores e e (III -VI siècles ap. J.-C.) Volume 2 : Prosopographie et annexes Présentée et soutenue par Maxime EMION Thèse soutenue publiquement le 6 décembre 2017 devant le jury composé de Professeur émérite d’histoire romaine, M. Michel CHRISTOL Examinateur Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Professeur d’histoire romaine, Université M. Pierre COSME Directeur de thèse de Rouen Normandie Professeur d’histoire romaine, Université Mme Sylvie CROGIEZ-PETREQUIN Rapporteur François-Rabelais, Tours Professor Doktor, Kommission für Alte M. Rudolf HAENSCH Geschichte und Epigraphik des Deutschen Rapporteur Archäologischen Instituts, Munich Maître de conférences d’histoire romaine, M. Sylvain JANNIARD Examinateur Université François-Rabelais,Tours Thèse dirigée par Pierre COSME, GRHis (EA 3831) UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE École doctorale Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage (ED 558) THÈSE DE DOCTORAT EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE Des soldats de l’armée romaine tardive : e e les protectores (III -VI siècles ap. J.-C.) Volume II – Prosopographie, Annexes, Bibliographie Présentée et soutenue publiquement le 6 décembre 2017 par Maxime EMION Sous la direction de Pierre COSME Membres du jury : Michel CHRISTOL, Professeur des universités émérite, Université Paris I – Panthéon Sorbonne Pierre COSME, Professeur des universités, Université de Rouen Normandie Sylvie CROGIEZ-PÉTREQUIN, Professeur des universités, Université François-Rabelais de Tours Rudolf HAENSCH, Professor Doktor, Kommision für Altegeschichte und Epigraphik, Munich Sylvain JANNIARD, Maître de conférences, Université François-Rabelais de Tours CATALOGUE PROSOPOGRAPHIQUE, ANNEXES, BIBLIOGRAPHIE 567 568 Introduction au catalogue prosopographique. -

The Trinitarian Theology of Irenaeus of Lyons
Marquette University e-Publications@Marquette Dissertations, Theses, and Professional Dissertations (1934 -) Projects The Trinitarian Theology of Irenaeus of Lyons Jackson Jay Lashier Marquette University Follow this and additional works at: https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu Part of the Religion Commons Recommended Citation Lashier, Jackson Jay, "The Trinitarian Theology of Irenaeus of Lyons" (2011). Dissertations (1934 -). 109. https://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/109 THE TRINITARIAN THEOLOGY OF IRENAEUS OF LYONS by Jackson Lashier, B.A., M.Div. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School, Marquette University, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Milwaukee, Wisconsin May 2011 ABSTRACT THE TRINITARIAN THEOLOGY OF IRENAEUS OF LYONS Jackson Lashier, B.A., M.Div. Marquette University, 2011 This dissertation is a study of the Trinitarian theology of Irenaeus of Lyons. With the exception of two recent studies, Irenaeus’ Trinitarian theology, particularly in its immanent manifestation, has been devalued by scholarship due to his early dates and his stated purpose of avoiding speculative theology. In contrast to this majority opinion, I argue that Irenaeus’ works show a mature understanding of the Trinity, in both its immanent and economic manifestations, which is occasioned by Valentinianism. Moreover, his Trinitarian theology represents a significant advancement upon that of his sources, the so-called apologists, whose understanding of the divine nature converges in many respects with Valentinian theology. I display this advancement by comparing the thought of Irenaeus with that of Justin, Athenagoras, and Theophilus, on Trinitarian themes. Irenaeus develops Trinitarian theology in the following ways. First, he defines God’s nature as spirit, thus maintaining the divine transcendence through God’s higher order of being as opposed to the use of spatial imagery (God is separated/far away from creation). -

12,51 Mb / .Pdf
Geçmişle ilgili düşüncelere dalmışken belki sahipsiz bir at koşarak geçer veya Just as you are lost in rengarenk kadife elbisesi ve thoughts of the past, a free gümüş işlemeli puşusuyla bir horse may gallop by, or Harranlı kadın koyun sürüsü ile a local woman in a multi-coloured yaklaşır. Harran... dress and silver-embroidered puşu headdress may approach with her Şimdiki zamanı bile sanki bir peri flock of sheep. Harran... masalından çıkmış gibidir! a fairytale land even in the present day! Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu kadar çok değere sahip olan Şanlıurfa’nın turizm SUNUŞ altyapısını iyileştirmek, turizm potansiye- lini harekete geçirmek ve ili turizm çekim merkezine dönüştürmek için kuruluşun- dan itibaren pek çok projeyi desteklemiş- tir ve desteklemeye devam etmektedir. Bu Doğal zenginlikleri, tarihi-kültürel biri- kapsamda elinizde tuttuğunuz bu katalog kimi ve çok sayıda medeniyet ve inanca ev tarihindeki birçok değeri günümüze taşı- sahipliği yapması nedeniyle Şanlıurfa, keş- yan ve zengin kültürel bir mirasa sahip olan fedilmeyi bekleyen bir ‘turizm hazinesi’dir. Şanlıurfa’nın Harran ilçesini tanıtmak ama- Kültür ve medeniyetin dünyaya yayıldığı cıyla hazırlanmıştır. bölge olarak kabul edilen ‘Bereketli Hilal’de Harran ilçesi, bölgenin en eski yerleşim yer alan Şanlıurfa, bu gün olduğu gibi ta- yerlerinden birisi olup tarihte birçok me- rihin her döneminde merkez olma rolünü deniyete ev sahipliği yapmasının yanı sıra, sürdürmüştür. Bu medeniyetlerden miras dünyanın ilk üniversitesi olan ‘Harran Üni- kalan tarihi ve kültürel dokusu ve tescilli versite’sini de barındırması sebebiyle bilim pek çok kültür varlığı ile Şanlıurfa Güney- dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. doğu’nun turizm potansiyeli en yüksek ille- Bununla birlikte yılda üç hatta dört ürün rinden biridir. -

Marketing Fragment 6 X 10.T65
Cambridge University Press 978-0-521-88209-5 - The Roman Revolution of Constantine Raymond Van Dam Index More information Index iii Ablabius, Flavius (consul), 121n, 152–55, 198, Ammianus Marcellinus (historian), 39n, 60 369–72 Amorium, 156–57, 208–9 Abraham (patriarch), 295, 301 Ampelius, Publius (prefect), 212 Acacius (count), 301n Amphilochius (bishop of Iconium), 347n Acesius (bishop), 182 Amun, 241 Achaea, 187, 212, 214 Anastasia (half-sister of Constantine), 107n, Actium, 55n 110n, 175n Adam, 255 Anatolius (prefect in 340s), 212 adnotatio, 152–54 Anatolius (prefect in 350s), 212 Adonis, flowerbeds of, 2 Ancyra,157, 166n, 170, 176, 196–97, 201–3, Adriatic Sea, 43, 54, 71, 249 209, 287–88. See also Basil (bishop of Aegean Sea, 36, 358 Ancyra); Marcellus Aelia Capitolina, 296, 300 Andrew (apostle), 315, 338 Aeneas, 8 Antaradus, 113–14 Aetius (heresiarch), 270n, 361n Antioch (in Pisidia), 187 Aezani, 188 Antioch (in Syria), 23, 136, 137n, 188–89, Africa, 7n, 20, 33, 35–38, 51, 135, 146, 212, 197n, 211–14, 319, 328; emperors at, 1, 263–65, 307 113, 116, 164–68, 171, 196, 200, 207, Afyon Karahisar: see Akroenos 245n, 343, 358–60; councils at, 38, 150, Agamemnon (king), 354 176, 257n, 258, 278, 280, 287. See also Agnes (saint): see Church of St. Agnes Eustathius; Euzoius; Flacillus; Akroenos, 220 Flavianus Alamans, 37, 74n, 270 Antoni(n)opolis, 113n, Alaric (king of Visigoths), 76–77 Antoninus Pius (emperor), 24 Albano, 34 Antonius, Marcus, 151 Alexander (bishop of Alexandria), 151n, Antony (ascetic), 119n, 318–29, 341–43. See 256–78, 285n, 286–87, 322, 333, 361 also Athanasius Alexander (bishop, perhaps of Thessalonica), Anullinus (governor), 264n 262n Apennine Mountains, 53 Alexander the Great, 16, 39, 161, 244, 311 Aphaca, 206 Alexandria, 23, 140n, 256–57, 272, 321, 324, Aphrodisias, 154n, 190, 203 329, 338n. -

The Thoughts of the Emperor Marcus Aurelius Antoninus. Translated By
.-^y^' / ^k^ .^ /^ X ; NOTE. I HAVE been informed that an American publisher has printed the first edition of this translation of M. Antoninus. I do not grudge him his profit, if he has made any. There may be many men and women in the United States who will be glad to read the thoughts of the Eoman emperor. If the American politicians, as they are called, would read them also, I should be much pleased, but I do not think the emperor's morality would suit their taste. I have also been informed that the American publisher has dedicated this translation to an American. I have no objection to the book being dedicated to an American ; but in doing this without my consent the publisher has trans- gressed the bouuds of decency. 1 have never dedicated a book to any man, and if I dedicated this, I should choose the man whose name seemed to me most worthy to be joined to that of the Koman soldier and philosopher. I might dedicate the book to the successful general who is now the President of the United States, with the hope that his. integrity and justice will restore peace and happiness, so far as he can, to those unhappy States which have suffered so much from war and the unrelenting hostility of wicked men. But, as the Koman poet said, Victrix causa Deis placuit, sed victa Catoni and if I dedicated this little book to any man, I would dedicate it to him who led the Confederate armies against the powerful invader, and retired from an unequal contest defeated, but not dishonoured ; to the noble Virginian soldier, whose talents and virtues place him by the side of the best and wisest man who sat on the throne of the Imperial Caesars. -

Université De Strasbourg
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ÉCOLE DOCTORALE DES HUMANITES EA 3094 THÈSE présentée par : Wijdene BOUSLEH soutenue le : 5 janvier 2016 pour obtenir le grade de : Docteur de l’université de Strasbourg Discipline/ Spécialité : Sciences de l'Antiquité : langue et littérature anciennes L’IMAGE DE LA PERSE ET DES PERSES AU IVème SIÈCLE CHEZ AMMIEN MARCELLIN. TRADITION ROMAINE ET TRADITION ARABO-PERSANE : REGARDS CROISÉS. THÈSE dirigée par : Mme CHASSIGNET Martine Professeur, Université de Strasbourg RAPPORTEURS : M. BAUDOU Alban Professeur, Université Laval, Québec Mme KASSAB-CHARFI Samia Professeur, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis AUTRES MEMBRES DU JURY : Mme SCHNEIDER Catherine Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg Remerciements Il est dou depie ii a eoaissae à tous eu ui ot aide et soutenue. Je ties daod à epie a pofode gatitude à o Dieteu de recherche, Mme Martine CHASSIGNET, qui, depuis mon mémoire complémentaire de Maste, a eade tout au log de es aes de ehehe. Pa sa igueu, elle a appis à appede. Je remercie par ailleurs Mme Samia KASSAB-CHARFI, Mme Catherine SCHNEIDER et M. Alban BAUDOU pour avoir bien voulu accepter de faire partie du ju hag dalue o taail. Ma gratitude va aussi à mon mari, Faouzi, pour son soutien infaillible et la ophesio dot il a fait peue duat es logues aes, aisi uà es parents. Ils ont toujours cru en moi. À tous, je dis un très grand merci. Ma pese a efi à a fille, Isaa, lage ui a illui a ie et a permis de surmonter mes moments de découragement. Je dédie cette thèse de doctorat aux miens. -

Nur Erzählte Geschichte?
Nur erzählte Geschichte? Untersuchungen zur Darstellungsweise und zur Glaubwürdigkeit des Ammianus Marcellinus (AMM. 16,10; 20,4-5) Band 1 Von der Philosophischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie genehmigte Dissertation vorgelegt von Hermann Kramer Berichter: Universitätsprofessor Dr. Klaus Freitag Universitätsprofessor Dr. Bruno Bleckmann Tag der mündlichen Prüfung: 20. März 2018 Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek online verfügbar. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.........................................................................................................................................1 2. Der Besuch des Constantius in Rom..............................................................................................14 2.1. Text (Ammianus Marcellinus, Res Gestae 16, 10, 1 – 21).....................................................14 2.2 Übersetzung.............................................................................................................................16 2.3 Kommentar..............................................................................................................................20 2.4 Anhänge.................................................................................................................................145 2.4.1 Anhang 1 .......................................................................................................................145 -

Downloaded for Personal Non‐Commercial Research Or Study, Without Prior Permission Or Charge
Magub, Alexandra (2018) Political and Religious Ideologies on Parthian Coins of the 2nd‐1st Centuries BC. PhD thesis. SOAS University of London. http://eprints.soas.ac.uk/30283 Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non‐commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this thesis, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given e.g. AUTHOR (year of submission) "Full thesis title", name of the School or Department, PhD Thesis, pagination. 1 Political and Religious Ideologies on Parthian Coins of the 2nd-1st Centuries BC ALEXANDRA MAGUB Thesis submitted for the degree of PhD 2018 Department of Religions and Philosophies, School of History, Religions and Philosophies SOAS, University of London 3 Brief Abstract This thesis examines a key period of change in Parthian coinage, as the rebellious Parthian satrapy transitioned first from a nomadic to sedentary kingdom in the second half of the 3rd century BC, and then into a great empire during the 2nd-early 1st century BC. The research will focus on the iconography and inscriptions that were employed on the coinage in order to demonstrate how Parthian authorities used these objects to convey political and religious ideologies to a diverse audience. -

The Blood of the Martyrs: the Attitudes of Pagan Emperors and Crowds Towards Christians, from Nero to Julian
The Blood of the Martyrs: The Attitudes of Pagan Emperors and Crowds Towards Christians, From Nero to Julian Domenico Miletti Thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in fulfillment of the requirements for the Master’s degree in Classical Studies Department of Classics and Religious Studies Faculty of Arts and Sciences University of Ottawa © Domenico Miletti, Ottawa, Canada, 2016 Abstract This MA thesis will discuss the reception of common, non-scholarly polytheists (pagans) to the persecution of Christians from the early empire until the Great Persecution (303-313, 322-324). Though modern scholars have addressed this issue and asserted that there was a change in attitude, many have not developed this into anything more than a passing statement. When chronologically analyzing the Christian acts, passions, letters, and speeches recounting the deaths of martyrs deemed historically authentic, and accounting for the literary and biblical topoi, we can demonstrate that the position of non-Christians changed. The methodology of this thesis will chronologically assess the martyr acts, passions, speeches, and letters which are historically accurate after literary and biblical topoi are addressed. These sources are available in the appendix. Throughout this analysis, we will see two currents. The primary current will seek to discern the change in pagan reception of anti-Christian persecution, while the second current will draw attention to the Roman concept of religio and superstitio, both important in understanding civic religion which upheld the pax deorum and defined loyalty to the Roman order through material sacrifices and closely connected to one's citizenship. Religio commonly denoted proper ritual practices, while superstitio defined irregular forms of worship which may endanger the state. -

Ammianus Marcellinus' Silences On
Edinburgh Research Explorer The New Rome and the old: Ammianus Marcellinus' silences on Constantinople Citation for published version: Kelly, G 2003, 'The New Rome and the old: Ammianus Marcellinus' silences on Constantinople', The Classical Quarterly, vol. 53, pp. 588-607. https://doi.org/10.1093/cq/53.2.588 Digital Object Identifier (DOI): 10.1093/cq/53.2.588 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: The Classical Quarterly Publisher Rights Statement: © Kelly, G. (2003). The New Rome and the old: Ammianus Marcellinus' silences on Constantinople. The Classical Quarterly, 53, 588-607doi: 10.1093/cq/53.2.588 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 01. Oct. 2021 The Classical Quarterly http://journals.cambridge.org/CAQ Additional services for The Classical Quarterly: Email alerts: Click here Subscriptions: Click here Commercial reprints: Click here Terms of use : Click here The new Rome and the old: Ammianus Marcellinus’ silences on Constantinople Gavin Kelly The Classical Quarterly / Volume 53 / Issue 02 / December 2003, pp 588 - 607 DOI: 10.1093/cq/53.2.588, Published online: 11 August 2010 Link to this article: http://journals.cambridge.org/abstract_S0009838803000508 How to cite this article: Gavin Kelly (2003).